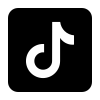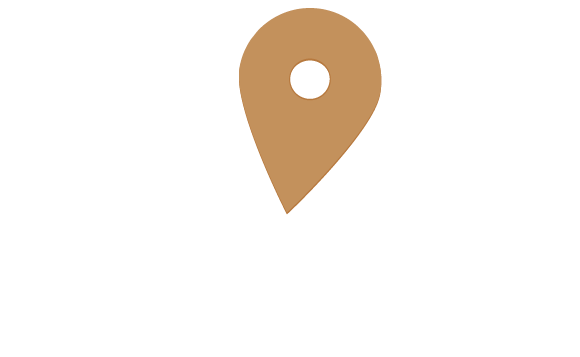Aktenzeichen 1 K 2454/19 Ge
§ 1 KDVG
§ 5 KDVG
Tenor
Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben vom 18. Juni 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 11. September 2019 verpflichtet, den Kläger als Kriegsdienstverweigerer anzuerkennen.
Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die Hinzuziehung des Prozessbevollmächtigten im Vorverfahren wird für notwendig erklärt.
Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor in gleicher Höhe Sicherheit leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Der am …. …. 1991 geborene Kläger ist Soldat auf Zeit und begehrt seine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer.
Mit Bescheid vom 26. März 2010 erkannte die Beklagte den Kläger auf seinen Antrag vom 23. März 2010 hin als Kriegsdienstverweigerer an. Der Kläger leistete vom 1. September 2010 bis 31. Mai 2011 seinen Zivildienst im Herzzentrum Dresden und nahm danach eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger auf.
Unter dem 7. August 2012 bewarb sich der Kläger für eine Einstellung in die Laufbahngruppe der Offiziere. Er gab an, Zeitoffizier mit einer Verpflichtungszeit von 17 Jahren für einen Ausbildungsgang mit Hochschulstudium der Humanmedizin werden zu wollen. Unter dem 23. August 2012 reichte der Kläger bei der Beklagten eine Erklärung ein, wonach er nicht mehr den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen verweigere.
Zum 1. Juli 2013 wurde der Kläger zum Soldaten auf Zeit als Anwärter für die Laufbahn der Offiziere des Sanitätsdienstes eingestellt und zum Sanitätssoldaten ernannt. Das Dienstzeitende wurde auf den 30. Juni 2030 festgesetzt. Vom 1. Juli 2013 bis 26. September 2013 nahm der Kläger an der allgemeinen militärischen Basisausbildung der Sanitätsoffiziersanwärter teil, die die soldatische Basisausbildung und die sanitätsdienstliche Ausbildung umfasste. Er wurde sodann ab 1. Oktober 2013 zum Fachsanitätszentrum Erfurt versetzt und zum Studium der Humanmedizin beurlaubt. Unter dem 29. September 2015 erhielt der Kläger das Zeugnis über den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung. In den Jahren 2016 und 2017 führte der Kläger Famulaturen an der Uniklinik Dresden, im Sanitätsunterstützungszentrum Erfurt, im Bundeswehrkrankenhaus Berlin und im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg durch.
Am 6. Juli 2018 beantragte der Kläger seine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Im Nachgang reichte er bei der Beklagten die von ihm geforderten Unterlagen ein.
Vom 1. August 2018 bis 6. März 2024 wurde dem Kläger Elternzeit bewilligt.
Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr nahm unter dem 20. August 2018 mit der Empfehlung Stellung, den Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer abzulehnen. Daraufhin bat die Beklagte den Kläger, seinen Antrag insbesondere um die Beweggründe der Gewissensentscheidung zu ergänzen. Hierzu legte der Kläger unter dem 8. Januar 2019 eine schriftliche Erklärung, wegen der auf Blatt 19 bis 24 des zweiten Teils der Beiakte Bezug genommen wird, vor. Auf Nachfrage der Beklagten vom 14. März 2019 reichte der Kläger unter dem 4. April 2019 eine schriftliche Erklärung – Blatt 29 bis 44 zweiter Teil der Beiakte – nach.
Mit Bescheid vom 18. Juni 2019 stellte die Beklagte fest, dass der Kläger nicht berechtigt ist, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Wegen des weiteren Inhalts des Bescheides wird auf Blatt 46 bis 49 zweiter Teil der Beiakte Bezug genommen.
Hiergegen legte der Kläger Widerspruch ein, den er mit Schreiben vom 24. Juni 2019 – Blatt 55 bis 61 der Beiakte – begründete und der von der Beklagten mit Widerspruchsbescheid vom 11. September 2019 – Blatt 65 bis 67 zweiter Teil der Beiakte – zurückgewiesen wurde.
Der Kläger hat am 18. September 2018 beim Verwaltungsgericht Weimar Klage erhoben. Das Verwaltungsgericht Weimar hat den Rechtsstreit mit Beschluss vom 29. November 2019 an das Verwaltungsgericht Gera verwiesen.
Wegen des Vortrags des Klägers wird auf die Klageschrift vom 18. September 2019 (Blatt 7 bis 11 der Gerichtsakte) Bezug genommen.
Der Kläger beantragt,
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 18. Juni 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 11. September 2019 zu verpflichten, den Kläger als Kriegsdienstverweigerer anzuerkennen sowie
die Zuziehung eines Bevollmächtigten des Klägers im Vorverfahren für notwendig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Wegen des Vortrags der Beklagten wird auf die Schriftsätze vom 20. Januar 2020 (Blatt 115 bis 122 der Gerichtsakte) und vom 27. Januar 2020 (Blatt 127 der Gerichtsakte) und wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge der Beklagten (1 Heftung) Bezug genommen.
Der Rechtsstreit ist mit Beschluss der Kammer vom 21. Juli 2021 auf die Berichterstatterin als Einzelrichterin übertragen worden. Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung des Klägers. Wegen des Inhalts der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung vom 29. September 2021 verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die als Verpflichtungsklage statthafte Klage ist zulässig.
Insbesondere steht dem Kläger als Zeitsoldaten ein Rechtsschutzbedürfnis zu. Grundsätzlich können nämlich nicht nur gediente und ungediente Wehrpflichtige, sondern auch Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit ihre Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer beantragen (vgl. § 2 Abs. 6 Satz 3 des Gesetzes über die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe aus Gewissensgründen (Kriegsdienstverweigerungsgesetz) – KDVG -, §§ 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, 55 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten – SG -). Der Kläger kann auch nicht auf ein vorrangig zu betreibendes Dienstentlassungsverfahren verwiesen werden. Die dahingehende frühere Rechtsprechung, der zufolge Berufs- und Zeitsoldaten im Sanitätsdienst der Bundeswehr aus Rechtsgründen kein Rechtsschutzbedürfnis für ein auf ihre Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer gerichtetes Verfahren zuzubilligen sei, hat das Bundesverwaltungsgericht mittlerweile aufgegeben (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 22. Februar 2012 – 6 C 11/11 -, juris).
Die Klage ist auch begründet. Der Kläger hat Anspruch auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Der Bescheid der Beklagten vom 18. Juni 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 11. September 2019 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).
Gemäß Art. 4 Abs. 3 S. 1 GG darf niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden, wobei die näheren Einzelheiten der Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer im KDVG geregelt sind (Art. 4 Abs. 3 S. 2 GG, § 1 KDVG).
Der Schutzbereich des Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG umfasst die prinzipielle Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe aufgrund einer Gewissensentscheidung des Einzelnen, der für sich den Dienst mit der Waffe in Frieden und Krieg schlechthin und allgemein ablehnt. Eine Gewissensentscheidung ist dabei jede ernste sittliche, d. h. an den Kategorien von „gut“ und „böse“ orientierte Entscheidung, die der Einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, sodass er gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte. Die Entscheidung muss sich ihrem Inhalt nach gegen den Waffendienst schlechthin richten; sie ist insoweit eine generelle und absolute Entscheidung. Gemeint ist das Gewissensverbot, Waffen, gleich welcher Art, zu führen. Das Gewissen verbietet ein Tun, das unmittelbar darauf gerichtet ist, mit jeweils zur Verwendung kommenden Waffen Menschen im Krieg zu töten. Auf das Grundrecht kann sich dabei auch derjenige berufen, der in den waffenlosen Gattungen der Bundeswehr dient. Eine Weigerung, Sanitätsdienst zu tun, ist von dem Schutz der Gewissensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit der Waffe gedeckt. Das gilt sowohl dann, wenn der Wehrpflichtige befürchtet, als Sanitäter ausnahmsweise Waffen zur Verteidigung anwenden zu müssen, als auch selbst dann, wenn ihn der mittelbar der kriegerischen Gewalt förderliche Dienst als solcher unzumutbar seelisch belastet (BVerwG, Beschluss vom 13. Dezember 1976 – VI B 50.76 -, Buchholz 448.0 § 25 WPflG Nr. 104). Dies beruht darauf, dass ein anerkannter Kriegsdienstverweigerer nach der positiv-rechtlichen Regelung des Art. 12 a Abs. 2 Satz 3 GG berechtigt ist, einen Ersatzdienst zu wählen, der „in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht“, folglich auch nicht verpflichtet ist und nicht verpflichtet werden kann, etwa in einem Militärlazarett, das als solches „im Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte steht“, Dienst zu tun (Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 17. Mai 2010 – 2 KO 63/10 -; BVerwG, Urteil vom 30. September 1987 – 6 C 49/85 -; BVerwG, Urteil vom 26. März 1990 – 6 C 24/88 -; jeweils zitiert nach juris).
Wer aus Gewissensgründen unter Berufung auf das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung im Sinne des Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, wird gemäß § 1 Abs. 1 des KDVG als Kriegsdienstverweigerer anerkannt. Nach § 5 KDVG ist eine Person auf Antrag hin als Kriegsdienstverweigerer anzuerkennen, wenn 1. der Antrag vollständig ist, 2. die dargelegten Beweggründe das Recht auf Kriegsdienstverweigerung zu begründen geeignet sind und 3. das tatsächliche Gesamtvorbringen und die dem Bundesamt bekannten sonstigen Tatsachen keine Zweifel an der Wahrheit der Angaben des Antragstellers begründen oder die Zweifel aufgrund einer Anhörung nicht mehr bestehen.
Die genannten Voraussetzungen liegen beim Kläger vor. Der Antrag des Klägers ist vollständig und seine Beweggründe vermögen einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zu rechtfertigen. Auch an der Wahrheit der Angaben des Klägers bestehen keine Zweifel. Das Gericht ist aufgrund der Parteivernehmung des Klägers in der mündlichen Verhandlung zu der Überzeugung gelangt, dass er aus Gewissensgründen im Sinne von Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG und § 1 Abs. 1 KDVG den Dienst an der Waffe berechtigt verweigert.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts setzt der auf Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG und § 1 Abs. 1 KDVG gestützte Anspruch auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer voraus, dass der Betroffene eine Gewissensentscheidung gegen das Töten im Krieg getroffen hat, die er als für sich unbedingt verpflichtend empfindet, sodass ihre Missachtung voraussichtlich eine schwere Gewissensnot hervorrufen würde. Dies ist aufgrund der persönlichen Entwicklung, der Lebensführung, des bisherigen Verhaltens, der Einflüsse, denen er ausgesetzt war und noch ist, sowie aufgrund der Motivation seiner Entscheidungsbildung zu beurteilen (BVerwG, Beschluss vom 31. März 2021 – 6 B 55/20 -, juris m. w. N.). Für die Annahme einer Gewissensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit der Waffe im Sinne von Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG darf nicht das „Zerbrechen der Persönlichkeit“ und auch nicht ein „schwerer seelischer Schaden“ als Folge des Zwanges, Kriegsdienst mit der Waffe zu leisten, verlangt werden; vielmehr genügt eine „schwere Gewissensnot“, die im Einzelfall zu einem seelischen Schaden führen kann, aber nicht muss (BVerwG, Urteil vom 1. Februar 1989 – 6 C 61/86 -, juris). Handelt es sich um Personen, die sich freiwillig als Soldaten auf Zeit verpflichtet und schon mehrere Jahre Wehrdienst geleistet haben ohne einen Konflikt mit dem Gewissen zu empfinden, kann von einer Ersthaftigkeit der Gewissensentscheidung nur ausgegangen werden bei einer „Umkehr“ der früheren Einstellung gegenüber dem Kriegsdienst mit der Waffe (BVerwG, Beschluss vom 29. April 1991 – 6 B 9/91 -, juris). Eine solche Umkehr kann das Ergebnis eines „Schlüsselerlebnisses“ sein, sie kann aber ebenso am Ende eines Wandlungsprozesses und einer Entwicklung stehen, die ohne spektakuläre äußere Umstände zu einer innerlich absolut verbindlichen Entscheidung gegen jegliches Töten im Kriege geführt hat, so dass die Anforderungen an die Annahme einer Gewissensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit der Waffe im Sinne von Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG erfüllt sind (BVerwG, Urteil vom 2. März 1989 – 6 C 10/87 -, juris).
Die Frage, ob der Wehrpflichtige eine solche Gewissensentscheidung getroffen hat, ist vom Verwaltungsgericht gemäß § 86 VwGO von Amts wegen durch eine möglichst eingehende Beweisaufnahme aufzuklären. Dabei ist angesichts der Schwierigkeiten, die sich bei der Aufklärung der in Betracht kommenden seelischen Vorgänge zwangsläufig ergeben, der Beweiswert der förmlichen Aussage des Betroffenen im Rahmen des Möglichen wohlwollend zu beurteilen (BVerwG, Urteil vom 18. Oktober 1972 – VIII C 46.72 -, juris). Ein voller Beweis dafür, dass der Kriegsdienst aus durch Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG geschützten Gewissensgründen verweigert werde, lässt sich häufig nicht führen. Die Entscheidung richtet sich insgesamt danach, ob eine Gewissensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit hoher Wahrscheinlichkeit bzw. hinreichend sicher bejaht werden kann oder nicht. Kann sich das Gericht auch bei wohlwollender Beurteilung des Sachverhalts im Rahmen der ihm obliegenden Beweiswürdigung nicht dazu entschließen, das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen der erforderlichen Gewissensentscheidung abschließend zu bejahen, geht dies nach den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts zu Lasten des seine Anerkennung begehrenden Kriegsdienstverweigerers (BVerwG, Beschluss vom 26. Juni 2014 – 6 B 17/14 -, juris).
Nach diesen Maßstäben ist das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass der Kläger mit hinreichender Sicherheit eine Gewissensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit der Waffe i. S. d. dargestellten Schutzbereiches des Art. 4 Abs. 3 GG getroffen hat, die das Ergebnis einer Entwicklung während der Zugehörigkeit des Klägers zur Bundeswehr darstellte. Der Kläger hat im Rahmen seiner Aussage in der mündlichen Verhandlung sowie in seinen schriftlichen Darlegungen schlüssig dargelegt, dass er ohne schwere Gewissensnot als Angehöriger des Sanitätsdienstes auch nicht ausnahmsweise Waffen zur Verteidigung anwenden kann und dass ihn der Sanitätsdienst als ein mittelbar der kriegerischen Gewalt förderlicher Dienst als solcher unzumutbar seelisch belastet.
1.
Der Kläger hat glaubhaft dargestellt, dass er zunächst die Vorstellung hatte, als Angehöriger des Sanitätsdienstes der Bundeswehr lediglich „uniformierter Einsatzhelfer“ bzw. „Staatsbürger in Uniform“ zu sein und als dieser sich den von der Bundeswehr angebotenen besonderen medizinischen Herausforderungen, z. B. in Auslandseinsätzen und in Form von Hochleistungsmedizin, stellen zu können.
Hierzu hat der Kläger bei seiner Befragung durch das Gericht ausgeführt: „[…] Weil die innere Führung der Bundeswehr ein Bild vermittelt, das einen Soldaten darstellt als uniformierten Einsatzhelfer bzw. Staatsbürger in Uniform und mit diesem Image eine völlige Diskrepanz darstellt zum Alltag in der Bundeswehr, war mir bei meiner Bewerbung auch nicht bewusst, was es wirklich heißt, Bundeswehrangehöriger zu sein. Das mir dargestellte Bild war mir einfach zu abstrakt. […] Die Grundausbildung fand nur mit späteren Sanitätsoffizieren statt. Das Militärischste daran waren die Schießübungen und das Marschieren. Ansonsten befand ich mich hierbei unter meinesgleichen. Wir hatten alle das Ziel, Medizin zu studieren und Sanitätsoffiziere zu werden. Bei Vorträgen wurde uns Sanitätsoffiziersanwärtern ständig gesagt, dass man nur im Sanitätsbereich tätig sein würde. […]“
Im Einklang hierzu stehen die schriftlichen Einlassungen des Klägers:
In dem Schreiben vom 8. Januar 2019 hieß es, der Sanitätsdienst habe sich für den Kläger als Einrichtung präsentiert, die sich der gesundheitlichen Bedürfnisse von Soldaten als auch von Zivilisten ähnlich der Gesundheitsversorgung im zivilen Bereich annehme. Ihm hätten zusätzliche Einsatzgebiete im Bereich des flugmedizinischen Dienstes bzw. sportmedizinischer Einsatzmöglichkeiten imponiert. Diese Herausforderungen im medizinischen Sinne hätten keine Gewissenskonflikte, wie z. B. die 2010 vorgesehene Verwendung in einem Logistikbataillon mit Dienst an der Waffe im Zuge der allgemeinen Wehrpflicht, geschürt. Aufgrund falscher Vorstellungen des wirklichen Berufsbildes eines Arztes bei der Bundeswehr habe er sich zunächst verpflichten lassen. Während des Studiums habe er bis zum Offizierslehrgang und der ersten Famulatur keine Berührungspunkte zur Bundeswehr gehabt und das zivile Studium an der Universität habe ihn in seiner Überzeugung bestärkt, das Richtige zu tun. Vor Diensteintritt habe er die Vorstellung von einer kameradschaftlichen Einheit des Sanitätsdienstes gehabt, die als 4. Streitkraft neben Heer, Marine und Luftwaffe für die medizinische Versorgung von Soldaten und Zivilisten zuständig sei. Ihm habe ein Tätigkeitsgebiet ähnlich dem eines Arztes von „Ärzte ohne Grenzen“ vorgeschwebt, allerdings mit den Vorteilen einer entsprechenden Vergütung und hohen Sicherheitsstandards. Dass der Kampf und die Gefechtssituation obligate Aufgaben auch für Sanitätssoldaten seien, sei ihm nicht bewusst gewesen und sei auch seiner Ansicht nach vor Dienstantritt nicht deutlich genug kommuniziert worden.
Weiter führte der Kläger im Schreiben vom 4. April 2019 aus, ein Bekannter habe ihm begeistert von der Bundeswehr als Arbeitgeber berichtet. Er habe gemeint, da der Kläger schon immer zu „Ärzte ohne Grenzen“ habe gehen wollen, sei eine Verwendung als Sanitätsoffizier für ihn wie gemacht. Er könne so humanitäre Auslandshilfe leisten, werde gut bezahlt und es gäbe sichere Verhältnisse vor Ort, da die anderen Soldaten die Region absichern würden und es deswegen nicht wie bei „Ärzte ohne Grenzen“ zur Gefährdung des medizinischen Personals durch feindliche Milizen kommen würde. Er habe vor der Entscheidung, das Medizinstudium über die Bundeswehr zu absolvieren, die Informationen des Bundesministeriums für Verteidigung zur Information über das Berufsbild des Sanitätsoffiziers genutzt. Begeistert von den Möglichkeiten des medizinischen Einsatzspektrums und dem globalen Tätigkeitsfeld habe er zuversichtlich an dem dreitägigen Eignungstest in Köln teilgenommen. Dort sei ihm von einer Ärztin in dem abschließenden fachlichen Eignungsgespräch schwärmend von der erfüllenden Tätigkeit eines Arztes bei der Bundeswehr in hochmodernen mobilen Krankenhäusern oder fliegenden Intensivstationen an weltweiten Einsatzorten berichtet worden. Diese habe gesagt, man müsse sich zwar noch die drei Monate durch die Grundausbildung quälen, dann stünde einer tollen beruflichen Zukunft aber nichts mehr im Wege. Fest in diesem Glauben habe er sich auf die bevorstehende Zeit gefreut und die Grundausbildung angetreten. Durch die Ausbilder dort sei ihnen vom ersten Tag an deutlich gemacht worden, dass sie ja nur die späteren Ärzte seien, die vom Militär keine Ahnung hätten und das sei auch gut so. Sie hätten sich ja schließlich um die medizinische Versorgung zu kümmern. Bei der Bundeswehr würden Ärzte in den Augen der kämpfenden Truppen nicht als gleichwertige Soldaten angesehen und bezüglich ihrer militärischen Fähigkeiten belächelt. Er habe sich auch nie mit anderen Soldaten außer denen des Sanitätsdienstes verbunden gefühlt und auch nicht gefunden, militärisch gut ausgebildet zu sein. Er habe sich ausschließlich als Angehöriger des Sanitätsdienstes gesehen, zumal er durch die Beurlaubung zum zivilen Studium keine Beziehung zu anderen Soldaten habe aufbauen können.
Ferner gab der Kläger im Schreiben vom 4. April 2019 an, die vom Bundesministerium der Verteidigung festgelegten Pflichten für Soldaten im Sanitätsdienst – die Gewährleistung einer medizinischen Versorgung, die im Inland und im Ausland deutschem Standard entspreche, die Betreuung und Versorgung bedürftiger Soldaten und Zivilisten, die Weiterbildung des Sanitätspersonals und medizinische Forschung, die humanitäre Auslandshilfe und Katastrophenhilfe sowie die Teilnahme am öffentlichen Rettungsdienst, Tauglichkeitsprüfung, Labordiagnostik etc. – seien sehr sinnvolle Aufträge. Weil insbesondere die humanitäre Auslandshilfe sein Interesse geweckt habe, habe er viel über die ärztliche Arbeit während dieser Einsätze recherchiert und sei begeistert von der Hochleistungsmedizin gewesen. Er habe sich daher anfangs sehr gut mit dem Berufsbild eines Sanitätsoffiziers identifizieren können und sich auf die kommende Zeit gefreut. Daher habe er auch gerne die Grundausbildung absolviert und die schon während dieser Zeit auftretenden Gewissensbisse nicht weiter beachtet. Seine anfängliche Begeisterung für den Beruf und der nötige Abstand zwischen den Praktika hätten ihn anfangs glauben lassen, dass die schlechten Erfahrungen vielleicht Einzelfälle seien und nicht den Alltag darstellten.
Im Schreiben vom 4. April 2019 heißt es weiter, dem Kläger sei auch nach der Grundausbildung und dem Offizierslehrgang nicht bewusst gewesen, dass er in die Verlegenheit kommen würde, tatsächlich eine Waffe auf einen anderen Menschen zu richten, um diesen zu verletzen oder zu töten. Bei jeder Schießübung sei penibel darauf geachtet worden, dass der Lauf der Waffe niemals auf eine Person gerichtet werde. Er habe es daher die Waffenausbildung als notwendiges Übel zum Bestehen der Grundausbildung bzw. wie gewisse Lerninhalte während der Schulzeit empfunden und gedacht, dass diese für seine weitere Zukunft nicht relevant werden würde. Weil er vor der Grundausbildung auch nie Kontakt mit Waffen gehabe habe, sei ihm nicht bewusst gewesen, welchen Eindruck der Gebrauch einer echten Waffe bei ihm auslöse. Er habe gemerkt, dass er im Ernstfall nicht auf Menschen schießen könnte. Dies habe er vor der Verpflichtung in dem Maße nicht vermutet.
Nach allem steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger bei seiner Bewerbung bei der Bundeswehr als Sanitätsoffizier aufgrund der ihm von einem Bekannten, den Aussagen der Ärztin beim Eignungstest und der Eigendarstellung der Bundeswehr davon ausging, als Sanitätsoffizier lediglich eine ärztliche Dienstleistung bei der Bundeswehr erbringen zu müssen. Diese Vorstellung des Klägers wurde nach Eintritt in die Bundeswehr dadurch bekräftigt, dass der Kläger bei der Grundausbildung nur mit Soldaten des Sanitätsdienstes ausgebildet sowie durch die Ausbilder die nichtmilitärische Rolle der Sanitätsoffiziere betont wurde. Eine Beziehung zu anderen Soldaten, die nicht Sanitätsoffiziersanwärter waren, konnte durch die Beurlaubung zum zivilen Studium nicht ausgeprägt werden. Angesichts der fehlenden Berührungspunkte mit dem Bundeswehralltag wurde die abstrakte Vorstellung des Klägers von seiner späteren Tätigkeit als Arzt bei der Bundeswehr, die für ihn insbesondere mit dem Einsatz modernster Technik verbunden war, aufrechterhalten.
2.
Aus den weiteren Angaben des Klägers in seinen Schreiben vom 8. Januar 2019 und vom 4. April 2019 sowie in der mündlichen Verhandlung folgt zur Überzeugung des Gerichts, dass der Kläger erst im Rahmen der in den Jahren 2016/2017 durchgeführten Famulaturen mit dem tatsächlichen Berufsbild eines Sanitätsoffiziers konfrontiert wurde, was bei ihm eine Entwicklung angestoßen hat, die in der Erkenntnis mündete, nur noch durch eine Kriegsdienstverweigerung die ihn als unzumutbar seelisch belastende Situation als Angehöriger der Bundeswehr, der als Soldat des Sanitätsdienstes in bestimmten Situationen selbst zu Waffengewalt greifen muss, zumindest aber mittelbar kriegerische Gewalt fördert, beenden zu können.
Im Schreiben vom 4. April 2019 hat der Kläger ausgeführt, der Gewissenskonflikt im konkreten Zusammenhang mit seiner Verwendung als Sanitätsoffizier habe im Sommer 2016 bei der Pflichtfamulatur im Sanitätsunterstützungszentrum Erfurt begonnen. Dort habe er das erste Mal von einem Arzt der Bundeswehr Erlebnisse des Berufsalltags geschildert bekommen. Hierzu führte der Kläger bereits im Schreiben vom 8. Januar 2019 aus, beim Truppenarztpraktikum im Sanitätsunterstützungszentrum Erfurt habe der Truppenarzt von unzähligen Auslandseinsätzen berichtet. So habe er beispielsweise den Fall eines Truppenarztes berichtet, mit dem er den Einsatz in einer Patrouille in Afghanistan getauscht habe und der bei diesem Einsatz ums Leben gekommen sei. Im Schreiben vom 4. April 2019 heißt es weiter: Die aufkommenden Gewissensbisse habe er verdrängen können, weil er gedacht habe, dieser Truppenarzt aus Erfurt habe eine sehr ungewöhnliche Laufbahn absolviert. Allerdings hätten die Berichte dazu geführt, dass er lange Zeit mit seiner Partnerin, seinen Eltern und Studenten der Bundeswehr darüber gesprochen und Mühe gehabt habe, durch seinen ausgelösten inneren Konflikt wieder einem geordneten Alltag nachzugehen. Mit genügendem Abstand von der Bundeswehr nach Ende der Famulatur und mit Beginn neuer Aufgaben während des nächsten Semesters seien diese Gedanken zunächst in den Hintergrund getreten. In den Tagen vor Antritt der nächsten Famulatur im Bundeswehrkrankenhaus Berlin seien ihn eine innere Unruhe und nächtliches Grübeln überkommen. Er habe sich vorgenommen, sich erneut intensiv mit den dortigen Ärzten über ihre berufliche Karriere auszutauschen, da er noch davon überzeugt gewesen sei, das Richtige zu tun und in Erfurt einem Einzelschicksal begegnet zu sein. Die Schilderungen von den Ärzten aus dem Bundeswehrkrankenhaus Berlin hätten ihn aber noch schwerer getroffen. Hierzu schrieb der Kläger bereits im Schreiben vom 8. Januar 2019: Bei der Famulatur im Bundeswehrkrankenhaus Berlin im März 2017 habe der Stationsarzt von seinen Erfahrungen im Auslandseinsatz berichtet. Dieser sei in Afghanistan angefordert worden, als 2016 der Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat stattgefunden habe. Obwohl der Auftrag gelautet habe, die in dem Zusammenhang verletzten Soldaten und Menschen zu versorgen, seien die deutschen Sanitätssoldaten angesichts der Gefechtslage unmittelbar gezwungen gewesen, an dem Gefecht teilzunehmen. Weiter erzählte der Kläger im Schreiben vom 8. Januar 2019, ihn hätten diese Berichte – ähnliche Berichte von tötenden und kämpfenden Sanitätssoldaten habe er bei jeglichen Praktika, Famulaturen und Lehrgängen erfahren – zutiefst schockiert. Es sei Alltag für jeden Soldaten im Auslandseinsatz mit Gefechtssituationen konfrontiert zu werden und Waffen zur Konfliktlösung einzusetzen. Er könne dies mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. In den letzten Monaten habe er sich intensiv mit Krieg und Gewalt auseinandergesetzt, wobei sich immer wieder gezeigt habe, dass er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne, an kriegsbedingten Handlungen teilzunehmen und in diesem Rahmen Menschen zu verletzen oder sogar zu töten. Es sei ihm unglaublich schwer gefallen, einzusehen, dass es die falsche Entscheidung gewesen sei, sich bei der Bundeswehr zu verpflichten. Weiter erwähnte der Kläger im Schreiben vom 8. Januar 2019 den Fall eines Soldaten, den er bei seiner Famulatur an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Dresden kennengelernt habe. Dieser habe bei einer Mission in Afghanistan – es sei um die Installation eines Brunnens in einem Dorf gegangen – alle seine Kameraden verloren und sein Leben nur durch das gezwungenermaßene Töten anderer Menschen retten können. Seitdem verfolgten diesen Soldaten Alpträume, Spannungszustände und Wahnvorstellungen und er könne nur mit stärksten Medikamenten von diesen Zuständen befreit werden. Der Kläger knüpfte an diese Darstellung im Schreiben vom 4. April 2019 an, indem er ausführte, nachdem er während der Famulatur an der Uniklinik Dresden einen Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörung mitbetreut habe, habe er sich verstärkt mit dem Einfluss psychischer Faktoren auf die Organfunktionen beschäftigt. Weil er auf dem Gebiet der Emotionsforschung eine Doktorarbeit habe beginnen wollen, habe er sich ausführlich mit der Psychoanalyse nach Hans Lungwitz beschäftigt, sei Mitglied im Hans-Lungwitz-Institut geworden und habe Analysen an PTBS-erkrankten Menschen durchgeführt, um mehr über den psychischen Einfluss auf die Organfunktionen erfahren zu können. Durch die Beschäftigung mit diesem Thema sei ihm klarer denn je geworden, welche Auswirkungen Krieg habe und dass es noch schlimmere Folgen von Krieg gäbe als den Tod eines Menschen. Im Schreiben vom 4. April 2019 heißt es weiter, im Laufe der Erlebnisse bei der Bundeswehr habe der Kläger einen Reifungsprozess vollzogen und erkannt, dass auch er als späterer Arzt zum Töten ausgebildet werde und im Ernstfall entsprechende Befehle nicht befolgen könne. Er habe sich immer wieder geprüft und im Glauben an seinen Eid und die anfängliche Begeisterung für den Beruf des Sanitätsoffiziers an einer Beschäftigung bei der Bundeswehr festgehalten. Nachdem er die Berichte der Ärzte gehört habe, sei dies nur mit der Unterstützung seiner Partnerin und seiner Eltern möglich gewesen. Nachdem er sich im Anschluss an die Famulatur in der Uniklinik Dresden näher mit der Verbindung von Emotionen und Organfunktionen auseinandergesetzt habe, habe er erkannt, dass Kriegstraumata noch viel schlimmere Folgen als die körperliche Verletzung oder der Tod eines Menschen seien. Sein Gewissenskonflikt sei so stark geworden, dass es keine Alternative zu einem Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gegeben habe. Er habe zu diesem Zeitpunkt starke psychische und physische Beschwerden und kein anderes Thema als seinen Gewissenskonflikt mehr gehabt.
Bei seiner Parteivernehmung hat der Kläger, seine Aussage vertiefend, angegeben: „Wie bereits gesagt, war das Berufsziel Sanitätsoffizier für mich zunächst sehr abstrakt. Erst im Rahmen der Famulaturen habe ich Ärzte kennengelernt und bin mit der Wirklichkeit konfrontiert worden, insbesondere mit traumatisierten Patienten. Die Soldaten mit posttraumatischem Belastungssyndrom haben mich sehr interessiert. […] Für mich war es gar nicht lebenswert, wie traumatisierte Personen noch Jahre später leiden. Insoweit fand ich es regelrecht ekelhaft, wenn von ca. 400.000 Soldaten, die aus Auslandseinsätzen wieder nach Deutschland gekommen sind, ca. 100.000 Soldaten psychisch oder physisch gestört sind. Ich musste aber feststellen, dass ich quasi Teil des Ganzen war. Deswegen habe ich mich auch schlecht gefühlt, zumal ich durch meine wissenschaftlichen Forschungen auch noch etwas Positives aus den Erkrankungen der anderen gezogen habe. Ich kam zu einem Punkt, an dem ich das alles nicht mehr ertragen konnte und auch nicht mehr Arzt werden wollte. Als dann am __.__.2018 mein Sohn geboren wurde, war mir klar, dass ich unbedingt einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen musste. Nach der Stellung dieses Antrags besserte sich dann auch meine gesundheitliche Situation wieder.“
3.
Das Gericht hat aus dem gesamten Vorbringen des Klägers die Überzeugung gewonnen, dass dieser erst durch die Famulaturen in den Jahren 2016/2017 in den Einrichtungen der Bundeswehr und an der Universitätsklinik Dresden erkannt hat, dass er auch als Sanitätssoldat in bestimmten Situationen Waffengewalt gegen Menschen anwenden muss, dazu aber aus Gewissensgründen nicht in der Lage ist. Weiter ist zur Überzeugung des Gerichts gelangt, dass die intensive Beschäftigung des Klägers mit kriegstraumatisierten Patienten außerdem zu einem schweren Gewissenskonflikt dergestalt geführt hat, dass der Kläger sich allein durch seine Zugehörigkeit zur Bundeswehr als mitschuldiger Verantwortlicher für gesundheitliche Verletzungen anderer ansieht. Die Gewissensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit der Waffe stellt sich nach allem als das Ende einer Entwicklung des Klägers im Laufe seiner Zeit bei der Bundeswehr dar. Damit hat der Kläger die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung geforderte „Umkehr“ seiner Einstellung gegenüber dem Zeitpunkt bei Eintritt in die Bundeswehr vollzogen.
4.
Vor der erkennenden Richterin hat der Kläger einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Die Einlassungen des Klägers in seinen Schreiben vom 8. Januar 2019 und vom 4. April 2019 sowie bei seiner Vernehmung durch das Gericht sind in sich stimmig und glaubhaft. Die schwere Gewissensnot des Klägers ist insbesondere auch im Hinblick auf die vom Kläger dargestellte Erziehung im Elternhaus und seine ethischen Vorstellungen nachvollziehbar. Der Kläger hat in dem Schreiben vom 8. Januar 2019 hierzu ausgeführt, dass er in einem christlichen Elternhaus nach christlichen Normen und Werten aufgewachsen sei und die genossene Erziehung und die damit vermittelten Grundsätze im Umgang mit Menschen und im gemeinschaftlichen Zusammenleben für ihn im Widerspruch zum Kriegsdienst und der Waffengewalt stünden. Ihm sei von Anfang an vermittelt worden, Konflikte gewaltfrei, durch Diskussionen und verbalen Austausch zu lösen und gewaltsame Auseinandersetzungen immer zu meiden. Weiter schreibt er, dass er Gottesdienste besucht, täglich betet und allein das Gebot „Du sollst nicht töten.“ ihm den Zugang zu Krieg und Waffengewalt verwehre.
Die ethischen Vorstellungen des Klägers stehen auch nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass der Kläger sich überhaupt als Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr verpflichtet hat. Der Kläger hat hierzu nachvollziehbar im Schreiben vom 4. April 2019 ausgeführt, dass er davon ausgegangen sei, seinen Glauben im Dienstalltag der Bundeswehr ausüben zu können. Er habe bei einer Recherche zu dieser Frage festgestellt, dass es viele gläubige Soldaten und auch Pfarrer im Dienste der Bundeswehr gäbe. Des Weiteren habe er angesichts seiner expliziten Verwendung als Sanitätsoffizier keinen Widerspruch zu seinen christlichen Normen und Werten gesehen.
Anders als die Beklagte sieht das Gericht auch die Tatsache, dass der Kläger bereits im Jahre 2010 als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wurde, nicht als einer ernsthaften Gewissensentscheidung entgegenstehend an. Der Kläger hat dies nämlich nachvollziehbar damit begründet, dass er seinen Wehrdienst im Jahre 2010 rein militärisch habe ableisten sollen, die spätere Verwendung als Soldat im Sanitätsdienst sich demgegenüber für ihn zunächst nur als „uniformierter Einsatzhelfer“ dargestellt habe. Der Kläger hat hierzu neben den bereits dargestellten Ausführungen ergänzend im Schreiben vom 4. April 2019 mitgeteilt, er habe im Jahre 2010 bei einem Logistikbataillon seinen Wehrdienst ableisten sollen. Da er aber aufgrund seiner ethischen und moralischen Überzeugungen einen grundsätzlichen Gewissenskonflikt mit dem Militärdienst habe, sei für ihn eine derartige Verwendung nicht in Frage gekommen. Die Erzählungen eines Bekannten, der ihm begeistert von der Bundeswehr als Arbeitgeber erzählt und gemeint habe, eine Verwendung als Sanitätsoffizier sei für ihn wie gemacht, hätten zu einer Recherche über das Aufgabenspektrum eines Sanitätsoffiziers geführt. Hierbei habe er damals keinen Widerspruch zu seinen Überzeugungen im zwischenmenschlichen Umgang feststellen können.
Das Gericht kann außerdem die Ausführungen der Beklagten nicht nachvollziehen, der wahre Grund für die Entscheidung des Klägers gegen eine weitere Zugehörigkeit zur Bundeswehr seien die organisatorischen Schwierigkeiten, die insbesondere mit der nicht unbedingt heimatnahen Verwendung des Klägers verbunden seien; die Angst, seine Beziehung bzw. den Kontakt zu seinem Sohn zu verlieren, sei nicht von Art. 4 Abs. 3 GG umfasst (vgl. den Widerspruchsbescheid vom 11. September 2019, Seite 2 a. E. sowie Klageerwiderung vom 20. Januar 2020, Seite 7/8). Der Kläger hat eine Äußerung, die Grundlage für eine solche Einschätzung durch die Beklagte bietet, nicht getätigt. Soweit die Beklagte ihrer Wertung die Äußerung des Klägers im Widerspruchsschreiben vom 24. Juni 2019 „Würde ich bei der Bundeswehr bleiben, würde das bedeuten, dass ich meine Familie verlieren würde und ich mein Kind nur noch selten sehen könnte, aufgrund der Tatsache, dass meine Verlobte in ihrer Heimatstadt J…_ bleiben würde und ich in einem Bundeswehrkrankenhaus weit weg stationiert wäre.“ zugrunde legt, misst die Beklagte diesem Satz eine Bedeutung bei, die er nicht hat. Denn aus den weiteren Äußerungen des Klägers im Schreiben vom 24. Juni 2019, insbesondere unmittelbar vor und nach dem zitierten Satz folgt, dass der Kläger bei weiterer Beschäftigung bei der Bundeswehr weiterhin einen Gewissenskonflikt hätte und damit die dadurch entstandenen psychischen und physischen Beschwerden des Klägers bestehen bleiben würden. Diese würden dann zu einem Zerbrechen seiner Beziehung führen, was zugleich bedeutete, dass er – weil seine Verlobte mit dem gemeinsamen Sohn für diesen Fall in J…_ wohnen bleiben würde – sein Kind nur noch selten sehen könnte. Der Kläger hat nämlich auch ausgeführt: „Nach Geburt unseres Sohnes und der anfänglichen Freude, wurde die familiäre Situation aufgrund des oben geschilderten krassen Kontrastes durch meine Beschäftigung bei der Bundeswehr immer angespannter und es kam zur Absage des geplanten Hochzeitstermins aufgrund meiner psychischen Verfassung, die sich auf alle Familienmitglieder übertrug. Wir kamen zu dem Schluss, dass es so nicht weitergehen konnte. Meine Verlobte konnte sich nicht noch Vollzeit um eine weitere Person kümmern. Des Weiteren wurde meine berufliche Existenz erheblich gefährdet, da ich nicht mehr leistungsfähig war und damit die finanzielle Absicherung der Familie bedroht war. Diese Aspekte verstärkten die Beschwerden noch zusätzlich. Es kam infolge dessen aber nicht nur zur Absage des Hochzeitstermins, sondern auch zu der Einschätzung, dass die Beziehung bei weiterer Beschäftigung bei der Bundeswehr endgültig in die Brüche gehen würde. […] Ich möchte an dieser Stelle unbedingt betonen, dass es zu dieser verfahrenen Situation aufgrund meiner Erlebnisse bei der Bundeswehr kam, die für mich zuletzt schwere psychische Folgen hatten. Meine Verlobt hätte mich bei allen Vorhaben unterstützt und wäre bereit gewesen, mir überall hin zu folgen. Da wir beide nicht möchten, dass unser Sohn ohne Vater aufwachsen muss, stellte ich den KDV-Antrag, um die Integrität und Gesundheit aller Familienmitglieder nicht zu gefährden und meinem Sohn wieder ein liebevoller Vater und meiner Verlobten ein fürsorglicher Mann sein zu können.“ Die Interpretation des zitierten Satzes durch die Beklagte ist aus dem Zusammenhang gerissen und daher nicht vertretbar.
5.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1 Satz 1 VwGO.
Die Zuziehung eines Bevollmächtigten durch den Kläger im Vorverfahren war gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO als notwendig anzuerkennen, weil sie vom Standpunkt einer verständigen, nicht rechtskundigen Partei für erforderlich gehalten werden durfte (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 23. Auflage, § 162 Rn. 18 m. w. N.).
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit und die Vollstreckungsabwendungsbefugnis beruht auf § 167 VwGO, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.
Die Revision ist nicht gemäß § 135 VwGO i. V. m. § 10 Abs. 2 KDVG zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 VwGO nicht vorliegen.
Beschluss
Der Wert des Streitgegenstandes wird gemäß § 52 Abs. 2 GKG auf 5.000,00 Euro festgesetzt.