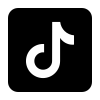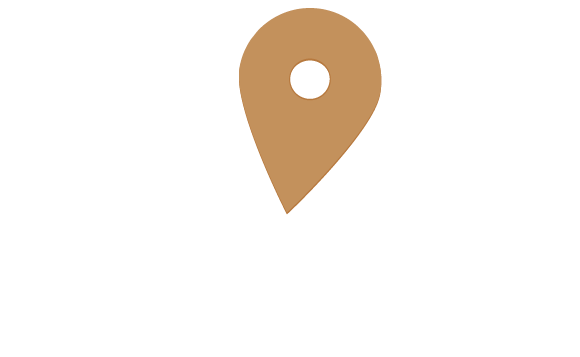Aktenzeichen M 21 K 13.30391
Leitsatz
Soweit das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass die vom Gutachter gezogenen Schlussfolgerungen auf unglaubhaften Angaben über die traumaauslösenden Ereignisse beruhen, stellt eine diagnostizierte PTBS keine äußerst gravierende Erkrankung dar, die eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib oder Leben iSd § 60 Abs. 7 S. 2 AufenthG ist. (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Gründe
Über die Klage ist in der Hauptsache aufgrund der Beschränkung nur noch hinsichtlich der Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Bescheids und der Verpflichtung zur Feststellung von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu entscheiden. Die insoweit zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Bundesamts vom 19. April 2013 ist zum maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts (§ 77 Abs. 1 Halbs. 2 AsylG) in den angefochtenen Ziffern rechtmäßig, der Kläger hat keinen Anspruch auf die begehrte Feststellung von Abschiebungsverboten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 VwGO).
Die geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Klägers begründen kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG.
Im Hinblick auf § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK reicht der Umstand, dass im Fall einer Aufenthaltsbeendigung die Lage des Betroffenen einschließlich seiner Lebenserwartung erheblich beeinträchtigt würde, allein nicht aus, einen Verstoß gegen Art. 3 EMRK anzunehmen. Anderes kann nur in besonderen Ausnahmefällen gelten, in denen humanitäre Gründe zwingend gegen die Aufenthaltsbeendigung sprechen (BVerwG, U.v. 31.1.2013 – 10 C 15/12 – juris Rn. 23 ff.). Derartige Ausnahmegründe liegen jedenfalls nach dem Ende der Ebola-Epidemie in Sierra Leone Anfang 2016 nicht mehr vor.
Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von einer Abschiebung abgesehen werden, wenn im Zielstaat für den Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden (§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG). Es ist nicht erforderlich, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist (§ 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG). Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist (§ 60 Abs. 7 Satz 4 AufenthG). Entsprechend der Gesetzesbegründung zu der mit dem Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 (BGBl. 2016 I S. 390 ff.) eingeführten Präzisierung in den Sätzen 2 bis 4 wird klargestellt, dass nur äußerst gravierende Erkrankungen eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib oder Leben nach Satz 1 darstellen. Eine solche schwerwiegende Erkrankung könne zum Beispiel in Fällen von PTBS regelmäßig nicht angenommen werden, es sei denn, die Abschiebung führe zu einer wesentlichen Gesundheitsgefährdung bis hin zu einer Selbstgefährdung (BT-Drs. 18/7538 S. 18).
Angesichts der Unschärfen des Krankheitsbildes einer PTBS sowie seiner vielfältigen Symptome bedarf es bereits zur Substantiierung eines Beweisantrags und erst recht für den Nachweis einer posttraumatischen PTBS regelmäßig der Vorlage eines gewissen Mindestanforderungen genügenden fachärztlichen Attests. Aus diesem muss sich nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt hat und wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. Dazu gehören etwa Angaben darüber, seit wann und wie häufig sich der Patient in ärztlicher Behandlung befunden hat und ob die von ihm geschilderten Beschwerden durch die erhobenen Befunde bestätigt werden. Des Weiteren sollte das Attest Aufschluss über die Schwere der Krankheit, deren Behandlungsbedürftigkeit sowie den bisherigen Behandlungsverlauf (Medikation und Therapie) geben. Wird das Vorliegen einer PTBS auf traumatisierende Erlebnisse im Heimatland gestützt und werden die Symptome erst längere Zeit nach der Ausreise aus dem Heimatland vorgetragen, so ist in der Regel auch eine Begründung dafür erforderlich, warum die Erkrankung nicht früher geltend gemacht worden ist (BVerwG, U.v. 11.9.2007 – 10 C 8/07 und 10 C 17.07 – juris jeweils Rn. 15).
Zudem müssen die Anknüpfungstatsachen einer entsprechenden qualifizierten Bescheinigung glaubhaft gemacht worden sein. Bei der Diagnoseerstellung von posttraumatischen Störungen ermöglicht die Symptomatologie des psychopathologischen Befunds generell keine Rekonstruktion der objektiven Seite der traumatisierenden Ereignisse. Dass das behauptete traumatisierende Ereignis tatsächlich stattgefunden hat, muss vielmehr vom Schutzsuchenden gegenüber dem Tatrichter und nicht gegenüber einem ärztlichen Gutachter nachgewiesen bzw. wahrscheinlich gemacht werden (BayVGH, B.v. 4.11.2016 – 9 ZB 16.30468 – juris Rn. 18; B.v. 17.10.2012 – 9 ZB 10.30390 – juris Rn. 8). Insoweit obliegt es dem Kläger, die behaupteten Geschehnisse, die bei ihm eine PTBS zum Entstehen gebracht haben sollen, jedenfalls in Grundzügen unter Angabe von Einzelheiten schlüssig und widerspruchsfrei zu schildern (vgl. BayVGH, B.v. 4.11.2016 a.a.O. – juris Rn. 23; B.v. 17.10.2012 a.a.O. – juris Rn. 8). Werden im Laufe des Verfahrens unterschiedliche Angaben gemacht, die auch unter Berücksichtigung von Erinnerungsproblemen traumatisierter Personen nicht nachvollziehbar sind, enthält das Vorbringen nicht auflösbare Widersprüche, erscheinen die Darstellungen nach der Lebenserfahrung oder aufgrund der Kenntnis entsprechender vergleichbarer Geschehensabläufe nicht nachvollziehbar oder wird das Vorbringen im Laufe des Verfahrens ohne ausreichende Begründung erweitert oder gesteigert, insbesondere wenn Tatsachen, die für das geltend gemachte Abschiebungsverbot ohne vernünftige Erklärung erst sehr spät in das Verfahren eingeführt werden, so kann den Aussagen in der Regel kein Glauben geschenkt werden.
Entsprechend diesem Maßstab liegen die Voraussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG aus gesundheitlichen Gründen nicht vor.
Zwar entspricht das eingeholte Gutachten weitgehend den Anforderungen an eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung einer PTBS. Die vom Gutachter gezogenen Schlussfolgerungen beruhen allerdings auf unglaubhaften Angaben des Klägers und sind daher mangels ausreichender Anknüpfungstatsachen nicht tragfähig. Vor diesem Hintergrund ist das Gutachten nicht geeignet, den Nachweis einer PTBS zu erbringen.
Der Gutachter ist in Übereinstimmung mit den einschlägigen Kriterien für eine PTBS vom Erfordernis eines traumatisierenden Ereignisses mit entsprechender Schwere ausgegangen (vgl. die vom Gutachter zugrunde gelegten Kriterien nach Maßgabe der DSM-V der American Psychiatric Association, ebenso die Kriterien nach Maßgabe der internationalen Klassifikation ICD-10: F 43.1).
Als entsprechendes traumatisierendes Ereignis hat der Gutachter die Entdeckung der ermordeten Eltern und Geschwister durch den Kläger zu Grunde gelegt. Zudem werden eine zweiwöchige Gefangennahme des Klägers in der Folge sowie der Tod der Frau des Klägers bei der Geburt der Tochter herangezogen (Gutachten, S.29/30 und S. 39).
Das Gericht hält demgegenüber die Angaben des Klägers zu zentralen Punkten der behaupteten traumaauslösenden Ereignisse, insbesondere zur Entdeckung seiner ermordeten Eltern und Geschwister sowie zu einer Gefangennahme für unglaubhaft und den Kläger im Übrigen insgesamt für unglaubwürdig. Damit fehlt es an einer ausreichenden Grundlage für die Schlussfolgerungen des Gutachters hinsichtlich einer PTBS.
Das Gericht nimmt dem Kläger bereits nicht ab, dass er im Zeitpunkt der Ermordung seiner Familie – nach Angaben des Klägers am 6. Januar 1999 – in Bo war. Die betreffenden Aussagen stehen in unauflösbarem Widerspruch zu den Aussagen im Zusammenhang mit dem schulischen Werdegang vor dem Bundesamt. Der Kläger hat die Richtigkeit seiner Angaben vor dem Bundesamt – auch die Angaben zum persönlichen Lebenshintergrund wie Schulbildung, Wohnort, Eltern/Verwandte – auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung nochmals ausdrücklich bestätigt.
Laut seiner Aussage beim Bundesamt ging der Kläger sieben Jahre in die Grundschule in BO und besuchte anschließend für vier Jahre das Gymnasium in Freetown. Er sei in dieser Zeit manchmal auch in Bo gewesen, z.B. in den Ferien, aber ansonsten in Freetown zur Schule gegangen. Nach den vier Jahren Gymnasium sei er dann wieder nach Bo zurückgegangen. In zeitlicher Hinsicht hat der Kläger die entsprechende Aussage in der mündlichen Verhandlung konkretisiert und mitgeteilt, er habe die Grundschule von 1991 bis 1998 besucht und im Anschluss drei Jahre die Secondary/High School. Beim Gutachter gab der Kläger dagegen an, er habe die Grundschule für sechs Jahre und anschließend die Secondary School bis zum dritten Jahr besucht. Unabhängig davon, welchen der Angaben des Klägers in zeitlicher Hinsicht Glauben geschenkt werden kann, befand er sich im Jahr 1999 auf der Secondary School in Freetown. Die Aussage des Klägers, er habe am Tag der Ermordung seiner Eltern nach der Schule einen Klassenkameraden besucht, sich zwischen 17 Uhr und 18 Uhr auf den Heimweg gemacht, um pünktlich zum Abendessen erscheinen zu können und dann seine ermordete Familie entdeckt, steht hierzu in nicht auflösbarem Widerspruch.
Die Angaben zum Ablauf der Schulausbildung hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung durch eine weitere Version ergänzt, die nicht geeignet ist, die aufgetretenen Widersprüche zu erklären. Die Glaubhaftigkeit dieser geänderten Darstellung ist bereits dadurch gemindert, dass sie erst in der mündlichen Verhandlung und auf entsprechende Nachfrage erfolgt ist. Zudem ist auch diese Darstellung durch Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten gekennzeichnet. Danach will der Kläger die Secondary School zunächst für ein Jahr in BO und dann für zwei weitere Jahre bei seinem Onkel in Freetown besucht haben. Er habe dann die Schule abbrechen müssen, weil das Geld seines Onkels nicht mehr gereicht habe. Diese Aussage steht in Widerspruch zu der Behauptung des Klägers vor dem Gutachter, er sei nach der Ermordung seiner Eltern bei seinem Onkel (dem nach seinen Angaben zusammen mit seiner Tochter einzigen ihm bekannten Verwandten in Sierra Leone) in einer kleinen Stadt außerhalb von BO untergekommen, habe dort in bescheidenen Verhältnissen leben und auf einen Schulbesuch verzichten müssen. Die Einlassung des Klägers auf den entsprechenden Vorhalt in der mündlichen Verhandlung, er könne sich im Hinblick auf die vergangene Zeit nicht mehr so genau erinnern, sowie der Hinweis auf seine gesundheitlichen Probleme, aufgrund der er Erinnerungsprobleme habe, stellt eine Schutzbehauptung dar. Unabhängig davon, dass auch die Umstände im Zusammenhang mit einer PTBS zumindest in den Grundzügen widerspruchsfrei und schlüssig darzustellen sind, hat der Gutachter ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beim Kläger zum Untersuchungszeitpunkt keine Unfähigkeit vorliege, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern (Gutachten, S. 30).
Auch im Übrigen sind die Angaben des Klägers zur Entdeckung der Ermordung seiner Familie durch Steigerungen, Widersprüchlichkeiten und Unsicherheit des Klägers gekennzeichnet, die bei einer Schilderung von selbst erlebten Geschehnissen so nicht aufgetreten wären.
Vor dem Bundesamt waren die Angaben des Klägers zur Ermordung der Eltern trotz ausdrücklicher Nachfrage zu den Hintergründen seiner psychiatrischen Behandlung noch extrem vage. Er teilte hierzu zunächst mit, er sei dabei gewesen als seine Familie getötet worden sei, berichtigte sich daraufhin dahin, er sei nicht dabei gewesen, als das passiert sei, er sei bei einem Freund gewesen. Hinsichtlich der zeitlichen Einordnung beließ es der Kläger bei der Angabe, seine Eltern seien während des Bürgerkriegs im Januar 1999 verstorben. Von der persönlichen Entdeckung der ermordeten Familie berichtete er nicht.
Auch in den Angaben des Klägers im Rahmen der biographischen Anamnese im Entlassbericht des KBO Isar-Amper-Klinikum vom 6. August 2012 wird die Ermordung von Familienangehörigen lediglich auf das Jahr 1999 eingegrenzt, zudem ist dort lediglich von der Ermordung des Vaters des Klägers die Rede. Eine Entdeckung der ermordeten Familienangehörigen durch den Kläger persönlich ist auch dort nicht erwähnt.
Erstmals bei der Untersuchung vor dem Gutachter hat der Kläger dann behauptet, die Ermordung seiner Familie selbst entdeckt zu haben. Als maßgebliches Datum ist in dem Gutachten an zwei Stellen der 6. Januar 1996 vermerkt. Unabhängig davon, ob der Kläger dieses erkennbar falsche Datum gegenüber dem Gutachter tatsächlich angegeben hat oder hier ein Schreibfehler oder ein Missverständnis ursächlich war, erweckt die durch Unsicherheit gekennzeichnete Reaktion des Klägers in der mündlichen Verhandlung auf die entsprechende Nachfragen und Vorhalte zu den zeitlichen Angaben den Eindruck, dass der Kläger nicht über selbst Erlebtes berichten konnte. Er unternahm nicht den Versuch, die zeitlichen Angaben plausibel zu machen, sondern relativierte diese dahin, er glaube lediglich, das genaue Datum des Angriffs sei der 6. Januar 1999 gewesen – genau erinnern könne er sich nicht mehr – und berief sich auch bei diesem Punkt auf Erinnerungsprobleme.
Die Schilderung des Klägers zur Entdeckung der Ermordung seiner Familie ist im Übrigen realitätsfremd und lässt darauf schließen, dass der Kläger dem Gutachter sowie dem Gericht auf der Grundlage tatsächlicher Geschehnisse im Bürgerkrieg in Sierra Leone (vgl. zu den Angriffen im Januar 1999 z.B. truth and reconciliation Commission of Sierra Leone – final report, Volume 3a, chapter 3, S. 150 ff.) eine in weiten Teilen frei erfundene Geschichte präsentiert hat. Dem Kläger kann nicht abgenommen werden, er sei am 6. Januar 1999, einem Tag, an dem in Sierra Leone ein groß angelegter Angriff von Rebellen mit Massakern an der Bevölkerung stattfand, regulär zur Schule und dann zu einem Freund gegangen und habe erst auf dem Nachhauseweg festgestellt, dass seine Familie sowie eine Vielzahl von Personen in der Umgebung Opfer von Massakern geworden seien. Das wird durch die Schilderung des Klägers in der mündlichen Verhandlung zur Situation im zeitlichen Umfeld eher noch bestätigt. Danach habe man die Schule manchmal nicht besuchen können, wenn die Lage unsicher gewesen sei. Gegenüber dem Gutachter gab der Kläger zudem an, sein Vater habe ihn und seine Brüder im Vorfeld mehrmals ermahnt, vorsichtig zu sein. Es habe in den Monaten vor der Ermordung seiner Eltern eine immer stärker werdende Bedrohungslage gegeben. Sein Vater habe von den Kindern verlangt, gemeinsam und unverzüglich nach der Schule nach Hause zu gehen.
Dem Kläger kann auch nicht sein Vortrag zu einer zweiwöchigen Gefangennahme mit Misshandlungen abgenommen werden. Der entsprechende Vortrag vor dem Gutachter ist völlig unsubstantiiert und findet in der Anhörung des Klägers vor dem Bundesamt nicht einmal ansatzweise eine Entsprechung. Der Kläger hat hierzu auch in der mündlichen Verhandlung nichts vorgetragen. Die entsprechenden Angaben gegenüber dem Gutachter stehen zudem in Widerspruch zu den Ausführungen des Klägers gegenüber dem Gutachter, er habe nach dem Angriff auf seine Familie die ersten Tage bei der Familie seines Freundes übernachtet und sei dann von seinem Onkel gefunden und aufgenommen worden.
Auch der Vortrag des Klägers zu weiteren Geschehnissen in seinem Heimatland lässt darauf schließen, dass er – soweit ihm dies im Zusammenhang mit Abschiebungsverboten und der geltend gemachten PTBS günstig erscheint – die Unwahrheit sagt bzw. Begebenheiten verfälscht darstellt. So machte der Kläger bereits vor dem Bundesamt widersprüchliche Angaben über den Verbleib bzw. seine Kenntnis über den Verbleib seiner Tochter. Gegenüber dem Gutachter trug er dann vor, er habe den Beginn der Ebola-Epidemie im Oktober 2014 voller Sorge verfolgt und über seine Facebook-Kontakte erfahren, dass sein Onkel an Ebola verstorben und seine Tochter mit einer Ebola-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Weitere Informationen habe er nicht erhalten, im Moment habe er seinen Facebook-Account nicht mehr besucht, aus lauter Angst vor schlechteren Nachrichten. Der Tod seines Onkels lasse ihn sehr verzweifeln. Die Ungewissheit über den Verbleib seiner Tochter raube ihm den Verstand. In der mündlichen Verhandlung auf den Verbleib der Tochter angesprochen behauptete der Kläger, hierüber immer noch nichts zu wissen, reagierte auf den Vorhalt der von ihm gegenüber dem Gutachter selbst angegebenen Möglichkeit einer Erkundigung über Facebook-Kontakte zunächst mit Unwissen und ließ sich dann auf die – von der Version gegenüber dem Gutachter abweichende und im Hinblick auf den geschilderten Leidensdruck wegen der Unsicherheit über den Verbleib der Tochter – völlig unglaubhafte Aussage ein, er habe von Erkundigungen abgesehen, da er den Kontakt zu seinen damaligen Freunden bei Facebook nicht mehr habe.
Lediglich ergänzend wird darauf hingewiesen, dass (1) auch wenn man dem Vorbringen des Klägers zu den traumaauslösenden Ereignissen in den Grundzügen Glauben schenken würde und von der im Gutachten diagnostizierten PTBS ausgehen würde, ein Abschiebungsverbot unter Zugrundelegung des Maßstabs von § 60 Abs. 7 Sätze 2 bis 4 AufenthG nicht vorläge und im Übrigen (2) das Gutachten im Zusammenhang mit dem Kriterium der zeitlichen Latenz zwischen Trauma und Auftreten von Symptomen nicht die Anforderungen für den Nachweis einer PTBS erfüllt und jedenfalls ohne Ergänzung durch den Gutachter für den Nachweis einer PTBS nicht zu Grunde gelegt werden könnte.
(1) Im Hinblick auf die Regelungen in § 60 Abs. 7 Sätze 2 bis 4 AufenthG läge selbst dann kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG vor, wenn man dem Vorbringen des Klägers zu den traumaauslösenden Ereignissen und den geschilderten Beschwerden in den Grundzügen Glauben schenken und von den gestellten Diagnosen des Gutachtens ausgehen würde. Eine PTBS stellt im Hinblick auf die Regelungen in § 60 Abs. 7 Sätze 2 bis 4 AufenthG für sich gesehen keine lebensbedrohliche oder ähnlich schwerwiegende Erkrankung dar, die ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG begründet. Eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung liegt laut Gutachten nicht vor. Damit ist auch im Falle einer Rückkehr nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Die entsprechenden Aussagen im Gutachten differenzieren insofern nicht ausreichend zwischen inlandsbezogenen und den hier maßgeblichen zielstaatsbezogenen Umständen und beruhen im Übrigen im Hinblick auf die Situation in Sierra Leone auf unzureichenden Anknüpfungstatsachen. Eine ärztlichen Bescheinigung, der nicht zu entnehmen ist, wie sie zur prognostischen Diagnose kommt und welche Tatsachen dieser zugrunde liegen, ist nicht geeignet, das Vorliegen eines Abschiebungsverbots zu begründen (vgl. zu Abschiebungsverboten wegen Reiseunfähigkeit BayVGH, B.v. 23.8.2016 – 10 CE 15.2784 – juris Rn. 16; OVG Sachsen-Anhalt, B.v. 8.2.2012 – 2 M 29/12 – juris Rn. 11 ff.). Entsprechendes gilt, wenn die zu Grunde gelegten Tatsachen in wesentlichen Bereichen unzutreffend sind. Insofern obliegt auch in diesem Zusammenhang die Feststellung der für die ärztliche Bewertung zugrunde gelegten Anknüpfungstatsachen ausschließlich dem Tatrichter. Eine nach dem Gutachten erforderliche Fortsetzung der medikamentösen Behandlung mit Antidepressiva ist auch in Sierra Leone gewährleistet.
Anhaltspunkte für existenzielle Krisen bis hin zur Suizidalität bestehen nach der Entlassung des Klägers aus dem KBO Isar-Amper-Klinikum im Jahr 2012 – mit Ausnahme der aufgetretenen Krisen Ende 2014 im Zusammenhang mit der zwischenzeitlich beendeten Ebola-Epidemie in Sierra Leone und der Trauer bzw. Sorge um Angehörige – nicht. Der Zustand des Klägers war nach dem Gutachten im Untersuchungszeitpunkt nicht akut lebensbedrohlich, obwohl der Kläger weiterhin nur medikamentös ausreichend behandelt wird, sozialpsychiatrisch unzureichend versorgt ist und eine Traumatherapie weder im Untersuchungszeitpunkt noch bis zur mündlichen Verhandlung aufgenommen hat. Der Kläger sei von akuter Suizidalität distanziert, auch eine Fremdgefährdung bestehe nicht (vgl. Gutachten, S. 24). Anhaltspunkte für eine zwischenzeitliche Verschlechterung ergeben sich – auch unter Berücksichtigung des aktuellen Attests des behandelnden Arztes vom 19. Dezember 2016 – nicht.
Die Aussagen im Gutachten lassen auch nicht darauf schließen, dass im Falle einer Abschiebung zielstaatsbezogene Umstände zu einer wesentlichen Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands des Klägers mit lebensbedrohlichen oder ähnlich schwerwiegenden, d.h. existenziell bedrohlichen Krankheitsfolgen führen würden. Der Gutachter führt hierzu aus, eine Rückkehr in das vorherige Umfeld der erlebten Bedrohung sei für alle Menschen eine extreme Belastung. Insofern würde eine Rückkehr ins Umfeld, in dem der Kläger aufgewachsen sei, zu einer erheblichen Verschlechterung führen. Die ständige Angst vor der Abschiebung nach Sierra Leone, das für den Kläger eine ständige Ausnahmesituation und einen hohen Stressfaktor berge, bedeute einen dramatischen Leidensdruck. Im Falle einer Abschiebung würde mit Sicherheit ein dauerhafter Schaden für die psychische Gesundheit des Klägers entstehen und wahrscheinlich wäre zudem sein Leben durch mögliche Suizidversuche bedroht. Aus ärztlicher Sicht solle daher die Rückkehr nach Sierra Leone vermieden werden. Diese Aussagen zielen im Schwerpunkt auf – hier nicht maßgebliche – inlandsbezogene Abschiebungshindernisse im Zusammenhang mit der Furcht und Unsicherheit im Vorfeld einer Abschiebung bzw. Umständen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Abschiebung (Reisefähigkeit) ab, denen im Übrigen durch entsprechende Vorbereitung und Ausgestaltung der Abschiebung begegnet werden kann. Hinsichtlich der zielstaatsbezogenen Umstände verbleibt es bei dem allgemeinen Hinweis auf die Belastung traumatisierter Personen durch eine Rückkehr in das Umfeld der Traumatisierung. Insofern ist aber neben dem langen Zeitablauf seit den geltend gemachten traumaauslösenden Ereignissen zu berücksichtigen, dass sich die Situation in Sierra Leone zwischenzeitlich grundlegend verändert hat, ein Großteil der Flüchtlinge des Bürgerkriegs in ihr Heimatland zurückgekehrt sind und auch die Bekämpfung der Straflosigkeit für während des Bürgerkriegs begangene schwere Menschenrechtsverstöße Fortschritte macht. Insoweit wird zunächst auf die ausführlichen Darstellungen zur allgemeinen Lage in Sierra Leone in der Begründung des angefochtenen Bescheids Bezug genommen (§ 77 Abs. 2 AsylG) und ergänzend auf Folgendes hingewiesen: Nach Beendigung des elfjährigen Bürgerkrieges im Jahre 2002 kehrt Sierra Leone immer mehr zu friedlichen und geordneten politischen Verhältnissen zurück. Die während des Bürgerkriegs begangenen Verbrechen werden umfassend ermittelt und aufgearbeitet (vgl. Truth & Reconciliation Commission of Sierra Leone, final report, Vol 3a, Chapter 3, The Military an Political History of the Conflict). Auf Grundlage einer Vereinbarung mit den Vereinten Nationen wurde ein Sondergerichtshof für Sierra Leone eingerichtet, (Special Court for Sierra Leone – SCSL), der für eine juristische Aufarbeitung sorgt, vor dem bereits eine Vielzahl von Prozessen stattgefunden hat und durch den u.a. der ehemalige liberianische Staatspräsident Charles Taylor wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt wurde (vgl. AI – Amnesty Report 2013 Sierra Leone; U.S. Department of State – Sierra Leone Country Report on Human Rights Practices 2006; Wikipedia – https: …de.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone und https: …en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(Liberian_politician) – zitiert jeweils nach Stand 19.1.2017).
Ein von der UNHCR initiiertes Repatriierungsprogramm für Bürgerkriegsflüchtlinge wurde im Juli 2004 abgeschlossen und ein Großteil der Flüchtlinge ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Am 23. Juni 2006 wurde Sierra Leone als eines der ersten Länder vom UN-Sicherheitsrat auf die Agenda der 2005 ins Leben gerufenen Peacebuilding Commission (PBC) gesetzt. Nach Aussage des früheren UN-Generalsekretärs Ban Ki-Moon am 14. Juni 2010 in Freetown repräsentiert Sierra Leone einen der erfolgreichsten Fälle für Wiederaufbau, Friedenswahrung und Friedensaufbau nach einem Konflikt (Wikipedia – https: …de.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone – zitiert nach Stand 19.1.2017).
Ob eine Rückkehr traumatisierter Personen aus Krisenregionen trotz Aufarbeitung straffrei begangener Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen im Herkunftsland mit einer nicht hinnehmbaren Gefahr einer Retraumatisierung verbunden ist, hängt von den – einer ärztlichen Bescheinigung zu Grunde zu legenden – Einzelumständen, einerseits Art und Umfang einer erfolgten Aufarbeitung der Krise im Herkunftsstaat und andererseits von Art, Dauer und Intensität des erlittenen Traumas ab. Das Gutachten geht hierauf nicht ein. Die Bescheinigung des behandelnden Arztes vom 19. Dezember 2016 greift diesen Gesichtspunkt zwar ansatzweise auf, der hier gezogene Vergleich mit der Situation von Juden, die nach ihrer Befreiung aus Konzentrationslagern auch nach Ende des dritten Reichs und der Aufarbeitung der begangenen Verbrechen nicht mehr nach Deutschland einreisen konnten, liegt im Hinblick auf den maßgeblichen Vortrag des Klägers zu Art und Intensität der erlebten Traumen aber erkennbar neben der Sache.
Im Hinblick auf die Behandlungsmöglichkeiten in Sierra Leone geht das Gericht davon aus, dass eine ausreichende therapeutische und psychiatrische Behandlung dort nicht sichergestellt ist und damit eine ausreichende Behandlung einer PTBS nicht möglich ist. Hierauf kommt es aber im Hinblick auf die Regelungen in § 60 Abs. 7 Sätze 2 bis 4 AufenthG gerade nicht an. Maßgeblich ist vielmehr, dass eine ausreichende medikamentöse Versorgung mit Antidepressiva auch in Sierra Leone gewährleistet und damit eine lebensbedrohliche oder existenziell bedrohliche Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands des Klägers nach einer Rückkehr nicht wahrscheinlich ist. Entsprechend der Auskunftslage ist davon auszugehen, dass eine medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva auch in Sierra Leone erfolgen kann (vgl. Auskunft AA an VG Aachen vom 21.2.2007). Anhaltspunkte, dass sich hieran etwas geändert haben könnte, sind nicht substantiiert vorgetragen und – nach dem Ende der Ebola-Epidemie Anfang 2016 – jedenfalls im Hinblick auf große Städte wie Freetown nicht naheliegend. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Klägerseite vorgelegten Entscheidungen des Bundesamts vom 1. Dezember 2016 sowie den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten bzw. in Bezug genommenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen. Dabei handelt es sich nur teilweise um Entscheidungen zu Sierra Leone. Bei den entsprechenden Entscheidungen standen im Mittelpunkt die therapeutischen und psychiatrischen Behandlungsmöglichkeiten. Soweit dort auch Fragen zur medikamentösen Versorgungslage angesprochen sind, handelt es sich um Fragen der individuellen Verfügbarkeit. Insoweit besteht im Hinblick auf die langjährige Tätigkeit des Klägers als KFZ-Mechaniker bis zu seiner Ausreise aus Sierra Leone kein Anlass zur Annahme, er sei nach einer Rückkehr dauerhaft nicht in der Lage, einen ausreichenden Unterhalt, der auch eine medikamentöse Behandlung einschließt, zu erzielen. Eine Ergänzung des Gutachtens im Hinblick auf diese Punkte war auf Grund der fehlenden Entscheidungsrelevanz (mangelnde Glaubhaftigkeit der Schilderung des Klägers) nicht veranlasst.
(2) Hinsichtlich des Kriteriums der zeitlichen Latenz beruhen die Bewertungen des Gutachtens auf einer Verkennung der Anforderungen eines Vollbeweises für sämtliche Kriterien einer PTBS nach Maßgabe der allgemeinen Beweisregeln. Demnach ist für sämtliche Kriterien ein Nachweis mit der erforderlichen an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit nötig. Zweifel gehen entsprechend den allgemeinen Beweislastregeln zu Lasten des Asylbewerbers. Der Gutachter weist im Zusammenhang mit Kapitel V, Gliederung 43.1 ICD 10, wonach die Latenz nach einem Trauma bei der PTBS grundsätzlich nur wenige Wochen bis Monate dauert, darauf hin, die Verlaufsdynamik der PTBS sei aufgrund der komplexen Psychopathologie sehr variabel. Die von ihm gemachten statistischen Angaben – Symptome bei 42% der Betroffenen 9 Monate nach dem Trauma, bei 15 bis 25% persistierend über Jahre und bei einem Drittel der Patienten chronischer Verlauf mit einer mittleren Revisionszeit von 3 Jahren – lassen die Diagnose PTBS beim Kläger zwar als möglich, nicht jedoch als wahrscheinlich oder nahezu sicher erscheinen. Der Gutachter hat keine Feststellungen getroffen, die eine Zuordnung der Symptome des Klägers zu einer chronisch oder sonst atypisch verlaufenden PTBS trotz der erheblichen zeitlichen Latenz mit an Sicherheit grenzender oder zumindest überwiegender Wahrscheinlichkeit ermöglichen würde. Insbesondere fehlt es an einer Würdigung und Gewichtung von Symptomen vor der Ausreise des Klägers aus Sierra Leone – dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Schwere der Symptome dort offenbar weit hinter der in Deutschland beobachteten Schwere mit krisenhaften Einbrüchen bis hin zu akuter Suizidalität zurückblieb. Der Kläger führte in Sierra Leone nach seinen Angaben trotz erheblicher Belastungen durch den Tod seiner Familie ein weitgehend normales Leben, ging einer selbständigen Tätigkeit im Rahmen einer – zusammen mit Freunden betriebenen – KFZ-Werkstatt nach und war auch in der Lage, familiäre Bindungen einzugehen. Er war auch nach dem Tod seiner Frau bei der Geburt des Kindes in der Lage, einem geregelten Leben und einer Arbeitstätigkeit nachzugehen. Eine Ergänzung des Gutachtens im Hinblick auf diese Punkte war auf Grund der fehlenden Entscheidungsrelevanz (mangelnde Glaubhaftigkeit der Schilderung des Klägers) nicht veranlasst.
Abgesehen von der geltend gemachten PTBS liegen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor, die ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG begründen bzw. im Hinblick auf qualifizierte ärztliche Bescheinigungen Anlass für eine weitere Sachverhaltsermittlung bieten. Im Hinblick auf die von Klägerseite angeführte Anorexia nervosa (Magersucht) ergeben sich aus den vorgelegten ärztlichen Bescheinigungen keine Anhaltspunkte für eine lebensgefährliche oder vergleichbar schwerwiegende Erkrankung.
Schließlich folgt auch aus den schwierigen Lebensverhältnissen in Sierra Leone kein Abschiebungsverbot aus § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. Bei den dort vorherrschenden Lebensbedingungen handelt es sich um eine Situation, der die gesamte Bevölkerung ausgesetzt ist, weshalb Abschiebeschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG ausschließlich durch eine generelle Regelung nach § 60 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG gewährt wird. Anhaltspunkte für eine extreme Gefährdungslage bei der aufgrund der Schutzwirkungen der Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG ausnahmsweise nicht greift (vgl. BVerwG, U.v. 17.10.1995 – 9 C 9/95 – juris LS 3 und Rn. 14; BVerwG, U.v. 31.1.2013 – 10 C 15/12 – juris Rn. 38), sind nicht erkennbar.
Nachdem auch die nach Maßgabe von § 34 Abs. 1 AsylG i.V.m. § 59 AufenthG erlassene Abschiebungsandrohung nicht zu beanstanden ist, war die Klage abzuweisen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 155 Abs. 2 VwGO. Gerichtskosten werden nicht erhoben (§ 83 b AsylG).
Vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung: § 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO