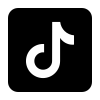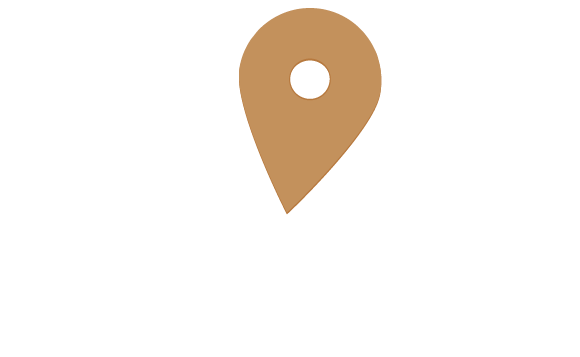Aktenzeichen Vf. 43-VIII-21; Vf. 44-VII-21
Leitsatz
Keine Außervollzugsetzung der Einführung des Islamischen Unterrichts (Art. 47 Abs. 1 und 3 BayEUG sowie § 27 BaySchO) durch das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 23. Juli 2021 und § 1 Nr. 2 der Verordnung zur Änderung der Bayerischen Schulordnung und weiterer Verordnungen vom 8. Juli 2021.
Tenor
Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung werden abgewiesen.
Gründe
I.
Die zur gemeinsamen Entscheidung verbundenen Verfahren betreffen die Frage, ob Art. 47 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2020 (GVBl S. 386) geändert worden war (im Folgenden: BayEUG a. F.), in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (im Folgenden: Änderungsgesetz) vom 23. Juli 2021 (GVBl S. 432) (im Folgenden: BayEUG n. F.) sowie § 27 der Schulordnung für schulartübergreifende Regelungen an Schulen in Bayern (Bayerische Schulordnung – BaySchO) vom 1. Juli 2016 (GVBl S. 164, 241, BayRS 2230-1-1-1-K) in der Fassung des § 1 Nr. 2 der Verordnung zur Änderung der Bayerischen Schulordnung und weiterer Verordnungen (im Folgenden: Änderungsverordnung) vom 8. Juli 2021 (GVBl S. 479) (im Folgenden: BaySchO n. F.) gegen die Bayerische Verfassung verstoßen und daher gemäß Art. 26 VfGHG durch einstweilige Anordnung vorläufig außer Vollzug zu setzen sind.
1. Art. 47 Abs. 1 BayEUG n. F. eröffnet Schülerinnen und Schülern, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, anstelle der bisherigen Pflicht zur Teilnahme am Ethikunterricht nach Art. 47 Abs. 1 BayEUG a. F. ab dem Schuljahr 2021/2022 die Wahlmöglichkeit, entweder den Ethikunterricht oder den Islamischen Unterricht zu besuchen. Dieser vermittelt eine grundlegende Werteorientierung sowie Wissen über die Weltreligion Islam in interkultureller Sicht (Art. 47 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 BayEUG n. F.). Ergänzend regelt § 27 BaySchO n. F., dass vom Religionsunterricht abgemeldete Schülerinnen und Schüler am Ethikunterricht teilnehmen, es sei denn, sie sind zum Islamischen Unterricht angemeldet (Abs. 3 Satz 4); dieser kann nur eingerichtet werden, wo auch Ethikunterricht eingerichtet ist (Abs. 8 Satz 3), wobei die Mindestteilnehmerzahl für den Islamischen Unterricht durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus festgelegt wird (Abs. 8 Satz 2).
Art. 47 BayEUG a. F. lautete:
Art. 47 Ethikunterricht
(1) Ethikunterricht ist für diejenigen Schülerinnen und Schüler Pflichtfach, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen.
(2) 1Der Ethikunterricht dient der Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu werteinsichtigem Urteilen und Handeln. 2Sein Inhalt orientiert sich an den sittlichen Grundsätzen, wie sie in der Verfassung und im Grundgesetz niedergelegt sind. 3Im Übrigen berücksichtigt er die Pluralität der Bekenntnisse und Weltanschauungen.
Das Änderungsgesetz hat folgenden Wortlaut:
Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
§ 1
Art. 47 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 386) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„Art. 47
Ethikunterricht, Islamischer Unterricht
(1) Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sind verpflichtet, am Ethikunterricht oder am Islamischen Unterricht teilzunehmen.
(2) 1Der Ethikunterricht dient der Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu werteinsichtigem Urteilen und Handeln. 2Sein Inhalt orientiert sich an den sittlichen Grundsätzen, wie sie in der Verfassung und im Grundgesetz niedergelegt sind. 3Im Übrigen berücksichtigt er die Pluralität der Bekenntnisse und Weltanschauungen. (3) 1Abs. 2 gilt entsprechend für den Islamischen Unterricht. 2Dieser vermittelt zugleich Wissen über die Weltreligion Islam und behandelt sie in interkultureller Sicht.“
§ 2
Dieses Gesetz tritt am 1. August 2021 in Kraft.
§ 27 BaySchO n. F. hat auszugsweise folgenden Wortlaut (Ergänzungen durch § 1 Nr. 2 der Änderungsverordnung durch Unterstreichung hervorgehoben):
§ 27 Religiöse Erziehung, Religions- und Ethikunterricht, Islamischer Unterricht …
(2) … 2Für den Religionsunterricht ist eine Mindestteilnehmerzahl von fünf Schülerinnen und Schülern erforderlich.
(3) … 4Vom Religionsunterricht abgemeldete Schülerinnen und Schüler nehmen am Ethikunterricht teil, es sei denn, sie sind zum Islamischen Unterricht angemeldet. …
(7) Für den Ethikunterricht gilt Abs. 2 Satz 2, … entsprechend.
(8) 1Für die Anmeldung zum Fach Islamischer Unterricht gelten die Abs. 3 und 5 entsprechend. 2Die Mindestteilnehmerzahlen hierfür legt das Staatsministerium fest. 3Islamischer Unterricht kann nur eingerichtet werden, wo auch Ethikunterricht eingerichtet ist.
(9) Die Abs. 2 bis 5, 7 und 8 gelten an Berufsfachschulen für Kinderpflege für das Fach Religionslehre und Religionspädagogik und, soweit es sich um öffentliche Schulen handelt, darüber hinaus für die Fächer Ethik und ethische Erziehung sowie Islamischer Unterricht und Religionspädagogik entsprechend.
2. Seit 1987 war im Rahmen des Muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts für muslimische türkische Schülerinnen und Schüler ein konfessionell ausgerichteter Unterricht über den Islam angeboten worden („Religiöse Unterweisung türkischer Schüler muslimischen Glaubens in türkischer Sprache – ISUT“), der seit 2001 auch auf Deutsch abgehalten wurde („Islamische Unterweisung in deutscher Sprache – ISUD“). Daneben gab es seit 2003 den – ebenfalls konfessionell konzipierten – „Islamunterricht nach dem Erlanger Modell“. Von 2009 bis 2019 wurde im Rahmen eines Modellversuchs ein neu konzipierter „Islamischer Unterricht“ erprobt (vgl. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 15.1.2010, KWMBl S. 38), der an die Stelle der anderen Angebote trat. Nach einer Übergangszeit von zwei Schuljahren, um die der Modellversuch anschließend verlängert wurde, wird er ab dem Schuljahr 2021/2022 nunmehr in veränderter Form in ein reguläres Unterrichtsfach (Wahlpflichtfach) übergeleitet (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 1).
3. Das Änderungsgesetz beruht auf einem Entwurf der Staatsregierung vom 13. April 2021 (LT-Drs. 18/15059), in dem der Zeitpunkt des Inkrafttretens noch offengelassen war („§ 2: Dieses Gesetz tritt am 1 2021 in Kraft.“).
Der Gesetzentwurf wurde vom Landtag in erster Lesung am 20. April 2021 an den Ausschuss für Bildung und Kultus als federführenden Ausschuss überwiesen. Am 6. Mai 2021 stimmte dieser mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP gegen die Stimmen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD dem Gesetzentwurf zu, ebenso wie der mitberatende Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen am 9. Juni 2021 und der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration am 10. Juni 2021, dieser mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des Inkrafttretens zwischen den Wörtern „tritt am 1.“ und „2021“ das Wort „August“ eingefügt werden solle (LT-Drs. 18/16560).
Der Landtag beriet den Gesetzentwurf am 24. Juni 2021 in zweiter Lesung und stimmte ihm in der vom Verfassungsausschuss empfohlenen Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD bei Enthaltung eines fraktionslosen Abgeordneten zu (LT-Drs. 18/16807).
In der auf Antrag der AfD-Fraktion durchgeführten dritten Lesung am 6. Juli 2021 wurde der Gesetzentwurf mit den Stimmen von Abgeordneten der Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP gegen die Stimmen von Abgeordneten der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD angenommen (LT-Drs. 18/17037). Dabei stimmten bei je einer Enthaltung durch einen fraktionslosen Abgeordneten in der jeweils auf Antrag der AfD-Fraktion erfolgten namentlichen Abstimmung über den Gesetzentwurf 75 Abgeordnete mit Ja und 23 mit Nein, in der namentlichen Schlussabstimmung 74 Abgeordnete mit Ja und 23 mit Nein.
Das vom Ministerpräsidenten am 23. Juli 2021 ausgefertigte Änderungsgesetz wurde am 30. Juli 2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt (S. 432) verkündet und trat gemäß seinem § 2 am 1. August 2021 in Kraft. Zeitgleich trat gemäß ihrem § 10 auch die Änderungsverordnung in Kraft.
II.
Die Antragsteller beantragen den Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß Art. 26 VfGHG mit dem Ziel, das Änderungsgesetz und § 1 Nr. 2 der Änderungsverordnung bis zu einer Entscheidung in den künftigen Hauptsacheverfahren (Meinungsverschiedenheit nach Art. 75 Abs. 3 BV im Verfahren Vf. 43-VIII-21 bzw. Popularklage nach Art. 98 Satz 4 BV im Verfahren Vf. 44-VII-21) vorläufig außer Vollzug zu setzen.
1. Entgegen der äußerst restriktiven Praxis des Verfassungsgerichtshofs sei vorliegend eine intensivere verfassungsrechtliche Prüfung im Eilverfahren geboten. Dieser begründe den strengen Maßstab bei Erlass einer einstweiligen Anordnung im Verfahren der Popularklage – für ein Verfahren der Meinungsverschiedenheit könne insoweit nichts anderes gelten -, mit der ein Parlamentsgesetz vorläufig außer Vollzug gesetzt werden solle, damit, dass eine vorläufige Regelung weitreichende Folgen habe und die dafür sprechenden Gründe daher so gewichtig sein müssten, dass ihr Erlass im Interesse der Allgemeinheit zur Abwehr schwerer Nachteile unabweisbar sei. Somit könne nur bei offensichtlichen Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren eine einstweilige Anordnung ergehen. Diese Judikatur sei aber weder vom Wortlaut des Art. 26 VfGHG gedeckt, noch stehe sie mit der Praxis des Bundesverfassungsgerichts und anderer Landesverfassungsgerichte im Einklang, die im Fall der Vorwegnahme der Hauptsache bereits erhebliche Gründe bzw. eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg in der Hauptsache ausreichen ließen. Da vorliegend u. a. Verstöße gegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 118 Abs. 1 BV), das Rechtsstaatsprinzip (Art. 3 Abs. 1 BV) und die Wesentlichkeitslehre als Ausdruck der Ewigkeitsklausel (Art. 75 Abs. 1 Satz 2 BV) sowie gegen die Religionsfreiheit (Art. 107 BV) und den Neutralitätsgrundsatz (Art. 142 Abs. 1 BV) als Teil der verfassungsmäßigen Grundordnung als auch das bereits formell verfassungswidrige Zustandekommen des Gesetzes gerügt würden, sei hier eine intensivere Prüfung der Erfolgsaussichten der (künftigen) Hauptsache geboten, um nicht vollendete Tatsachen eintreten zu lassen, die möglicherweise auf einer rechtswidrigen Grundlage beruhten.
2. Die künftigen Hauptsacheverfahren, die zeitnah nach einer Entscheidung im Eilverfahren eingereicht würden, seien offensichtlich zulässig.
a) Eine Meinungsverschiedenheit nach Art. 75 Abs. 3 BV sei zulässig. Die AfDFraktion sei nach Art. 49 Abs. 1 VfGHG antragsberechtigt. Der Antrag richte sich gegen die Staatsregierung, die das Änderungsgesetz eingebracht habe, sowie gegen den Landtag und die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP, die ihm mehrheitlich zugestimmt hätten. Die Meinungsverschiedenheit sei bereits im Gesetzgebungsverfahren erkennbar geworden. Am 6. Juli 2021 habe der Abgeordnete B. zumindest sinngemäß ausgeführt, dass er das Gesetz aus einer Vielzahl von Gründen für verfassungswidrig halte. Es sei nicht erforderlich, alle Rügen im Detail bereits im Gesetzgebungsverfahren geltend zu machen. Das lasse schon die knappe Redezeit der Abgeordneten nicht zu. Eine vollständige Identität zwischen den Rügen und der Meinungsverschiedenheit könne nicht verlangt werden, zumal nach der dritten Lesung eine verfassungsrechtliche Korrektur in den Ausschüssen ausgeschlossen sei. Deshalb könne hier nichts anderes gelten als bei der Volksgesetzgebung (VerfGH vom 17.9.1999 VerfGHE 52, 104). Analog zur Popularklage sei nur zu fordern, dass im Gesetzgebungsverfahren eine Rüge ausreichend vorgetragen werde, damit sämtliche Verfassungsverstöße von Amts wegen geprüft würden. Im Übrigen lasse sich das Erfordernis, dass die Meinungsverschiedenheit bereits im Gesetzgebungsverfahren erkennbar gewesen sein müsse, weder dem Wortlaut noch der Entstehungsgeschichte des Art. 75 Abs. 3 BV bzw. des Art. 49 VfGHG entnehmen, sei nicht mit dem Sinn und Zweck des Art. 75 Abs. 3 BV zu vereinbaren, effektive verfassungsgerichtliche Kontrolle zu gewährleisten, und führe zu Wertungswidersprüchen. So müsse ein Popularkläger nicht bereits im Gesetzgebungsverfahren Rügen erheben. Die abstrakte Normenkontrolle nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, deren Funktion Art. 75 Abs. 3 BV erfülle (VerfGH vom 19.10.1994 VerfGHE 47, 241), setze ebenfalls nicht voraus, dass die Abgeordneten schon im Gesetzgebungsverfahren die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes rügen müssten. Infolge des Rügeerfordernisses könne eine neu in den Landtag gewählte Fraktion auch keine in früheren Legislaturperioden beschlossenen Gesetze angreifen.
b) Eine Popularklage nach Art. 98 Satz 4 BV sei zulässig. Da das Änderungsgesetz bereits nicht formell verfassungsgemäß zustande gekommen sei und damit nicht zur verfassungsmäßigen Ordnung gehöre, sei jedenfalls eine Verletzung des Grundrechts der Handlungsfreiheit (Art. 101 BV) möglich; gleiches gelte im Hinblick auf andere Freiheitsrechte wie die Religionsfreiheit (Art. 107 BV), den Grundsatz der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates (Art. 107 i. V. m. Art. 118 Abs. 1, Art. 142 Abs. 1 BV), den Gleichheitsgrundsatz (Art. 118 Abs. 1 BV), das Recht der Religionsgemeinschaften und Schüler auf Religionsunterricht (Art. 136 Abs. 2 BV) und der Schüler auf Ethikunterricht (Art. 137 Abs. 2 BV). In keiner der drei Lesungen des Gesetzentwurfs sei die gemäß Art. 23 Abs. 2 BV erforderliche Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl der Abgeordneten anwesend gewesen. Mit der Einfügung des nach Art. 76 Abs. 2 BV erforderlichen Datums des Inkrafttretens des Änderungsgesetzes durch den Ausschuss für Bildung und Kultus sei gegen Art. 71 BV verstoßen worden, da diesem kein Initiativrecht zukomme. Die Einführung des Islamunterrichts sei auch mit neuen Aufgaben und Ausgaben für die Kommunen verbunden und verletze ohne Finanzausgleich das Konnexitätsprinzip (Art. 83 Abs. 3 und 6 BV). Zudem führe das Änderungsgesetz zu einer nach Art. 118 Abs. 1 BV nicht gerechtfertigten Privilegierung muslimischer Schüler und Eltern im Vergleich zu atheistischen, konfessionslosen oder andersgläubigen Schülern und Eltern, weil nur für den Islam ein eigenes Unterrichtsfach eingeführt werde.
3. Die künftigen Hauptsacheverfahren seien auch offensichtlich begründet. Das Änderungsgesetz sei formell verfassungswidrig (Verstoß gegen Art. 23 Abs. 2, Art. 71 i. V. m. Art. 76 Abs. 2 und Art. 83 Abs. 3 und 6 BV) und verletze Grundrechte und andere Verfassungsnormen (Art. 3 Abs. 1, Art. 107 Abs. 1, Art. 118 Abs. 1, Art. 126 Abs. 1, Art. 127, 135 Satz 2, Art. 136 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 bis 5, Art. 137 Abs. 1 und 2, Art. 142 Abs. 1 BV), die Ausdruck der Ewigkeitsklausel (Art. 75 Abs. 1 Satz 2 BV) seien. Selbst wenn man nicht von einer offensichtlichen Verfassungswidrigkeit ausgehen wollte, folge jedenfalls aus der hier gebotenen summarischen Prüfung, dass überwiegende Erfolgsaussichten in der Hauptsache bestünden, sodass der Erlass einer einstweiligen Anordnung gerechtfertigt sei.
a) Das Änderungsgesetz sei formell verfassungswidrig zustande gekommen.
aa) Es sei augenscheinlich und werde als gerichtsbekannt vorausgesetzt, dass bei keiner der drei Lesungen des Gesetzentwurfs die nach Art. 23 Abs. 2 BV erforderliche Mehrheit von mindestens 103 von 205 der gesetzlichen Mitgliederzahl der Abgeordneten anwesend gewesen sei. Bei der Schlussabstimmung am 6. Juli 2021 hätten nur 97 Abgeordnete abgestimmt, sodass nur deren Anwesenheit belegt sei. Die Parlamentsmehrheit meine zwar, dass der Corona-Notstand es rechtfertige, fortwährend gegen Art. 23 Abs. 2 BV zu verstoßen. Dieser verlange aber zur Beschlussfähigkeit des Landtags die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder, um ein hohes Maß an demokratischer Legitimation im Einzelfall zu gewährleisten. Gegen dieses von der Verfassung selbst, anders als im Bund nicht nur von der Geschäftsordnung ausdrücklich vorgesehene Gebot sei eklatant verstoßen worden. Der Verstoß sei evident und wiege extrem schwer, weil die inhaltliche Abweichung von Art. 23 Abs. 2 BV eine Verfassungsänderung darstelle, die nicht vorher durch Volksentscheid gebilligt worden sei. Es existiere auch kein Verfassungstext, der speziell für diese (angebliche oder tatsächliche) Notlage ein Abweichen von Art. 23 Abs. 2 BV ausdrücklich gestattet hätte. Die Geschäftsordnung könne die Verfassung nicht außer Kraft setzen. Die Vermutungsregelung des § 123 Abs. 1 BayLTGeschO, die ein einvernehmliches Unterlaufen der verfassungsrechtlichen Vorgaben erlaube, stehe erkennbar im Widerspruch zu Art. 23 Abs. 2 BV und sei deshalb verfassungswidrig. Art. 23 Abs. 2 BV sehe nicht vor, dass die Beschlussfähigkeit von einer Rüge im Gesetzgebungsverfahren abhänge oder abhängig gemacht werden dürfe. Damit werde zudem Art. 75 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 BV umgangen. Dieser eklatante Verfassungsverstoß sei unheilbar, da es sich bei Art. 23 Abs. 2 BV nicht um eine bloße Ordnungsvorschrift handle, und führe deshalb zur Nichtigkeit des Änderungsgesetzes. Hierauf seien auch die allgemeinen Grundsätze des Wahlprüfungsrechts nicht analog anwendbar, wonach sich ein Verstoß auf das Ergebnis ausgewirkt haben müsse. Andernfalls müsse der Verfassungsgerichtshof im Rahmen einer Beweisaufnahme sämtliche Abgeordnete zu ihrem hypothetischen Abstimmungsverhalten befragen.
bb) Das Änderungsgesetz sei auch deshalb formell verfassungswidrig, weil das gemäß Art. 76 Abs. 2 BV zwingend erforderliche Datum des Inkrafttretens unter Verletzung von Art. 71 BV durch den Ausschuss für Bildung und Kultus, dem kein Gesetzesinitiativrecht zukomme, in den Landtag eingebracht worden sei. Dies stelle eine wesentliche Änderung des Gesetzentwurfs dar, mit der der Ausschuss seine Kompetenzen überschritten habe. Mit Blick auf die verfassungsrechtlichen Kriterien des Parlamentsvorbehalts sei es nicht zulässig, dass ein nicht öffentlich tagender Ausschuss das Datum des Inkrafttretens eines Gesetzes vorschlage und damit die Entscheidung gemäß Art. 76 Abs. 2 BV, die zentrale Fragen der Staatsorganisation, des Gesetzesvollzugs sowie die Grundrechte einzelner Personen betreffe, allein treffe. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dürften Ausschüsse keine Funktion innehaben, die nur einem nach Art. 76 Abs. 1 GG zur Gesetzesinitiative Berechtigten zustehe (BVerfG vom 15.1.2008 BVerfGE 120, 56/78). Die damit zusammenhängenden Bestimmungen stünden auch nicht zur Disposition der Beteiligten. Der Fehler sei auch evident (vgl. BGH vom 17.10.2003 – V ZR 91/03 – juris) und führe daher zur Nichtigkeit des Änderungsgesetzes.
cc) Das Änderungsgesetz verstoße zudem gegen das Konnexitätsprinzip (Art. 83 Abs. 3 und 7 BV), weil es Gemeinden und Landkreisen als Schul(aufwands) trägern neue Aufgaben übertrage, die mit finanziellen Auswirkungen für diese verbunden seien, ohne hierfür zugleich einen Ausgleich vorzusehen. Mit der Einführung des Islamunterrichts werde ein neues ordentliches Lehrfach geschaffen, für das neue Unterrichtsräume und neue Lehrmittel wie Lehrbücher erforderlich seien, was mit Kosten für die Kommunen verbunden sei. Der finanzielle Ausgleich hierfür müsse bereits im Gesetz selbst enthalten sein, was vorliegend nicht der Fall sei, sodass das Änderungsgesetz nichtig sei. Daran ändere auch Art. 22 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) nichts, der nur für Schulbücher gelte, da den Schulträgern danach lediglich ein Teil der anfallenden Kosten ersetzt werde. Darin liege zudem ein Verstoß gegen Art. 83 Abs. 1 BV, da das Schulwesen zum eigenen Wirkungskreis der Kommunen gehöre. Ob auch ein Verstoß gegen Art. 83 Abs. 7 BV vorliege, weil die kommunalen Spitzenverbände nicht angehört worden seien, sei im Gerichtsverfahren zu klären.
b) Das Änderungsgesetz sei darüber hinaus auch materiell verfassungswidrig.
aa) Die Einführung von Islamunterricht verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 118 Abs. 1 BV), da das Änderungsgesetz zwischen dem Islam und anderen Religionen und Weltanschauungen differenziere, ohne dass es eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung hierfür gebe. Nur für Muslime werde ein besonderer Ethikunterricht geschaffen, nicht jedoch auch für Zeugen Jehovas, Buddhisten, Atheisten usw. oder für nach Art. 127 BV anerkannte Weltanschauungsgemeinschaften, obwohl der Islam keine Religionsgemeinschaft im Sinn des Art. 136 Abs. 2 Satz 2 BV sei. Dadurch privilegiere das Änderungsgesetz den Islam und diskriminiere andere Religionen und Weltanschauungen, obwohl diese gemäß Art. 4 GG, Art. 107, 127, 142 und 146 BV gleich zu behandeln seien. Der zur Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung angeführte Integrationsbedarf von Muslimen sei verfassungsrechtlich nicht haltbar. Die Ungleichbehandlung wiege auch schwer, weil sie sich auf das Erziehungsrecht der Eltern (Art. 126 Abs. 1 BV) sowie auf die Religions- und Weltanschauungsfreiheit der Schüler (Art. 107 Abs. 1 BV) auswirke. Die Unterscheidung beruhe zudem auf dem nach Art. 3 Abs. 3 GG, Art. 118 Abs. 1, Art. 127 BV verpönten Kriterium der Religion bzw. Weltanschauung. Wenn der Staat für Muslime eigenen Ethikunterricht einführe, müsse er aus Gleichbehandlungsgründen auch für Schüler anderer Religionen und Weltanschauungen solchen Unterricht anbieten. Die alleinige Einführung von Islamunterricht sei deshalb unverhältnismäßig, zumal sie auch bekenntnisfreie Schulen und private Weltanschauungsschulen betreffe.
bb) Durch die Bevorzugung des Islam werde die Religionsfreiheit (Art. 107 Abs. 1 i. V. m. Art. 118 Abs. 1 BV) anderer Schüler und Eltern verletzt. Die Möglichkeit, sich im Unterricht über die eigene Religion zu informieren, stelle eine Förderung dieser Religion dar. Diese Vorteile erhielten aber nur muslimische Schüler, nicht auch die Schüler, die einer anderen Religion oder Weltanschauung anhingen. Dies stelle einen Eingriff in deren Religionsfreiheit dar. Gleiches gelte für die Berufsfreiheit (Art. 101 BV) von Lehrkräften, die z. B. atheistische Ethik unterrichten wollten.
cc) Aus den unter bb) genannten Gründen sei auch das Elternrecht aus Art. 126 Abs. 1 i. V. m. Art. 118 Abs. 1 BV verletzt, die Kinder analog zum Islamunterricht in einem Ethikunterricht mit dem Schwerpunkt bei der jeweiligen Religion bzw. Weltanschauung erziehen zu lassen.
dd) Aus den unter bb) genannten Gründen sei auch das Recht anderer Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaften aus Art. 127 i. V. m. Art. 118 Abs. 1 BV verletzt, ihren Anhängern analog zum Islamunterricht Wissen über ihre Religion bzw. Weltanschauung durch den Staat vermitteln zu lassen.
ee) In der einseitigen Förderung des Islam liege zudem ein Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz (Art. 142 Abs. 1 BV), der eine Differenzierung zugunsten einer bestimmten Religion oder Weltanschauung verbiete. Die Privilegierung des Islam sei auch im Hinblick auf den Anteil von Muslimen an der Bevölkerung in Bayern von ca. 13% nicht gerechtfertigt, denen mindestens 20% Atheisten bzw. Konfessionslose gegenüberstünden. Atheistische bzw. konfessionslose Schüler könnten nicht auf den allgemeinen Ethikunterricht verwiesen werden, weil deren Weltanschauung und Philosophie dort nicht in gleichem Maß Schwerpunkt seien wie der Islam im Islamunterricht. Bei diesem handle es sich letztlich nur um die Fortführung des Modellversuchs. Zwar werde in der Gesetzesbegründung betont, dass Islamunterricht nicht als Religionsunterricht im Sinn des Art. 137 Abs. 1 BV, sondern lediglich als Ethikunterricht im Sinn des Art. 137 Abs. 2 BV ausgestaltet werden könne. Wie die Lehrpläne zeigten, gehe es beim Islamunterricht jedoch in erster Linie darum, Schülern Kenntnisse über den Islam als Religion und Lebensweise zu vermitteln. Aus diesem Grund beinhalte der Islamunterricht keine reine Wissensvermittlung über den Islam und allgemeine Werte. Vielmehr handle es sich bei ihm um konfessionellen Unterricht, mit dem der Staat unter Umgehung von Art. 136 BV muslimischen Schülern unter dem Deckmantel eines besonderen Ethikunterrichts islamischen Religionsunterricht anbiete, der sich grundlegend vom allgemeinen Ethikunterricht nach Art. 137 Abs. 2 BV unterscheide. Es sei ihm aber verwehrt, sich derart mit einer Religion zu identifizieren und diese zu privilegieren.
ff) Die Einführung von islamischem Religionsunterricht verletze auch Art. 135 Satz 2 i. V. m. Art. 137 Abs. 2 BV, wonach Schüler nach christlichen oder allgemeinen ethischen, nicht jedoch nach islamischen Grundsätzen zu unterrichten seien.
gg) Mit der Einführung von islamischem Religionsunterricht würden muslimische Schüler unter Umgehung von Art. 136 BV i. V. m. Art. 118 Abs. 1 BV gegenüber jüdischen, protestantischen oder katholischen Schülern privilegiert, weil sie diesen erhielten, ohne dass für den Islam die Voraussetzungen des Art. 136 Abs. 2 Satz 2 BV nachgewiesen seien.
hh) Die Einführung von islamischem Religionsunterricht verstoße gegen Art. 137 Abs. 1 BV, weil die Vorgaben des Art. 136 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 bis 5 BV hierfür nicht eingehalten würden.
ii) Da gemäß Art. 137 BV nur Religionsunterricht oder alternativ Ethikunterricht zulässig sei, sei die Einführung von Islamunterricht anstelle von Ethikunterricht nicht durch bloße Änderung von Art. 47 BayEUG, sondern nur durch eine Verfassungsänderung möglich. Werde infolge des Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl für den Ethikunterricht an einer Schule nur Islamunterricht angeboten, sei auch das Grundrecht auf Besuch des Ethikunterrichts nach Art. 137 Abs. 2 BV verletzt.
jj) Die Einführung von islamischem Religionsunterricht verstoße auch gegen den Parlamentsvorbehalt, weil der Gesetzgeber die für die Grundrechtsausübung wesentlichen Fragen nicht selbst geregelt, sondern der Exekutive überlassen habe.
kk) Das Änderungsgesetz verletze das Rechtsstaatsprinzip (Art. 3 Abs. 1 BV), weil die Einführung von Islamunterricht mit dem Grundsatz der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung sowie dem Gebot der Normenklarheit und dem Transparenzgebot unvereinbar sei. Entgegen der Gesetzesbegründung sei der Unterricht nicht bloße Islamkunde, sondern Religionsunterricht. Durch diesen „Etikettenschwindel“ verletze der Staat zudem die Religionsfreiheit der Muslime (Art. 107 Abs. 1 BV).
4. Aber auch wenn man vorliegend nur von offenen Erfolgsaussichten ausgehen wollte, falle die Folgenabwägung eindeutig zu Gunsten der Antragsteller aus. Bei einer Ablehnung des Eilantrags würden massive Nachteile für das Allgemeinwohl, erhebliche finanzielle Schäden und zahlreiche schwere Grundrechtsverletzungen eintreten, die bei einem Erfolg im Hauptsacheverfahren nicht wiederhergestellt werden könnten. Bei einer Einführung des Islamunterrichts müssten neue Lehrer hierfür ausgebildet und alimentiert werden. Die Einführung des Islamunterrichts würde zu erheblichen Aufwendungen der Kommunen als Schul(aufwands) träger führen. Die realistische Beschränkung des Ethikunterrichts hätte zur Folge, dass einzelne Schüler nicht von ihrem Recht auf Teilnahme am Ethikunterricht nach Art. 137 Abs. 2 BV Gebrauch machen könnten; würde der Islamunterricht dagegen zunächst nicht eingeführt, müssten daran interessierte Schüler lediglich wie bisher am Ethikunterricht teilnehmen. Müsste der Islamunterricht nach seiner Einführung wieder beendet werden, hätte dies massive Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Im Übrigen könne durch Erlass einer einstweiligen Anordnung verhindert werden, dass der Landtag seine bisherige Corona-Praxis unter Verstoß gegen Art. 23 Abs. 2 BV fortführe und auch künftig Art. 71 i. V. m. Art. 76 Abs. 2 BV missachte.
5. Mit Schriftsatz vom 24. August 2021 vertieften und ergänzten die Antragsteller ihr bisheriges Vorbringen und erweiterten ihre Anträge auf § 1 Nr. 2 der Änderungsverordnung.
Auch eine Rechtsverordnung könne ein „Gesetz“ im Sinn von Art. 75 Abs. 3 BV darstellen. Jedenfalls müssten die Änderungen des § 27 BaySchO inzident im Rahmen eines gegen Art. 47 BayEUG n. F. gerichteten Antrags geprüft werden.
Da die Änderungen ohne parlamentarische Rechtsgrundlage erfolgt seien, sei zumindest eine Verletzung der Handlungsfreiheit (Art. 101 BV) möglich. Sie privilegierten den Islamunterricht gegenüber dem Religions- und Ethikunterricht, sodass auch ein Verstoß gegen Art. 118 Abs. 1 BV vorliege. Es fehle an der nach Art. 83 Abs. 7 BV erforderlichen Anhörung. Die Änderungen verstießen gegen Art. 80 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 3 Abs. 1, Art. 55 Nr. 2 Satz 3 BV, weil die Regelungen über die Mindestteilnehmerzahl für den Islamunterricht, das Abmelde- und Anmeldeverfahren sowie das Verhältnis zum Religions- und Ethikunterricht einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung bedürften, die weder in Art. 45 BayEUG noch in Art. 46 oder 47 BayEUG zu finden sei. Darin liege zudem ein Verstoß gegen die Wesentlichkeitstheorie, weil diese Fragen durch den Gesetzgeber geregelt hätten werden müssen.
§ 27 Abs. 8 Satz 2 BaySchO privilegiere den Islamunterricht, weil danach auch eine niedrigere Mindestteilnehmerzahl als beim Religions- und Ethikunterricht bzw. beim Alevitischen Religionsunterricht zulässig sei. Dadurch werde § 27 Abs. 9 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 BaySchO ausgehebelt, der für alle Unterrichtsarten die gleiche Mindestteilnehmerzahl festlege. Auch die sonstigen Änderungen zugunsten des Islamunterrichts verstießen gegen Art. 118 Abs. 1 i. V. m. Art. 101, 107, 126, 127, 135, 136 und 137 BV, weil sie Atheisten und Konfessionslose diskriminierten. Es sei nicht ersichtlich, weshalb § 27 Abs. 9 BaySchO nicht auch für private Schulen gelte, wo ebenfalls Integrationsbedarf für Muslime bestehe.
III.
1. Der Bayerische Landtag (Antragsgegner zu 2 in Vf. 43-VIII-21) hat zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Verfahren Vf. 43-VIII-21 hinsichtlich des Änderungsgesetzes Stellung genommen und hält diesen mangels Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund für unbegründet.
2. Die Bayerische Staatsregierung (Antragsgegnerin zu 1 in Vf. 43-VIII-21) hält den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Verfahren Vf. 43-VIII-21 hinsichtlich des Änderungsgesetzes schon für unzulässig, jedenfalls aber, ebenso wie den Antrag im Verfahren Vf. 44-VII-21, für unbegründet. Es bestehe weder ein Anordnungsanspruch noch ein Anordnungsgrund, insbesondere sei der Antrag nach Art. 75 Abs. 3 BV bereits unzulässig.
3. Die Landtagsfraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP (Antragsgegner zu 3 bis 6 in Vf. 43-VIII-21) halten den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Verfahren Vf. 43-VIII-21 hinsichtlich des Änderungsgesetzes für unbegründet, die FDP-Fraktion bezogen speziell auf ihre Inanspruchnahme als Antragsgegnerin auch schon für unzulässig. Sie alle berufen sich darauf, dass ein etwaiges Hauptsacheverfahren keine Aussicht auf Erfolg hätte, da es sowohl unzulässig als auch unbegründet wäre.
4. Der Schriftsatz der Antragsteller vom 24. August 2021 mit der Antragserweiterung auf § 1 Nr. 2 der Änderungsverordnung wurde den Beteiligten übermittelt.
IV.
Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung haben keinen Erfolg.
1. Nach Art. 26 Abs. 1 VfGHG kann der Verfassungsgerichtshof eine einstweilige Anordnung erlassen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund dringend geboten ist. Diese Regelung bezieht sich auf alle Verfahrensarten im Sinn des Art. 2 VfGHG (vgl. VerfGH vom 12.8.1994 VerfGHE 47, 178/181 m. w. N.), insbesondere auch auf Popularklageverfahren nach Art. 98 Satz 4 BV (vgl. VerfGH vom 5.6.1989 VerfGHE 42, 86/91). Es ist daher sachgerecht, diese Rechtsprechung auch auf Meinungsverschiedenheiten im Sinn des Art. 75 Abs. 3 BV anzuwenden. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung kann grundsätzlich auch schon gestellt werden, bevor die Hauptsache anhängig ist, sofern die Erhebung einer Hauptsacheklage, die nicht offensichtlich unzulässig erscheint, bevorsteht (vgl. VerfGHE vom 19.7.1982 VerfGHE 35, 82/87; vom 4.2.1991 VerfGHE 44, 9/14).
Wegen der weitreichenden Folgen, die eine einstweilige Anordnung im Popularklageverfahren in der Regel auslöst, ist an die Voraussetzungen, unter denen sie erlassen werden kann, ein strenger Maßstab anzulegen (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom 13.11.1995 VerfGHE 48, 1/3 f.; vom 21.12.2017 NVwZ-RR 2018, 593 Rn. 13; vom 1.2.2021 – Vf. 98-VII-20 – juris Rn. 13). Aufgrund des Wesens der Popularklage dürfen konkrete Maßnahmen zugunsten einzelner von einem Rechtssatz betroffenen Personen nicht erlassen werden; vielmehr kommt auch im Rahmen einer einstweiligen Anordnung nur eine Regelung infrage, die generell den Vollzug der angegriffenen Vorschrift vorläufig aussetzt (vgl. VerfGH vom 4.11.2010 VerfGHE 63, 188/192 f. m. w. N.). Die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit der angefochtenen Vorschrift vorgetragen werden, haben im Regelfall außer Betracht zu bleiben. Nur wenn bereits offensichtlich ist, dass die Popularklage aus prozessualen oder sachlichen Gründen keine Aussicht auf Erfolg hat, kommt eine einstweilige Anordnung von vornherein nicht in Betracht. Umgekehrt kann der Erlass einer einstweiligen Anordnung dann geboten sein, wenn die Verfassungswidrigkeit der angefochtenen Vorschrift offensichtlich ist. Ist der Ausgang des Popularklageverfahrens dagegen als offen anzusehen, sind die Folgen, die eintreten würden, wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge, die Popularklage aber Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen abzuwägen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Popularklage aber der Erfolg zu versagen wäre. Bei dieser Abwägung müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe so gewichtig sein, dass sie im Interesse der Allgemeinheit eine einstweilige Anordnung zur Abwehr schwerer Nachteile unabweisbar machen (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH NVwZ-RR 2018, 593 Rn. 13 m. w. N.). Wegen des erheblichen Eingriffs in die originäre Zuständigkeit des Gesetzgebers müssen im Fall der begehrten Außervollzugsetzung eines Gesetzes die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe besonderes Gewicht haben (vgl. zu § 32 Abs. 1 BVerfGG die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts: BVerfG vom 26.8.2015 BVerfGE 140, 99 Rn. 12; vom 15.4.2019 BVerfGE 151, 152 Rn. 24; vom 20.7.2021 – 2 BvF 1/21 – juris Rn. 135 m. w. N.).
Da mit dem Erlass einer einstweiligen Anordnung im Verfahren der Meinungsverschiedenheit gegen ein Gesetz entsprechend weitreichende Folgen verbunden wären, sind die genannten Maßstäbe auch insoweit anzuwenden.
Entgegen der Auffassung der Antragsteller hat der Verfassungsgerichtshof auch in den vorliegenden Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Hauptsache keinen vertieften Prüfungsmaßstab anzulegen. Zu den Wesensmerkmalen des einstweiligen Rechtsschutzes gehört es gerade, dass dieser in eilbedürftigen Fällen eingreifen kann, in denen – etwa wegen des Umfangs oder der Schwierigkeit der rechtlichen Fragestellung – eine abschließende Entscheidung in der Hauptsache nicht kurzfristig möglich ist. Wollte man den Erlass oder die Ablehnung einer einstweiligen Anordnung in derartigen Fällen von einer vollständigen Sach- und Rechtsprüfung abhängig machen, hätte dies nur zur Folge, dass einstweiliger Rechtsschutz nicht zeitnah gewährt werden könnte (vgl. VerfGH vom 30.12.2020 – Vf. 96-VII-20 – juris Rn. 11). Ein Anspruch auf eine vertiefte Prüfung kann insoweit weder aus der Bayerischen Verfassung (VerfGH, a. a. O., Rn. 12) noch aus dem Wortlaut, der Entstehungsgeschichte oder dem Sinn und Zweck des Art. 26 Abs. 1 VfGHG hergeleitet werden.
Auch das Bundesverfassungsgericht legt wegen der weitreichenden Folgen einer einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG einen strengen Maßstab an deren Erlass. Wird die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes begehrt, gelten dafür besonders hohe Hürden, da dies einen erheblichen Eingriff in die originäre Zuständigkeit des Gesetzgebers darstellt. Müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe schon im Regelfall so schwer wiegen, dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen, so müssen sie im Fall der Außervollzugsetzung eines Gesetzes darüber hinaus besonderes Gewicht haben. Insoweit ist von entscheidender Bedeutung, ob die Nachteile irreversibel oder nur schwer rückgängig zu machen sind. Die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes vorgetragen werden, haben dabei grundsätzlich außer Betracht zu bleiben, es sei denn, die Hauptsache erweist sich als von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Ist der Erfolg des Hauptsacheverfahrens dagegen offen, ist eine Folgenabwägung vorzunehmen (ständige Rechtsprechung; vgl. BVerfGE 140, 99 Rn. 11 ff.; vom 13.10.2016 BVerfGE 143, 65 Rn. 34 f.; vom 5.5.2021 NVwZ 2021, 789 Rn. 19 f.; vom 20.7.2021 – 2 BvF 1/21 – juris Rn. 135).
Anderes kann insoweit auch nicht dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 21. April 2021 (NVwZ 2021, 865 Rn. 69 ff.) zur Ausfertigung des Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetzes („EU-Wiederaufbaufonds“) entnommen werden, wonach dann, wenn eine irreversible Verletzung der Schutzgüter des Art. 79 Abs. 3 GG in Rede steht, eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren geboten sein kann. Damit ist der vorliegende Sachverhalt nicht vergleichbar, weil die Einführung des Islamischen Unterrichts wieder beendet werden könnte und kein irreversibler Schaden im Sinne dieser Rechtsprechung droht. Entsprechendes gilt für die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 4. April 2014 (NVwZ 2014, 1089) sowie des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom 14. Oktober 2020 (BayVBl 2021, 121), in denen jeweils irreversible Nachteile im Raum standen.
2. Nach diesen Maßstäben ist eine einstweilige Anordnung hier nicht zu erlassen.
a) Der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Verfahren Vf. 43-VIII-21 kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil das angekündigte Hauptsacheverfahren einer Meinungsverschiedenheit nach Art. 75 Abs. 3 BV mangels Erkennbarkeit der Meinungsverschiedenheit bereits im Gesetzgebungsverfahren offensichtlich unzulässig wäre.
aa) Nach Art. 75 Abs. 3 BV entscheidet der Verfassungsgerichtshof Meinungsverschiedenheiten darüber, ob durch ein Gesetz die Verfassung geändert wird oder ob ein Antrag auf unzulässige Verfassungsänderung vorliegt. Diese Voraussetzungen sind gemäß Art. 49 Abs. 1 VfGHG auch erfüllt, wenn die Meinungsverschiedenheit darüber besteht, ob durch ein Gesetz die Verfassung verletzt wird. Die Meinungsverschiedenheit muss zwischen am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organen oder Teilen derselben entstanden sein; ihnen stehen Fraktionen gleich, die sich mit gegenteiligen Auffassungen gegenüberstehen. Die Meinungsverschiedenheit muss bereits im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens erkennbar geworden sein. Zwischen der Meinungsverschiedenheit, wie sie den Gegenstand der Verfassungsstreitigkeit bildet, und den während der Gesetzesberatungen im Landtag erhobenen Rügen muss grundsätzlich Identität hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften und der als verletzt erachteten Verfassungsnormen bestehen (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom 27.7.1972 VerfGHE 25, 97/108 ff.; vom 19.10.1994 VerfGHE 47, 241/252; vom 9.5.2016 VerfGHE 69, 125 Rn. 107).
bb) Vorliegend hat die Antragstellerin, die AfD-Fraktion, die als Teil des Landtags nach Art. 49 Abs. 2 Satz 1 VfGHG antragsberechtigt ist, zwar am Verfahren zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen mitgewirkt und dieses abgelehnt. Als Antragsgegner hat sie auch zutreffend zumindest die beiden Koalitionsfraktionen der CSU und der FREIEN WÄHLER im Landtag (Antragsgegner zu 3 und 4) sowie die Staatsregierung (Antragsgegnerin zu 1) benannt (vgl. VerfGHE 25, 97/108; VerfGH vom 21.11.2016 VerfGHE 69, 290 Rn. 60; vom 30.7.2018 BayVBl 2019, 158 Rn. 42; vom 3.12.2019 BayVBl 2020, 226 Rn. 88; vom 28.8.2020 BayVBl 2020, 803 Rn. 38). Ob daneben auch die weiteren Antragsgegner zu Recht von ihr in Anspruch genommen werden, kann dahinstehen; der Landtag (Antragsgegner zu 2) ist jedenfalls am Verfahren zu beteiligen (vgl. VerfGHE 25, 97/107). Jedoch ist die geltend gemachte Meinungsverschiedenheit zwischen der Antragstellerin und den Antragsgegnern über die Verfassungsmäßigkeit des Änderungsgesetzes nicht schon im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens erkennbar geworden. Hierfür genügt eine ablehnende Abstimmung für sich allein genommen nicht, vielmehr muss die Meinungsverschiedenheit konkretisiert zum Ausdruck gebracht worden sein (vgl. VerfGHE 25, 97/109).
(1) Soweit die Antragstellerin als Beleg für die von ihrem Abgeordneten B. in der dritten Lesung des Gesetzentwurfs am 6. Juli 2021 angeblich gerügte Vielzahl an Verfassungsverstößen durch das Änderungsgesetz nur eine Internetadresse angibt, ist der Hinweis darauf unabhängig davon, dass diese nicht (mehr) abrufbar ist, schon mangels Einhaltung der Schriftform gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 1 VfGHG nicht geeignet, die Erkennbarkeit der Meinungsverschiedenheit darzulegen.
(2) Ausweislich der Landtagsprotokolle wurden von Abgeordneten der Antragstellerin auch keine konkreten verfassungsrechtlichen Zweifel gegen das Änderungsgesetz erhoben, sondern lediglich unspezifische rechtliche Bedenken geltend gemacht sowie politische Vorbehalte gegen den Islamischen Unterricht vorgetragen. So hat der Abgeordnete B. in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs ausgeführt, dass der Islamunterricht nicht der Integration von Muslimen diene, erforderlich sei vielmehr ein aufgeklärter Weltanschauungsunterricht (vgl. Plenarprotokoll 18/81 S. 10758 f.). In der zweiten Lesung hat der Abgeordnete K. erklärt, dass die AfDFraktion Islamunterricht ablehne, weil die islamische Religion inhaltlich den Menschenrechten, der Toleranz und dem Pluralismus widerspreche, Muslime könnten – ebenso wie andere Schüler – auch den Ethikunterricht besuchen (vgl. Plenarprotokoll 18/86 S. 11578 ff.). In der dritten Lesung hat der Abgeordnete H. den Islam als aggressive und frauenfeindliche Religion bezeichnet (vgl. Plenarprotokoll 18/87 S. 11757 f.), sein Fraktionskollege B. hat behauptet, dass mit dem Änderungsgesetz die Verfassung umgangen werde solle, weil die Voraussetzungen für einen islamischen Religionsunterricht nicht erfüllbar seien, aber nicht – auch nicht sinngemäß – gerügt, dass deshalb ein Verstoß gegen Art. 137 Abs. 2 BV vorliege (vgl. Plenarprotokoll 18/87 S. 11759 f.).
(3) Angesichts dessen fehlt es offensichtlich an der Identität zwischen den im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens erhobenen Rügen und der den Gegenstand des (angekündigten) Verfahrens bildenden Meinungsverschiedenheit. Eine bis zur Schlussabstimmung zulässige (vgl. VerfGH vom 21.11.1986 VerfGHE 39, 96/136) Rüge der fehlenden Beschlussfähigkeit des Landtags nach Art. 23 Abs. 2 BV erfolgte nicht, obwohl ihr die namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf unmittelbar vorausging und das Ergebnis vor der Schlussabstimmung bekannt gegeben wurde (Plenarprotokoll 18/87 S. 11764). Eine Verletzung des Konnexitätsprinzips, des Initiativrechts, der Religionsfreiheit, des Erziehungsrechts, des Rechts auf Religions- oder Ethikunterricht, der Rechte von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, des Gleichheitsgrundsatzes oder der staatlichen Neutralitätspflicht wurde bis zur Schlussabstimmung ebenfalls nicht (ausdrücklich oder sinngemäß) gerügt, obwohl die o. g. Abgeordneten – trotz gegebenenfalls knapper Redezeit – allgemeine Ausführungen zum Islamischen Unterricht gemacht haben.
Dem steht nicht entgegen, dass der Verfassungsgerichtshof in der Entscheidung vom 17. September 1999 (VerfGHE 52, 104/120 f.) geringere Anforderungen an die Geltendmachung einer Meinungsverschiedenheit bei der Volksgesetzgebung gestellt hat. Aufgrund grundlegender Unterschiede zwischen parlamentarischem und plebiszitärem Gesetzgebungsverfahren ist diese Entscheidung nicht auf das vorliegende Verfahren, das den „Regelfall“ einer im politischen Diskurs im Landtag entstandenen Meinungsverschiedenheit betrifft, übertragbar.
cc) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin besteht auch kein Anlass, diese seit langem anerkannte und aus Wortlaut, Entstehungsgeschichte sowie verfassungsrechtlicher Systematik heraus entwickelte Zulässigkeitsvoraussetzung generell zu überdenken. Auch wenn das Verfahren des Art. 75 Abs. 3 BV gewissermaßen als Pendant zur abstrakten Normenkontrolle nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG anzusehen ist (vgl. VerfGHE 47, 241/252 f.), behandelt es keinen Fall der abstrakten Normenkontrolle in der Weise, dass die Frage der Vereinbarkeit eines Gesetzes mit Verfassungsrecht losgelöst von jedem konkreten Streitfall Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung wäre (vgl. VerfGHE 25, 97/109 f.). Es handelt sich vielmehr um ein echtes kontradiktorisches Verfahren, in dem der Verfassungsgerichtshof Meinungsverschiedenheiten der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe oder von Teilen derselben zu klären und nicht davon losgelöst über die Auslegung und Anwendung der Verfassung als solcher zu befinden hat. Art. 75 Abs. 3 BV begründet keine Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs zur Entscheidung über jede Art von Zweifeln hinsichtlich der Auslegung der Verfassung oder der Vereinbarkeit von einfachem Recht mit Verfassungsrecht. Sowohl seine systematische Stellung im 6. Abschnitt der Bayerischen Verfassung „Die Gesetzgebung“ und sein Wortlaut als auch seine Entstehungsgeschichte zeigen, dass es sich bei dem Verfahren nach Art. 75 Abs. 3 BV um eine echte Streitigkeit zwischen Verfassungsorganen oder Teilen derselben handelt. Für eine von der Antragstellerin befürwortete Analogie zur Popularklage nach Art. 98 Satz 4 BV bzw. zur abstrakten Normenkontrolle des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG ist deshalb kein Raum (vgl. VerfGH vom 26.8.2021 – Vf. 60-VIII-20 – Rn. 49).
dd) Eine künftige Meinungsverschiedenheit über § 1 Nr. 2 der Änderungsverordnung scheidet von vornherein aus, weil es sich dabei um eine Rechtsverordnung und nicht um ein Gesetz im Sinn von Art. 75 Abs. 3 BV, Art. 49 Abs. 1 VfGHG handelt, an deren Erlass der Landtag auch nicht beteiligt war, sodass schon deshalb keine Meinungsverschiedenheit im Sinn von Art. 75 Abs. 3 BV entstanden sein kann. Daran ändert auch nichts, dass der Verfassungsgerichtshof im Rahmen einer zulässigen Popularklage gegen eine auf landesgesetzlicher Ermächtigung beruhende Rechtsverordnung auch prüft, ob sie auf einer ausreichenden gesetzlichen Ermächtigung beruht und sich im Rahmen dieser Ermächtigung hält, weil sie andernfalls bereits wegen eines Verstoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV) nichtig wäre (vgl. VerfGH vom 11.4.2017 VerfGHE 70, 69 Rn. 20; vom 5.3.2020 BayVBl 2020, 513 Rn. 31).
b) Auch im Verfahren Vf. 44-VII-21 kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht in Betracht, weil erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit einer Popularklage bestehen (aa), diese hinsichtlich einzelner Rügen offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hätte (bb), ihre Erfolgsaussichten im Übrigen allenfalls als offen anzusehen wären (cc) und die vorzunehmende Folgenabwägung ergibt, dass die gegen den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe überwiegen (dd).
aa) An der Zulässigkeit einer künftigen Popularklage bestehen erhebliche Zweifel.
(1) Soweit sie sich gegen die Durchführung des Islamischen Unterrichts richtet, wäre sie gemäß Art. 98 Satz 4 BV, Art. 55 Abs. 1 Satz 1 VfGHG offensichtlich nicht statthaft, wonach jedermann Popularklage gegen (bayerische) Gesetze und Verordnungen erheben kann, die ein Grundrecht verfassungswidrig einschränken. Das Änderungsgesetz und § 1 Nr. 2 der Änderungsverordnung stellen zulässige Gegenstände der Popularklage dar. Dagegen kann der Normvollzug durch die Exekutive nicht mit der Popularklage angegriffen werden (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom 28.1.2003 VerfGHE 56, 1/4; vom 17.5.2006 VerfGHE 59, 63/68; vom 19.4.2007 VerfGHE 60, 80/95; vom 24.8.2020 BayVBl 2020, 842 Rn. 25). Deshalb können die Antragsteller nicht rügen, dass die Einführung des Islamischen Unterrichts das Recht von Schülerinnen und Schülern auf Besuch des Ethikunterrichts (Art. 137 Abs. 2 BV) verfassungswidrig einschränke, weil in der Praxis z. B. bei Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl für den Ethikunterricht nicht gewährleistet sei, dass dieser neben dem Islamischen Unterricht erhalten bleibe; eine solche Situation soll im Übrigen durch § 27 Abs. 8 Satz 3 BaySchO n. F. gerade verhindert werden. Gleiches gilt für die Behauptung, angesichts der Lehrpläne für den Modellversuch handle es sich auch beim Islamischen Unterricht in Wirklichkeit um Religionsunterricht, der vom Staat unter Umgehung von Art. 136 BV eingeführt werde. Lehrpläne sind keine Rechtsvorschriften im Sinn von Art. 98 Satz 4 BV, Art. 55 Abs. 1 Satz 1 VfGHG, sondern interne Verwaltungsvorschriften, die der inneren Gestaltung des Unterrichts dienen und denen nicht der Charakter von Rechtsvorschriften mit Außenwirkung zukommt (vgl. VerfGHE 59, 63/68). Aus ihnen kann auch nicht auf den „wahren“ Charakter des Islamischen Unterrichts geschlossen werden. Maßgeblich für dessen verfassungsrechtliche Beurteilung sind vielmehr das Gesetz sowie die Gesetzesbegründung.
(2) Darüber hinaus haben die Antragsteller entgegen Art. 55 Abs. 1 Satz 2 VfGHG auch nicht substanziiert dargelegt, dass durch die angegriffenen Regelungen ein Grundrecht der Bayerischen Verfassung verfassungswidrig eingeschränkt wird.
Zu den prozessualen Voraussetzungen einer Popularklage gehört nach Art. 55 Abs. 1 Satz 2 VfGHG, dass der Antragsteller darlegt, inwiefern durch die angegriffene Rechtsvorschrift ein in der Bayerischen Verfassung gewährleistetes Grundrecht verfassungswidrig eingeschränkt wird. Die Popularklage ist unzulässig, wenn und soweit eine als verletzt bezeichnete Norm der Verfassung kein Grundrecht gewährt oder wenn zwar ein Grundrecht als verletzt gerügt wird, eine Verletzung nach Sachlage aber von vornherein nicht möglich ist, weil der Schutzbereich des angeblich verletzten Grundrechts durch die angefochtene Rechtsvorschrift nicht berührt wird, bzw. wenn die geltend gemachte Grundrechtsverletzung nach Sachlage schlechthin ausgeschlossen, also begrifflich nicht möglich ist. Eine ausreichende Grundrechtsrüge liegt nicht schon dann vor, wenn der Antragsteller nur behauptet, dass die angefochtene Rechtsvorschrift nach seiner Auffassung gegen Grundrechtsnormen der Bayerischen Verfassung verstößt. Der Antragsteller muss seinen Vortrag vielmehr so präzisieren, dass der Verfassungsgerichtshof beurteilen kann, ob der Schutzbereich der bezeichneten Grundrechtsnorm berührt ist. Die zur Überprüfung gestellten Tatsachen und Vorgänge müssen dies zumindest als möglich erscheinen lassen (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom 4.5.2012 VerfGHE 65, 73/81; vom 21.3.2016 BayVBl 2016, 743 Rn. 25; vom 26.3.2018 BayVBl 2018, 590 Rn. 56; vom 29.10.2020 BayVBl 2021, 83 Rn. 19).
Greift der Antragsteller mehrere Rechtsvorschriften an, so muss dem Darlegungserfordernis grundsätzlich für jede einzelne Vorschrift Genüge getan werden (vgl. VerfGH vom 4.11.1976 VerfGHE 29, 191/201 m. w. N.). Eine Ausnahme gilt nur, wenn ein Gesetz insgesamt mit der Rüge angegriffen wird, das Grundrecht der Handlungsfreiheit sei verletzt, weil die Normen nicht ordnungsgemäß zustande gekommen seien und deshalb nicht zur verfassungsmäßigen Ordnung gehörten (vgl. VerfGH vom 29.8.1997 VerfGHE 50, 181/196; vom 17.11.2005 VerfGHE 58, 253/260).
(a) Die Antragsteller tragen zwar vor, dass das Änderungsgesetz vom 23. Juli 2021 bereits formell verfassungswidrig zustande gekommen sei, sodass jedenfalls eine Verletzung des Grundrechts auf Handlungsfreiheit (Art. 101 BV) möglich sei. Auch wenn ein formeller Verstoß wie behauptet vorliegen sollte, impliziert dies aber nicht zugleich eine Verletzung der durch Art. 101 BV gewährleisteten Handlungsfreiheit. Diese verbürgt ein Abwehrrecht gegen ungesetzliche Eingriffe in die Freiheitssphäre durch den Staat, aber keinen Anspruch auf staatliche Leistungen (vgl. VerfGH vom 4.11.1976 VerfGHE 29, 191/212 m. w. N.). Daher wird die Handlungsfreiheit nicht dadurch berührt, dass Schülerinnen und Schülern, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, durch das Änderungsgesetz die bloße Möglichkeit eingeräumt wird, anstelle des gemäß Art. 137 Abs. 2 BV i. V. m. Art. 47 Abs. 1 Alt. 1 BayEUG n. F. verpflichtenden Besuchs des Ethikunterrichts (vgl. dazu BayObLG vom 26.10.1995 BayVBl 1996, 412) am Islamischen Unterricht teilzunehmen (Wahlpflichtfach im Sinn des Art. 50 Abs. 2 Satz 2 BayEUG, vgl. LTDrs. 18/15059 S. 4 f.). Da niemand – auch nicht muslimische Schülerinnen und Schüler – durch Art. 47 Abs. 1 Alt. 2 BayEUG n. F. zur Teilnahme am Islamischen Unterricht gezwungen wird, kommt eine Verletzung von Art. 101 BV offensichtlich nicht in Betracht. Unabhängig hiervon wird durch § 27 Abs. 8 Satz 3 BaySchO n. F., wonach Islamischer Unterricht nur dort eingerichtet werden kann, wo auch Ethikunterricht eingerichtet ist, zudem verhindert, dass in der Praxis eine Situation eintreten kann, in der Schülerinnen oder Schüler, die Religion abgewählt haben, nur den Islamischen Unterricht besuchen können. Damit wird gewährleistet, dass neben dem Religionsunterricht stets auch Ethikunterricht angeboten wird (vgl. LTDrs. 18/15059 S. 6).
(b) Da die Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten bzw. bei Volljährigen durch die Schülerinnen und Schüler selbst Voraussetzung für die Teilnahme am Islamischen Unterricht ist (vgl. § 27 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 BaySchO n. F.), kommt insoweit auch eine Verletzung der Religionsfreiheit (Art. 107 Abs. 1 BV) sowie des elterlichen Erziehungsrechts (Art. 126 Abs. 1 BV) offensichtlich nicht in Frage. Das etwaige Recht von Schülerinnen und Schülern auf Teilnahme am Religions- bzw. Ethikunterricht kann aus den genannten Gründen ebenso wenig beeinträchtigt sein, wobei insoweit schon fraglich ist, ob Art. 136 Abs. 2 BV – gleiches dürfte auch für Art. 137 Abs. 2 BV gelten – ein Grundrecht verbürgt (vgl. VerfGH vom 25.2.2002 – Vf. 5-VII-01 – juris Rn. 9).
(c) Soweit die Antragssteller einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz gemäß Art. 118 Abs. 1 BV (i. V. m. Art. 101, 107, 126, 127, 136, 137, 142, 146 BV) behaupten, weil die Einführung des Islamischen Unterrichts zu einer verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigten Privilegierung muslimischer Schülerinnen und Schüler gegenüber konfessionslosen oder andersgläubigen Schülerinnen und Schülern führe, wenn nur für diese, nicht aber für sonstige Schülerinnen und Schüler ein eigener Ethikunterricht geschaffen werde, wird damit ebenfalls keine mögliche Grundrechtsverletzung dargelegt. Der Gleichheitssatz verbietet, in willkürlicher Weise gleiche Sachverhalte ungleich und ungleiche Sachverhalte gleich zu behandeln (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom 19.2.2015 VerfGHE 68, 55 Rn. 30 m. w. N.). Es fehlt aber bereits deshalb an der nachvollziehbaren Darlegung einer willkürlichen Ungleichbehandlung, weil nicht erkennbar ist, dass es sich bei den muslimischen bzw. den keiner oder einer anderen Religion oder Weltanschauung angehörenden Schülerinnen und Schülern um vergleichbare Gruppen bezogen auf die Regelungsmaterie handeln würde. Schülergruppen, die sich anderen Konfessionen zugehörig fühlen, in denen Religionsunterricht nach Maßgabe des Art. 136 Abs. 2 BV angeboten wird, sind von vornherein nicht vergleichbar, weil ihnen dieser Religionsunterricht offensteht. Schülergruppen, die anderen religiös-kulturellen Hintergründen zuzuordnen sind, sind nicht vergleichbar, weil sie von ihrer jeweiligen Größe weit hinter der Gruppe aus dem islamischen Kulturraum zurückbleiben. Die Konfessionslosen gehören schon keiner einheitlichen Gruppe an, auch steht ihnen der allgemeine Ethikunterricht offen. Da es insoweit schon an der Vergleichbarkeit der Sachverhalte fehlt, kann hieraus kein Anspruch auf Gleichbehandlung anderer Schülergruppen hergeleitet werden (vgl. Lindner in Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 118 Rn. 24). Zudem richtet sich der neu eingeführte Islamische Unterricht zwar primär an muslimische Schülerinnen und Schüler (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 1), sein Besuch knüpft aber gerade nicht an eine bestimmte Religionszugehörigkeit an, sondern steht allen Schülerinnen und Schülern offen (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 4), sodass auch insoweit keine gegen Art. 118 Abs. 1 i. V. m. Art. 107 BV verstoßende Ungleichbehandlung aufgrund der Religion bzw. Weltanschauung gesehen werden kann.
Mit einer Außervollzugsetzung des Änderungsgesetzes wäre im Übrigen keine Einführung eines eigenen Ethikunterrichts für andere Schülerinnen und Schüler verbunden. Soweit dem Vorbringen der Antragsteller die Rüge eines Unterlassens des Gesetzgebers zu entnehmen sein sollte, besteht auf ein bestimmtes Handeln des Gesetzgebers grundsätzlich kein verfassungsgerichtlich verfolgbarer Anspruch (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom 5.11.2003 VerfGH 56, 141/142; vom 13.5.2009 VerfGHE 62, 61/66 f.).
(d) Entsprechendes wie für das Änderungsgesetz gilt auch für die Rügen hinsichtlich § 27 BaySchO n. F. Unabhängig davon, ob § 27 BaySchO n. F. auf einer ausreichenden gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage beruht, legen die Antragsteller nicht substanziiert dar, dass mit den durch die Einführung des Islamischen Unterrichts erfolgten Änderungen des § 27 BaySchO eine Verletzung der Handlungsfreiheit verbunden wäre. Soweit sie eine unzulässige Privilegierung muslimischer Schülerinnen und Schüler in § 27 Abs. 8 Satz 2 BaySchO n. F. sehen, wonach der Islamische Unterricht – anders als Religions- und Ethikunterricht – entgegen § 27 Abs. 9, 7, 2 Satz 2 BaySchO n. F. auch mit weniger als fünf Teilnehmern durchgeführt werden könne, ist auf die Ausführungen unter (c) zu verweisen, wonach es insoweit schon an der Vergleichbarkeit der Sachverhalte fehlt; nichts anderes gilt für das Vorbringen, Alevitischer Religionsunterricht setze sogar eine Mindestteilnehmerzahl von zwölf Schülern voraus. Soweit sie weiter rügen, es sei nicht ersichtlich, weshalb § 27 Abs. 9 i. V. m. Abs. 2 bis 5, 7 BaySchO nicht auch für private Schulen gelte, wo ebenfalls Integrationsbedarf für Muslime bestehe, legen sie ebenfalls keine Vergleichbarkeit der Sachverhalte dar.
bb) Unabhängig von der Frage der Zulässigkeit hätte eine Popularklage bezüglich der folgenden Rügen offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg.
(1) Entgegen der Behauptung der Antragsteller ist das Änderungsgesetz nicht deshalb formell verfassungswidrig zustande gekommen, weil das nach Art. 76 Abs. 2 BV erforderliche Datum seines Inkrafttretens nicht schon im Gesetzentwurf enthalten gewesen, sondern erst vom Bildungsausschuss eingefügt worden sei, dem nach Art. 71 BV kein Gesetzesinitiativrecht zukomme. Zum einen wurde das Datum des Inkrafttretens des Änderungsgesetzes vom Verfassungsausschuss (nicht wie behauptet vom Ausschuss für Bildung und Kultus) empfohlen und der Vorschlag vom Landtag in der zweiten Lesung übernommen. Zum anderen entspricht die Festlegung des Datums des Inkrafttretens im Rahmen der Endberatung gängiger Staatspraxis, weil die Dauer eines Gesetzgebungsverfahrens im Vorfeld nicht absehbar ist. Auch liegt darin keine wesentliche Änderung des Gesetzentwurfs (vgl. Brechmann in Meder/Brechmann, Die Verfassung des Freistaates Bayern, 6. Aufl. 2020, Art. 71 Rn. 4; Möstl in Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, 2. Aufl. 2017, Art. 71 Rn. 10), zumal das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes zum Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 am 1. August 2021 (vgl. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayEUG) bereits in diesem angelegt war (vgl. LT- Drs. 18/15059 S. 3).
(2) Soweit die Antragssteller eine Verletzung des Konnexitätsprinzips des Art. 83 Abs. 3 und 6 BV darin sehen, dass den Kommunen als Schul(aufwands) träger durch das Änderungsgesetz bzw. die Änderungsverordnung neue Aufgaben übertragen bzw. besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender Aufgaben gestellt würden, die für diese mit erheblichen Ausgaben verbunden seien, ohne dass hierfür im Änderungsgesetz selbst eine Kostendeckung bzw. ein finanzieller Ausgleich vorgesehen sei, übersehen sie, dass – jedenfalls zunächst – nur der bisherige Modellversuch weitergeführt werden soll (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 1 und 3). Mangels Übertragung neuer bzw. Erweiterung bestehender Aufgaben im Sinn des Art. 83 Abs. 3 Satz 1 BV kann auch keine Verpflichtung zum finanziellen Ausgleich nach Art. 83 Abs. 3 Satz 2 BV entstehen. Der neue Unterricht macht in der Einführungsphase wie bisher im Modellversuch ca. 75 Stellenkapazitäten erforderlich; die übrigen Änderungen verursachen keine Kosten bzw. werden aus Mitteln des Haushalts (z. B. der Lehrerfortbildung) abgedeckt (LT-Drs. 18/15059 S. 1), sodass die durch die Einführung des Islamischen Unterrichts entstehenden Kosten derzeit abgedeckt sind. Da Wahlpflichtfächer auch nach rein organisatorischen Kriterien von den Schulen eingerichtet werden (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 5 f.), führt dies auch nicht – jedenfalls nicht unmittelbar – zu ins Gewicht fallenden Mehraufwendungen für die Kommunen (vgl. VerfGH vom 6.7.2007 VerfGHE 60, 30/37).
cc) Im Übrigen erweisen sich die angegriffenen Regelungen weder aus formellen noch aus materiellen Gründen als offensichtlich verfassungswidrig, sodass die Erfolgsaussichten einer Popularklage allenfalls als offen anzusehen wären.
(1) Eine offensichtliche formelle Verfassungswidrigkeit folgt nicht aus der von den Antragstellern behaupteten fehlenden Beschlussfähigkeit des Landtags. Nach Art. 23 Abs. 2 BV ist zur Beschlussfähigkeit des Landtags die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich, d. h. mehr als die Hälfte der Mitglieder müssen anwesend sein (vgl. Huber in Meder/Brechmann, Die Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 23 Rn. 5), wobei auf die Anwesenheit bei der Schlussabstimmung abzustellen ist (vgl. Schweiger in Nawiasky/Schweiger/ Knöpfle, Die Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 23 Rn. 8). Maßgeblich ist dabei die verfassungsgemäße Mitgliederzahl des Landtags gemäß Art. 13 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 6 BV (Huber, a. a. O.), die derzeit einschließlich 10 Überhang- und 15 Ausgleichsmandaten 205 Abgeordnete beträgt (vgl. VerfGH vom 28.10.2019 – Vf. 74-III-18 – juris Rn. 2). Ausnahmen von diesem Quorum, die nach Art. 23 Abs. 3 BV unberührt bleiben würden, sieht die Verfassung nicht vor. Damit werden die materiellen Voraussetzungen für die Beschlussfähigkeit des Landtags – anders als im Grundgesetz für den Bundestag (vgl. dazu BVerfG vom 10.5.1977 BVerfGE 44, 308) – in der Verfassung selbst abschließend festgelegt. Daraus folgt allerdings nicht, dass die Beschlussfähigkeit des Landtags der vollen nachträglichen Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof unterliegt (Möstl in Lindner/ Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 23 Rn. 9). Vielmehr regelt § 123 Abs. 1 BayLTGeschO, dass die Beschlussfähigkeit angenommen wird, solange sie nicht von einem Mitglied des Landtags bezweifelt wird, der die Zweifel nach dem Schluss der Aussprache und vor der Abstimmung zu einem Tagesordnungspunkt geltend machen muss (§ 123 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BayLTGeschO). Doch ist umstritten, ob eine solche Regelung in der Geschäftsordnung erfolgen kann (bejahend: Huber, a. a. O., Rn. 6; verneinend dagegen wohl Schweiger, a. a. O.; zweifelnd Möstl, a. a. O.). Diese Frage ist daher als offen anzusehen.
Unabhängig davon ist vorliegend nicht substantiiert vorgetragen, dass das erforderliche Quorum verfehlt wurde. Mit der bloßen Behauptung, es sei augenscheinlich und werde als gerichtsbekannt vorausgesetzt, dass bei keiner Lesung des Gesetzentwurfs die gemäß Art. 23 Abs. 2 BV erforderliche Mehrheit der Abgeordneten anwesend gewesen sei, wird ein Verstoß gegen Art. 23 Abs. 2 BV nicht dargelegt; entsprechendes gilt für den Hinweis auf im Internet nicht (mehr) abrufbare Videoaufzeichnungen aus dem Plenum vom 20. April 2021 bzw. 6. Juli 2021. Soweit die Antragsteller darauf verweisen, dass laut Abstimmungsliste (vgl. Anlage 3 zum Plenarprotokoll 18/87) bei der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf am 6. Juli 2021 – bei einer Enthaltung – 74 Abgeordnete für und 23 gegen das Änderungsgesetz gestimmt haben, kann hieraus jedenfalls nicht zwingend geschlossen werden, dass bei der Abstimmung nur 97 (richtig: 98) Abgeordnete anwesend waren. Dass sich die anwesenden Abgeordneten auch an der Beschlussfassung beteiligen, ist nicht erforderlich (Huber in Meder/Brechmann, Die Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 23 Rn. 5); für diese kommt es nach Art. 23 Abs. 1 BV auch nicht auf die Mehrheit der Anwesenden, sondern auf die Mehrheit der abgegebenen Stimmen an. Da am 6. Juli 2021 aus Infektionsschutzgründen absprachegemäß mit hälftiger Besetzung getagt wurde (vgl. Plenarprotokoll 18/87 S. 11674), ist offen, ob weitere Abgeordnete im Plenarsaal anwesend waren, die nicht an der Abstimmung teilgenommen haben. Ein förmlicher Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 BayLTGeschO wurde vor der Schlussabstimmung jedenfalls nicht gestellt, obwohl bei der dieser unmittelbar vorangegangenen Abstimmung über den Gesetzentwurf – bei einer Enthaltung – 75 Abgeordnete für und 23 gegen das Änderungsgesetz gestimmt hatten (vgl. Anlage 2 zum Plenarprotokoll 18/87) und das Ergebnis der Abstimmung vor der Schlussabstimmung bekannt gegeben wurde (Plenarprotokoll 18/87 S. 11764). Selbst wenn man aber vom Ergebnis der Schlussabstimmung auf die Anwesenheit von lediglich 98 Abgeordneten im Plenarsaal schließen wollte, liegt angesichts der Mehrheitsverhältnisse ein Verstoß gegen das vom Schutz der „Ewigkeitsklausel“ des Art. 75 Abs. 1 Satz 2 BV umfasste Demokratieprinzip (vgl. VerfGHE 52, 104/122) fern.
(2) Die angegriffenen Regelungen verstoßen auch nicht offensichtlich gegen Grundrechte oder sonstige Verfassungsnormen.
Die Einführung des Islamischen Unterrichts gemäß Art. 47 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 BayEUG n. F., bei dem es sich nach dem Gesetzeswortlaut, der systematischen Stellung der Vorschrift im Gesetz sowie dem Sinn und Zweck der Regelung nicht um konfessionellen Religionsunterricht im Sinn des Art. 136 Abs. 2 BV, sondern um einen allgemeinen Werteunterricht in Kombination mit Islamkunde als Alternative zum Ethikunterricht gemäß Art. 47 Abs. 1 und 2 BayEUG n. F. handelt (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 4), dürfte verfassungsrechtlich grundsätzlich als zulässig anzusehen sein (vgl. de Wall in von der Decken/Günzel, Staat – Religion – Recht, FS Robbers, 2020, S. 637 ff., Kreß, Weltanschauungsrecht Aktuell Nr. 2 vom 28.6.2021, S. 1 ff.).
Der Islamische Unterricht kann jedenfalls derzeit nicht als Religionsunterricht im verfassungsrechtlichen Sinn ausgestaltet werden (vgl. Holzner, Verfassung des Freistaats Bayern, 2014, Art. 136 Rn. 12). Religionsunterricht im Sinn von Art. 7 Abs. 3 GG, Art. 136 Abs. 2, Art. 137 Abs. 1 BV ist ein konfessionell gebundener Unterricht, der unter dem Bestimmungsrecht einer Religionsgemeinschaft im Sinn einer Glaubenslehre unterrichtet wird (vgl. BVerfG vom 25.2.1987 BVerfGE 74, 244/252 f.). Im Gegensatz zu den Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften, die Partner des Staates für den katholischen, evangelischen oder jüdischen Religionsunterricht sind, erfüllt keine der in Bayern ansässigen islamischen Organisationen vollständig die Merkmale einer Religionsgemeinschaft im rechtlichen Sinn. Außerdem gehört der Großteil der muslimischen Schülerinnen und Schüler in Bayern keiner solchen Organisation an (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 4). Aus diesem Grund sollen im Islamischen Unterricht die religiösen Grundsätze und Glaubenssätze des Islam als Religionskunde, nicht als Religionslehre vermittelt und durch einen allgemeinen Werteunterricht auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Verfassung ergänzt werden, wie sie für den Ethikunterricht in Art. 47 Abs. 2 BayEUG n. F. niedergelegt sind. Eine solche Regelung ist im Grundsatz nicht zu beanstanden.
(a) Die Einführung des Islamischen Unterrichts dürfte nicht gegen Art. 136 Abs. 2, Art. 137 Abs. 1 BV verstoßen, weil es sich beim Islamischen Unterricht – wie ausgeführt – nicht um Religionsunterricht im Sinn dieser Bestimmungen, sondern um ein aliud zu einem solchen handelt (vgl. VG Wiesbaden vom 6.9.2019 NVwZ-RR 2020, 311 Rn. 40; de Wall, a. a. O., S. 641 f.; Kreß, a. a. O., S. 4). Deshalb muss der Islamische Unterricht auch nicht die Vorgaben des Art. 136 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 bis 5 BV erfüllen. Hiergegen können die Antragsteller nicht einwenden, dass es sich angesichts der Lehrpläne für den Modellversuch auch beim Islamischen Unterricht um Religionsunterricht handle, der unter dem Deckmantel eines eigenen Ethikunterrichts für Muslime unter Umgehung von Art. 136 BV eingeführt werde. Eine Berufung auf den Normvollzug durch die Exekutive kann, wie bereits ausgeführt, nicht zur Verfassungswidrigkeit einer Rechtsvorschrift führen, selbst wenn sie die Möglichkeit fehlerhafter oder missbräuchlicher Anwendung bietet (vgl. VerfGH vom 19.4.1989 VerfGHE 42, 54/60).
(b) Die Einführung des Islamischen Unterrichts dürfte auch nicht das staatliche Neutralitätsgebot gemäß Art. 142 Abs. 1 und 3 i. V. m. Art. 107 Abs. 1 und Art. 118 Abs. 1 BV verletzen. Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates verlangt keine Indifferenz in religiös-weltanschaulichen Fragen. Der Staat darf sich religiös-weltanschauliche Inhalte nur nicht derart zu eigen machen, dass er sich mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung identifiziert (vgl. VerfGH vom 7.11.1967 VerfGHE 20, 191/203; vom 15.1.2007 VerfGHE 60, 1/11). Die neutrale Vermittlung von Kenntnissen über den Islam im Rahmen eines Ethikunterrichts besonderer Prägung bedeutet keine Identifikation mit dem Islam. Ein Verstoß gegen die staatliche Neutralitätspflicht ist darin nicht zu erblicken (vgl. VG Wiesbaden NVwZ-RR 2020, 311 Rn. 40). Die neutrale Information über eine Religion ist vielmehr vom staatlichen Erziehungsauftrag gemäß Art. 130 Abs. 1 BV umfasst, der der Vermittlung der Erziehungsziele des Art. 131 BV dient, der auch die Achtung vor religiöser Überzeugung vorgibt (vgl. de Wall, a. a. O., S. 641 f.).
(c) Die Einführung des Islamischen Unterrichts dürfte auch nicht im Widerspruch zu Art. 135 Satz 2 BV stehen, wonach Schüler in öffentlichen Schulen nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen werden. Hierunter sind nicht etwa die Glaubensinhalte einzelner christlicher Bekenntnisse zu verstehen, sondern die Werte und Normen, die, vom Christentum maßgeblich geprägt, auch weitgehend zum Gemeingut des abendländischen Kulturkreises geworden sind. Ungeachtet seiner Herkunft aus dem religiösen Bereich bezeichnet der Begriff somit eine von Glaubensinhalten losgelöste, aus der Tradition der christlich-abendländischen Kultur hervorgegangene Wertewelt, die nach der Verfassung unabhängig von ihrer religiösen Fundierung Geltung beansprucht (vgl. VerfGHE 60, 1/7 m. w. N.). Besondere Bedeutung kommt insoweit dem Toleranzgebot gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen zu, wie es für den Schulbereich in Art. 136 Abs. 1 BV eine spezielle Ausprägung erfahren hat (vgl. VerfGH vom 1.8.1997 VerfGHE 50, 156/170). Dementsprechend wird der Islamische Unterricht als Werteunterricht auf der Grundlage einer am Grundgesetz und an der Verfassung orientierten Werteordnung nicht von Art. 135 Satz 2 BV untersagt.
(d) Die Einführung des Islamischen Unterrichts dürfte auch nicht Art. 137 Abs. 2 BV widersprechen, wonach für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ein Unterricht über die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit einzurichten ist. Entsprechend diesem Verfassungsgebot wurde der Ethikunterricht gemäß Art. 47 Abs. 1 und 2 BayEUG a. F. eingerichtet. Aus Art. 137 Abs. 2 BV lässt sich hingegen wohl kein Verbot entnehmen, für bestimmte Schülergruppen wie Muslime einen eigenen Ethikunterricht einzurichten, bzw. kein Gebot, für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, (nur) einen einheitlichen Ethikunterricht anzubieten, sofern auch im Islamischen Unterricht die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit vermittelt werden (vgl. de Wall, a. a. O., S. 644; a. A. Kreß, a. a. O., S. 4 f.). Letzteres dürfte aufgrund der Bezugnahme auf Art. 47 Abs. 2 BayEUG n. F. in Art. 47 Abs. 3 Satz 1 BayEUG n. F. gewährleistet sein.
(e) Die Einführung des Islamischen Unterrichts dürfte nach dem unter aa) (2) (c) Ausgeführten auch nicht zu einem Verstoß gegen Art. 118 Abs. 1 BV (i. V. m. Art. 101, 107, 126, 127, 136, 137, 142, 146 BV) führen, da infolge der Freiwilligkeit der Teilnahme am Islamischen Unterricht, der fehlenden Beschränkung auf muslimische Schülerinnen und Schüler sowie der fehlenden Vergleichbarkeit der einzelnen Schülergruppen eine willkürliche Ungleichbehandlung anderer Personen bzw. Religionsgemeinschaften weder dargelegt noch erkennbar ist. Selbst wenn man aber von einer relevanten Ungleichbehandlung ausgehen wollte, erschiene diese vor dem Hintergrund des vom Gesetzgeber verfolgten Ziels der Integration muslimischer Schülerinnen und Schüler (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 4) – mag diese Gruppe selbst auch wieder heterogen sein – grundsätzlich gerechtfertigt (vgl. BVerfG vom 31.5.2006 BayVBl 2006, 633; vom 15.3.2007 NVwZ 2008, 72/74). Die Verfassung lässt Differenzierungen zwischen einzelnen Religionen bzw. Weltanschauungen aus sachlichen Gründen zu, die durch tatsächliche Unterschiede bedingt sind (vgl. VerfGHE 50, 156/168). Entsprechendes wie für das Änderungsgesetz gilt nach dem unter aa) (2) (d) Ausgeführten auch für § 27 Abs. 8 Satz 2 und Abs. 9 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 BaySchO n. F.
(f) Die Einführung des Islamischen Unterrichts dürfte nach dem unter aa) (2) (a) und (b) Ausgeführten auch nicht gegen individuelle Freiheitsrechte von Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern (Art. 101, Art. 107, Art. 126 Abs. 1 BV) verstoßen, da keine Teilnahmepflicht besteht. Zudem schützen diese Grundrechte nicht vor neutraler Information über eine bestimmte Religion (vgl. de Wall, a. a. O., S. 646, 649). Ein Grundrechtsverstoß erwächst auch nicht aus dem Umstand, dass anderen Schülerinnen und Schülern kein entsprechendes Fach angeboten wird, da kein Anspruch auf Einrichtung eines bestimmten Schulfachs besteht. Gleiches gilt für Lehrkräfte mit Blick auf deren Berufsfreiheit (Art. 101 BV). Entsprechendes wie für das Änderungsgesetz gilt nach dem unter aa) (2) (a), (b) und (d) Ausgeführten auch für § 27 BaySchO.
(g) Die Einführung des Islamischen Unterrichts und die neutrale Information über den Islam dürfte auch nicht die kollektive Religionsfreiheit (Art. 107 Abs. 1 BV) bzw. das Selbstbestimmungsrecht (Art. 142 Abs. 2 BV) von Muslimen (vgl. de Wall, a. a. O., S. 652) verletzen.
(h) Auch ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsgebot (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV) ist nicht ersichtlich.
(aa) Das Änderungsgesetz dürfte dem Parlamentsvorbehalt genügen, weil die wesentlichen, insbesondere grundrechtsrelevanten Entscheidungen für die Einführung des Islamischen Unterrichts durch den Gesetzgeber in Art. 47 BayEUG n. F. geregelt wurden. Die Einführung oder Änderung eines wertegebundenen, insbesondere eines religiös oder weltanschaulich orientierten Unterrichts sowie die Entscheidung darüber, ob und inwieweit das Schulwesen allgemein für religiöse und weltanschauliche Bezüge geöffnet werden soll, muss durch den parlamentarischen Gesetzgeber getroffen werden (vgl. Rux, Schulrecht, 6. Aufl. 2018, Rn. 56). Nach Art. 47 Abs. 1 BayEUG n. F. sind Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, verpflichtet, entweder am Ethikunterricht oder am Islamischen Unterricht teilzunehmen. Nach Art. 47 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 BayEUG n. F. wird der Islamische Unterricht als ein Unterricht im Sinn des Art. 137 Abs. 2 BV über die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit eingerichtet, der im Hinblick auf seine Ziele dem Ethikunterricht entspricht. Er dient der Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu werteinsichtigem Urteilen und Handeln. Sein Inhalt orientiert sich an den sittlichen Grundsätzen, wie sie in der Verfassung und im Grundgesetz niedergelegt sind. Im Übrigen berücksichtigt er die Pluralität der Bekenntnisse und Weltanschauungen. Zugleich vermittelt er Wissen über die Weltreligion Islam und behandelt sie in interkultureller Sicht (Art. 47 Abs. 3 Satz 2 BayEUG n. F.).
Damit werden die grundlegenden Bildungs- und Erziehungsziele durch den Gesetzgeber formuliert. Die Wesentlichkeitstheorie und der Bestimmtheitsgrundsatz erfordern nicht, dass der Gesetzgeber die einzelnen Lerninhalte und Lernziele der einzelnen Fächer im Gesetz selbst festlegt. Sind die wesentlichen Grundfragen durch den Gesetzgeber geregelt, steht einer Delegation an den Verordnungsgeber (z. B. in der Schulordnung, vgl. Art. 89 BayEUG) oder einer Regelung durch Verwaltungsvorschrift (z. B. in Lehrplänen, vgl. Art. 45 BayEUG) in den hierfür allgemein bestehenden verfassungsrechtlichen Grenzen nichts entgegen (vgl. VerfGH vom 27.3.1980 VerfGHE 33, 33/36 f.; vom 4.11.1982 VerfGHE 35, 126/131 f.; vom 21.5.2014 VerfGHE 67, 133 Rn. 35; VerfGHE 70, 69 Rn. 23). Die fachlichen Details des Islamischen Unterrichts konnte der Gesetzgeber deshalb den Lehrplänen überlassen, um der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte genügend Raum zu geben. Er war auch nicht gehindert, Art. 47 BayEUG n. F. lediglich ergänzende Regelungen wie § 27 Abs. 3 Satz 4 sowie Abs. 8 Sätze 2 und 3 BaySchO zur An- und Abmeldung, zur Mindestteilnehmerzahl sowie zur Einrichtung neben dem Ethikunterricht dem Verordnungsgeber zu überlassen (vgl. VerfGHE 33, 33/38). Denn diese betreffen allein die nähere Ausgestaltung sowie den praktischen Vollzug des Islamischen Unterrichts im Verhältnis zum Religions- und Ethikunterricht und nicht die grundlegende Festlegung, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, verpflichtet sind, entweder am Ethikunterricht oder am Islamischen Unterricht teilzunehmen, der im Einzelnen nach den o. g. gesetzlichen Maßgaben zu gestalten ist. Hinsichtlich der Detailregelungen ist ein Gesetz im formellen Sinn auch nicht sinnvoll, weil die schulorganisatorische Ausgestaltung des Islamischen Unterrichts an öffentlichen Schulen im Wege der Rechtsverordnung durch das zuständige Staatsministerium bestimmt werden kann (vgl. VerfGHE 67, 133 Rn. 35).
(bb) Die Änderungsverordnung dürfte sich auf eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage stützen und sich im Rahmen dieser Ermächtigung halten (vgl. Art. 55 Nr. 2 Satz 3 BV). Rechtsverordnungen, die über den Rahmen einer Ausführungsverordnung (vgl. Art. 55 Nr. 2 Satz 2 BV) hinausgehen, bedürfen einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung. Das Rechtsstaatsprinzip gebietet, dass eine Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung hinreichend bestimmt sein muss (VerfGHE 33, 33/38; VerfGHE 67, 133 Rn. 35). Das Ausmaß der notwendigen Bestimmtheit ist dabei von den Besonderheiten des jeweiligen Regelungsgegenstandes sowie der Intensität der Maßnahme abhängig (VerfGHE 67, 133 Rn. 36). Soweit es sich dabei nicht um bloße Ausführungsverordnungen im Sinn des Art. 55 Nr. 2 Satz 2 Alt. 1 BV handelt, was jedenfalls hinsichtlich § 27 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 8 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 und 5 BaySchO n. F. naheliegt, dürfte eine hinreichende gesetzliche Ermächtigung zur Regelung der Teilnahme (auch der Mindesteilnehmerzahl) am sowie zur An- und Abmeldung zum bzw. vom Islamischen Unterricht vorliegen und sich § 27 Abs. 8 Sätze 2 und 3, Abs. 9 BaySchO n. F. in deren Rahmen halten. So kommt es in Betracht, dass die genannten Regelungen auf Art. 46 Abs. 4 Satz 3 BayEUG gestützt werden können. Zwar regelt dieser nur die Teilnahme und die Abmeldung vom Religionsunterricht, doch liegt es nahe, dass wegen des engen Sachzusammenhangs mit Art. 47 Abs. 1 BayEUG n. F. von der Ermächtigung nach deren erkennbarem Sinn und Zweck auch komplementäre Regelungen zur Teilnahme am Ethik- bzw. Islamischen Unterricht erfasst sind, weil die Abmeldung vom Religionsunterricht nach Art. 47 Abs. 1 BayEUG n. F. die Anmeldung zum Ethik- bzw. Islamischen Unterricht bedingt. Dabei können auch Regelungen über weitere schulorganisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Teilnahme bzw. der Abmeldung vom Religionsunterricht getroffen werden (vgl. Lindner/Stahl, Das Schulrecht in Bayern, Art. 46 BayEUG Rn. 17). Daneben kommt als Ermächtigungsgrundlage Art. 89 Abs. 1 Sätze 1 und 3 Nr. 3 BayEUG in Betracht, wonach insbesondere die Teilnahmepflicht an einzelnen Fächern (vgl. BayVGH vom 21.6.1982 BayVBl 1982, 562/563 f.) sowie Vorschriften über die Mindestteilnehmerzahl geregelt werden können (vgl. VerfGHE 35, 126/132).
(cc) Soweit die Antragsteller einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsgebot in Form des Grundsatzes der Normenklarheit bzw. des Transparenzgebots rügen, weil mit dem Islamischen Unterricht unter dem Deckmantel eines Werteunterrichts ein konfessioneller Unterricht angeboten werde, trifft dies nach dem unter (2) (a) Ausgeführten nicht zu.
(i) Schließlich ist auch nicht davon auszugehen, dass ein offensichtlicher Verstoß gegen Art. 83 Abs. 7 Satz 1 BV vorliegt. Nach Angaben der Staatsregierung wurden die kommunalen Spitzenverbände vor Erlass des Änderungsgesetzes bzw. der Änderungsverordnung angehört. Ob dies in der gebotenen Form erfolgte, ist offen. Jedenfalls dürfte es sich bei Art. 83 Abs. 7 Satz 1 BV („Die kommunalen Spitzenverbände sollen rechtzeitig gehört werden, bevor durch Gesetz oder Rechtsverordnung Angelegenheiten geregelt werden, welche die Gemeinden oder Gemeindeverbände berühren“) um eine bloße Ordnungsvorschrift handeln, deren Verletzung nicht zur Nichtigkeit der Norm führt (vgl. Lindner in Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 83 Rn. 141).
dd) Über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist deshalb nach Maßgabe einer Folgenabwägung zu entscheiden. Diese ergibt, dass die Nachteile, die eintreten würden, wenn die beantragte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Popularklage aber der Erfolg zu versagen wäre, gegenüber den Nachteilen überwiegen, die zu erwarten wären, wenn die einstweilige Anordnung nicht erginge, die Popularklage aber Erfolg hätte. Deshalb ist dem öffentlichen Interesse am vorläufigen Vollzug der angegriffenen Normen – klar – der Vorrang einzuräumen und die beantragte einstweilige Anordnung nicht zu erlassen.
Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass auch im Fall eines Erfolgs der Popularklage durch die Abweisung des Eilantrags kein irreversibler Schaden entstünde. Denn die mit der Einführung des Islamischen Unterrichts verbundenen Auswirkungen auf den Schulbetrieb könnten ohne Weiteres wieder rückgängig gemacht werden. Der Ethikunterricht sowie der Islamische Unterricht als alternative Formen des Unterrichts über die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit im Sinn des Art. 137 Abs. 2 BV decken sich in weiten Teilen und sind gegenseitig anschlussfähig, sodass auch im Fall einer Stattgabe im Hauptsacheverfahren Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Teilnahme am Islamischen Unterricht entschieden haben, ohne größere Schwierigkeiten, wenn auch möglicherweise nicht völlig reibungslos, wieder in den Ethikunterricht als der gewohnten Unterrichtsform zurückwechseln könnten (vgl. BVerfG vom 21.12.1976 BVerfGE 43, 198/201 f.). Die Möglichkeit, dass sie zunächst den Islamischen Unterricht besuchen würden, aber ggf. nach Monaten oder gar Jahren in den Ethikunterricht zurückkehren müssten, stellt ersichtlich keinen schweren Nachteil im Sinn des Art. 26 Abs. 1 VfGHG dar (vgl. BVerfG vom 24.2.1954 BVerfGE 3, 267/286 f.). Etwaigen Härten könnte damit begegnet werden, dass ein Wechsel zum Ende des laufenden Schuljahres erfolgte. Zudem bestünden für die für das Fach Islamischer Unterricht vorgesehenen Lehrkräfte auch im Fall eines Erfolgs in der Hauptsache alternative Verwendungsmöglichkeiten, sodass ihrer Vergütung bzw. Besoldung eine entsprechende Arbeits- bzw. Dienstleistung gegenüberstünde.
Die von den Antragstellern behaupteten finanziellen Schäden für die Kommunen als Schul(aufwands) träger sind nicht zu befürchten, weil – wie unter bb) (2) ausgeführt – zunächst nur der bisherige Modellversuch fortgeführt werden soll und durch die Einführung des Wahlpflichtfachs Islamischer Unterricht auch keine ins Gewicht fallenden Mehraufwendungen für die Kommunen anfallen. So ist nicht zu erwarten, dass durch die Einführung des Islamischen Unterrichts wesentlicher zusätzlicher Raumbedarf entsteht, da vorhandene Schulräume mitgenutzt werden können (vgl. BVerfGE 3, 267/285); Aufwendungen für die Anschaffung neuer Schulbücher sind im Rahmen des laufenden Bedarfs zu berücksichtigen. Zusätzliche Kosten für die Ausbildung und Alimentierung neuer Lehrer für den Islamunterricht würden nicht entstehen, da hierfür bereits vorhandene Lehrkräfte eingesetzt werden (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 1). Eine tatsächliche Einschränkung des Ethikunterrichts durch Einführung des Islamischen Unterrichts kann nicht eintreten, da dieser nach § 27 Abs. 8 Satz 3 BaySchO nur eingerichtet werden kann, wo auch Ethikunterricht eingerichtet ist.
Würde die einstweilige Anordnung hingegen erlassen, würde sich auch bei einer nachfolgenden Abweisung der Popularklage die Einführung des Islamischen Unterrichts auf absehbare Zeit verzögern. Der mit der Einführung eines auf Muslime zugeschnittenen Ethikunterrichts – der, wie der Modellversuch zeigt, bei diesen offenbar eine hohe Akzeptanz genießt (vgl. LT-Drs. 18/15059 S. 3) – verfolgte Zweck der (Förderung der) Integration muslimischer Schülerinnen und Schüler könnte dann vom Gesetzgeber nur mit erheblicher Verspätung umgesetzt werden (vgl. BVerfG vom 22.7.1970 BVerfGE 29, 120/125).
Die strengen Voraussetzungen für den von der Antragstellerin begehrten erheblichen Eingriff des Verfassungsgerichtshofs in die originäre Zuständigkeit des Gesetzgebers und auch des Verordnungsgebers liegen daher eindeutig nicht vor.
V.
Die Verfahren sind kostenfrei (Art. 27 Abs. 1 Satz 1 VfGHG).