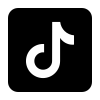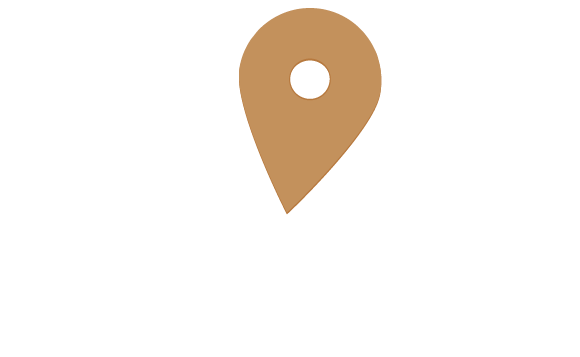Aktenzeichen B 7 K 17.32465
AufenthG § 11 Abs. 1, § 60 Abs. 7, § 60a Abs. 2c
RL 2011/95/EG Art. 4 Abs. 4
Leitsatz
1 Nach einhelliger Auskunftslage finden seitens der äthiopischen Armee keine Zwangsrekrutierungen von Kindern statt; dies gilt auch für die Somali-Region. Auch eine Zwangsrekrutierung durch die Liyu-Police ist unwahrscheinlich. (Rn. 40 und 41) (redaktioneller Leitsatz)
2 In Äthiopien besteht kein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt; auch in der Somali-Region trotz vereinzelter Unruhen nicht. (Rn. 48) (redaktioneller Leitsatz)
3 Für einen jungen und erwerbsfähigen Mann besteht trotz der schlechten humanitären Verhältnisse in Äthiopien kein Abschiebungsverbot, zumal wenn er auf einen Familienverband zurückgreifen kann. (Rn. 51) (redaktioneller Leitsatz)
4 Psychische Erkrankungen – grundsätzlich auch eine PTBS – sind in Äthiopien behandelbar. Psychiatrische Behandlungen werden in mehreren Krankenhäusern in Addis Abeba angeboten. Über die Beantragung einer Armutskarte bei der Heimatgemeinde kann die Finanzierung der Behandlung über den Staat erreicht werden. (Rn. 62 und 63) (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Der Kläger trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens.
3. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Gründe
Die zulässige Klage bleibt ohne Erfolg. Der Kläger hat im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 AsylG) weder einen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG noch einen Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigter. Die Zuerkennung des subsidiären Schutzes nach § 4 AsylG scheidet ebenfalls aus. Es liegen auch keine Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 Satz 1 AufenthG vor. Die Abschiebungsandrohung sowie die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes sind nicht zu beanstanden. Der angefochtene Bescheid ist somit rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO).
1. Die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 AsylG liegen nicht vor.
Nach § 3 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 AsylG besteht ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft dann, wenn sich der Ausländer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will und er keine Ausschlusstatbestände erfüllt. Eine solche Verfolgung kann nicht nur vom Staat ausgehen (§ 3c Nr. 1 AsylG), sondern auch von Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen (§ 3c Nr. 2 AsylG) oder nicht staatlichen Akteuren, sofern die in Nrn. 1 und 2 genannten Akteure einschl. internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, im Sinne des § 3d AsylG Schutz vor Verfolgung zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht (§ 3c Nr. 3 AsylG). Allerdings wird dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt, wenn er in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylG hat und sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt (§ 3e Abs. 1 AsylG).
Für die richterliche Überzeugungsbildung im Sinne von § 108 Abs. 1 VwGO gilt Folgendes:
Das Gericht muss sich die volle Überzeugung von der Wahrheit des behaupteten Verfolgungsschicksals und der Wahrscheinlichkeit der Verfolgungsgefahr bilden. Eine bloße Glaubhaftmachung in der Gestalt, dass der Vortrag lediglich wahrscheinlich sein muss ist nicht ausreichend (vgl. grundlegend BVerwG, U.v. 16.4.1985 – 9 C 109.84 – juris). Es ist vielmehr der asylrechtliche Prognosemaßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit zu Grunde zu legen. Der Wahrscheinlichkeitsmaßstab setzt voraus, dass bei einer zusammenfassenden Würdigung des zur Prüfung gestellten Lebenssachverhaltes die für eine Verfolgung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht besitzen und deshalb gegenüber den dagegen sprechenden Tatsachen überwiegen. Dabei ist eine „qualifizierende“ Betrachtungsweise im Sinne einer Gewichtung und Abwägung aller festgestellten Umstände und ihrer Bedeutung anzulegen. Hierbei darf das Gericht jedoch hinsichtlich der Vorgänge im Verfolgerland, die zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder der Feststellung eines Abschiebungsverbotes führen sollen, keine unerfüllbaren Beweisanforderungen stellen, sondern muss sich in tatsächlich zweifelhaften Fragen mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit begnügen, auch wenn Zweifel nicht völlig auszuschließen sind (BVerwG, U.v. 16.4.1985 a.a.O.). Es kommt darauf an, ob in Anbetracht dieser Umstände bei einem vernünftig denkenden, besonnenen Menschen in der Lage des Betroffenen Furcht vor Verfolgung hervorgerufen werden kann (vgl. BVerwG, U.v. 20.2.2013 – 10 C 23/12 – juris; VG Augsburg, U.v. 11.7.2016 – Au 5 K 16.30604 – juris).
Nach Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 2011/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 ist hierbei die Tatsache, dass ein Kläger bereits verfolgt wurde oder einen sonstigen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden unmittelbar bedroht war, ein ernsthafter Hinweise darauf, dass die Furcht des Klägers vor Verfolgung begründet ist bzw. dass er tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden, es sei denn, stichhaltige Gründe sprechen dagegen, dass der Kläger erneut von solcher Verfolgung und einem solchen Schaden bedroht wird. Diese Regelung privilegiert den von ihr erfassten Personenkreis bei einer Vorverfolgung durch eine Beweiserleichterung, nicht aber durch einen herabgestuften Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Die Vorschrift begründet für die von ihr begünstigten Kläger eine widerlegbare Vermutung dafür, dass sie erneut von einem ernsthaften Schaden bei einer Rückkehr in ihr Heimatland bedroht werden. Dadurch wird der Kläger, der bereits einen ernsthaften Schaden erlitten hat oder von einem solchen Schaden unmittelbar bedroht war, von der Notwendigkeit entlastet, stichhaltige Gründe dafür darzulegen, dass sich die einen solchen Schaden begründenden Umstände bei Rückkehr in sein Herkunftsland erneut realisieren werden.
Als vorverfolgt gilt ein Schutzsuchender dann, wenn er aus einer durch eine eingetretene oder unmittelbar bevorstehende politische Verfolgung hervorgerufenen ausweglosen Lage geflohen ist. Die Ausreise muss das objektive äußere Erscheinungsbild einer unter dem Druck dieser Verfolgung stattfindenden Flucht aufweisen. Das auf dem Zufluchtsgedanken beruhende Asyl- und Flüchtlingsrecht setzt daher grundsätzlich einen nahen zeitlichen (Kausal-) Zusammenhang zwischen der Verfolgung und der Ausreise voraus. Es obliegt aber dem Schutzsuchenden, sein Verfolgungsschicksal glaubhaft zur Überzeugung des Gerichts darzulegen. Er muss daher die in seine Sphäre fallenden Ereignisse, insbesondere seine persönlichen Erlebnisse, in einer Art und Weise schildern, die geeignet ist, seinen geltend gemachten Anspruch lückenlos zu tragen. Dazu bedarf es – unter Angabe genauer Einzelheiten – einer stimmigen Schilderung des Sachverhalts. Daran fehlt es in der Regel, wenn der Schutzsuchende im Lauf des Verfahrens unterschiedliche Angaben macht und sein Vorbringen nicht auflösbare Widersprüche enthält, wenn seine Darstellungen nach der Lebenserfahrung oder auf Grund der Kenntnis entsprechender vergleichbarer Geschehensabläufe nicht nachvollziehbar erscheinen, und auch dann, wenn er sein Vorbringen im Laufe des Verfahrens steigert, insbesondere wenn er Tatsachen, die er für sein Begehren als maßgeblich bezeichnet, ohne vernünftige Erklärung erst sehr spät in das Verfahren einführt (VGH BW, U.v. 27.8.2013 – A 12 S 2023/11 – juris; HessVGH, U.v. 4.9.2014 – 8 A 2434/11.A – juris).
Gemessen an diesen Maßstäben hat der Kläger eine an den Merkmalen des § 3 Abs. 1 AsylG ausgerichtete Verfolgung nicht glaubhaft gemacht. Das Gericht folgt diesbezüglich zunächst vollumfänglich den Ausführungen im angefochtenen Bescheid (§ 77 Abs. 2 AsylG).
Selbst unter Berücksichtigung der Schilderungen des Klägers im Klageverfahren besteht kein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft.
Die Ausführungen des Klägers sind – außerhalb des offensichtlich auswendig Gelernten – in den entscheidenden Punkten vage, detailarm und darüber hinaus von Widersprüchlichkeiten und Steigerungen geprägt. Das Gericht schenkt daher der Fluchtgeschichte des Klägers keinen Glauben.
a) Widersprüchlich sind bereits die klägerischen Ausführungen zu den „Beispielen“ von zwei Männern aus seiner Stadt, die sich ebenfalls dem Militär verweigerten. Mit Schriftsatz vom 03.08.2017 ließ der Kläger durch seinen Bevollmächtigten vortragen, sein etwa 35 Jahre alter Nachbar sei von der Armee nach Saudi-Arabien geflüchtet. Als er nach Äthiopien abgeschoben worden sei, habe man ihn verhaftet. Nach drei Tagen habe das Militär den Mann erschossen. Ferner kenne er einen weiteren, ebenfalls etwa 35 Jahre alten Mann namens … Dieser habe sich geweigert, zum Militär zu gehen. Daraufhin habe ihn das Militär die linke Hand bis zum Ellenbogen abgehackt, was der Kläger mit eigenen Augen gesehen habe.
In der mündlichen Verhandlung erklärte der Kläger hingegen dem Gericht, der Mann namens … sei vom Militär getötet worden, weil er sich geweigert habe, zum Militär zu gehen. Er wisse jedoch nicht genau, wie der Mann getötet worden sei. Auf Vorhalt des Gerichts, wonach schriftsätzlich vorgetragen worden sei, man habe dem Mann die linke Hand abgehackt, flüchtete sich der Kläger lediglich in Ausreden und erklärte dem Gericht, die Frau des Getöteten habe ihm berichtet, dass man ihren Mann zunächst den Ellenbogen abgehackt und ihn anschließend getötet habe. Im Rahmen weiterer Nachfragen „ruderte“ der Kläger dann zurück und erklärte, er wisse nicht, ob dem Nachbarn nur der Ellenbogen abgehackt worden sei und ob er daran verstorben sei, oder ob der Nachbar zusätzlich erschossen oder erstochen worden sei. Mit dieser Aussage hat der Kläger nach Überzeugung des Gerichts lediglich auf den Vorhalt des Gerichts reagiert und in nichtglaubhafter Weise versucht, den unstimmigen und gesteigerten Sachvortrag in der mündlichen Verhandlung zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass der Kläger mit Schriftsatz vom 03.08.2017 noch vortragen hat lassen, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie … die linke Hand bis zum Ellenbogen abgehackt worden sei. Dem Gericht erklärte er jedoch, (nur) die Frau des Getöteten habe ihm berichtet, dass der Ellenbogen des Mannes abgehackt worden sei. Demnach war der Kläger offensichtlich bei der (erfundenen) Misshandlung des Mannes gar nicht zugegeben.
Konfrontiert mit dem zweiten schriftsätzlich vorgebrachten Schicksal eines Mannes, der sich der Armee entzogen haben soll, konnte der Kläger überhaupt keine weitergehenden und zielführenden Angaben machen. Er erklärte lediglich, er habe den Mann gekannt, wisse aber nicht, wann dieser ungefähr erschossen worden sei. Stattdessen flüchtete sich der Kläger in Allgemeinheiten und trug vor, er kenne das Schicksal vieler Männer, die nicht zum Militär gewollt hätten. Auch die Angaben zum Alter dieses zweiten Mannes sind grob widersprüchlich. Schriftsätzlich ließ der Kläger noch vortragen, dieser Mann, der erschossen worden sei, sei etwa 35 Jahre alt gewesen. Nach Ausführungen in der mündlichen Verhandlung hat es sich aber um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann gehandelt.
Das Gericht ist daher überzeugt, dass die geschilderten Beispiele frei erfunden sind um den behaupteten Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wegen einer drohenden Zwangsrekrutierung Nachdruck zu verleihen.
b) Weiterhin hat der Kläger seinen Sachvortrag in unglaubwürdiger Weise gesteigert. Im mit Schriftsatz vom 16.08.2018 vorgelegten nervenärztlichen Attests vom 14.08.2018 ist nunmehr die Rede davon, dass der Kläger – nach der Flucht aus Äthiopien – im Sudan erneut für zwei Wochen inhaftiert worden sei. Von einer Inhaftierung im Sudan nach der Ausreise aus Äthiopien war bis zur Vorlage des ärztlichen Attestes unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung niemals die Rede. Der Kläger erklärte beim Bundesamt lediglich, er sei in den Sudan ausgereist, dort in das Dorf Qadarif gegangen und von dort weiter in die Hauptstadt Khartum. Wäre der Kläger tatsächlich erneut für einen Zeitraum von zwei Wochen inhaftiert gewesen, wäre zu erwarten gewesen, dass dieser essentielle Teil der Fluchtgeschichte bereits beim Bundesamt Erwähnung gefunden hätte. Der Kläger konnte dem Gericht auch nicht plausibel darlegen, warum er die Inhaftierung im Sudan nicht erwähnt hat. Er rechtfertigte sich auch insoweit nur mit gerichtsbekannten Ausreden und erklärte, er sei nicht danach gefragt worden. Deswegen habe er sich dazu auch nicht geäußert. Diese Einlassung ist in keiner Weise nachvollziehbar und glaubhaft, da der Kläger aufgefordert wurde, alle relevanten Tatsachen darzulegen und letztlich sogar dafür unterschrieben hat, dass er ausreichend Gelegenheit hatte, die Gründe für seinen Asylantrag zu schildern. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass der Kläger mit der Schilderung einer weiteren Inhaftierung gegenüber der Nervenärztin die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung vorantreiben wollte.
c) Nicht glaubwürdig sind ferner die klägerischen Einlassungen in der mündlichen Verhandlung, er verfüge in Äthiopien über keinerlei Verwandtschaft mehr. Er trug gegenüber dem Gericht vor, seine Mutter und seine Geschwister seien nach Somalia geflüchtet. Er habe keinen Kontakt zur Kernfamilie mehr. Auch über eine Großfamilie verfüge er in Äthiopien nicht. Seine Mutter habe nur eine Schwester gehabt. Diese Tante sei in Schweden. Sei mittlerweile verstorbener Vater habe keine Geschwister gehabt. Der Vortrag, dass der Kläger – mit Ausnahme einer Tante in Schweden – über keinerlei Onkel und Tanten verfügt, liegt außerhalb jeglicher Lebenserfahrung. Gerade in afrikanischen Ländern kann regelmäßig auf eine sehr umfangreiche Großfamilie zurückgegriffen werden. Dass der Vater ein Einzelkind gewesen sein soll und die Mutter lediglich eine Schwester hat, erscheint dem Gericht – im Hinblick auf die bekannten äthiopischen Familienstrukturen und in Anbetracht des Gesamteindruckes vom klägerischen Auftreten in der mündlichen Verhandlung – nicht glaubwürdig.
d) Letztlich hat der Kläger nicht glaubhaft gegenüber dem Gericht darlegen können, dass er am 23.08.2013 festgenommen worden sei, um als Kindersoldat für die äthiopische Armee rekrutiert zu werden. Der Kläger bestätigte dem Gericht in der mündlichen Verhandlung mehrmals, dass er von der staatlichen Armee Äthiopiens aus der Schule abgeholt und gefoltert worden sei, damit er seine Zustimmung zum Eintritt in die äthiopische Armee gebe. Nach eigenen Angaben in der mündlichen Verhandlung habe man ihn mit dem Ziel zum Soldaten ausbilden wollen, dass er von der äthiopischen Armee in ganz Äthiopien hätte eingesetzt werden können. Nachdem er die Folter nicht mehr ertragen habe, habe er zwangsweise unterschrieben und sei dann zur Absolvierung des Trainingsprogramms in eine sehr große Kaserne der staatlichen äthiopischen Armee in Jigjija gebracht worden.
Nach einhelliger Auskunftslage finden jedoch seitens der staatlichen äthiopischen Armee keine Zwangsrekrutierungen von Kindern statt. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass die äthiopische Armee versucht hat, den damals 15 Jahre alten Kläger zwangsweise zu rekrutieren. In Äthiopien gibt es bereits seit den 1990er Jahren keine Wehrpflicht mehr. Die äthiopische Armee ist eine Freiwilligenarmee. Das Mindestalter für den (freiwilligen) Eintritt ist 18 Jahre (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Äthiopien vom 22.03.2018, S. 17; siehe auch: Auswärtiges Amt, Auskunft an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vom 29.06.2018 – Gz.: 508-516-80/50791; vgl. https://de.connection-ev.org/article-139). Zwar bestehen gewisse Anhaltspunkte dafür, dass während des äthiopisch-eritreischen Krieges Anfang der 2000er Jahre – trotz Abschaffung der Wehrpflicht – noch Zwangsrekrutierungen – auch von Kindern – stattgefunden haben. Jedenfalls in den letzten Jahren bzw. im letzten Jahrzehnt ist nicht ersichtlich, dass seitens der staatlichen äthiopischen Armee noch Zwangsrekrutierungen von Kindern vorgenommen worden sind. In der Somali-Region, der Heimatregion des Klägers, gibt bzw. gab es allenfalls Hinweise auf Zwangsrekrutierungen durch die sogenannte Liyu-Police. Bei der Liyu-Police handelt es sich um eine „Somali-Sonderpolizei“, die vom der äthiopischen Staat mit schweren Waffen und technischen Gerät ausgestattet wird bzw. wurde, um ONLF-Kämpfer aufzuspüren, von der Bevölkerung zu isolieren und die ONLF zu besiegen. Durch den Einsatz der Liyu-Police wurde die ONLF bis 2010 weitgehend dezimiert und damit ihre Kapazität für größere Kampfaktionen zerschlagen (vgl. Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 15.11.2017 zu Äthiopien: Zwangsrekrutierungen durch die Liyu-Police und lokale Milizen in der Somali-Region, S. 3). Die Schweizer Flüchtlingshilfe verweist in der vorstehenden Auskunft auf verschiedene Quellen, die teilweise davon ausgehen, dass selbst die Liyu-Police keine Zwangsrekrutierungen durchgeführt hat. Andererseits zitiert die Schweizer Flüchtlingshilfe auch Quellen, die von Zwangsrekrutierungen durch die Liyu-Police mittels Druck auf Häftlinge berichten. Der Auskunft der Schweizer Flüchtlingshilfe vom 15.11.2017 ist aber zugleich zu entnehmen, dass die Liyu-Police in der Somali-Region derzeit nicht auf Rekrutierungen im großen Rahmen angewiesen ist, da die ONLF dezimiert ist (vgl. SFH a.a.O., S. 9). In Anbetracht der aktuellen politischen Entwicklungen im Frühjahr und Sommer 2018, sind nach Auffassung des Gerichts Zwangsrekrutierungen – selbst durch die Liyu-Police – noch unwahrscheinlicher geworden, da das äthiopische Parlament am 05.07.2018 die Einstufung der ONLF als terroristische Organisation aufgehoben hat und daher ein verstärkter Einsatz bzw. ein erhöhter Personalbedarf der Liyu-Police mit dem Ziel, die ONLF zu bekämpfen, nicht mehr ersichtlich ist (vgl. auch VG Bayreuth, U.v. 23.08.2018 – B 7 K 17.32608 – juris).
Nachdem nicht einmal Zwangsrekrutierungen durch die Liyu-Police im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 AsylG) beachtlich wahrscheinlich sind, gilt dies erst-recht für Zwangsrekrutierungen durch die staatliche äthiopische Armee. Dem steht auch die Einlassung des Klägers in der mündlichen Verhandlung, in der Somali-Region sei es anders als im übrigen Land, da es dort Probleme mit der ONLF gebe und daher müsse das äthiopische Militär weiterhin auf Zwangsrekrutierungen zurückgreifen, nicht entgegen. Zum einen ist – wie bereits ausgeführt – die ONLF weitgehend dezimiert. Zum anderen wurde zwischenzeitlich die Einstufung der ONLF als terroristische Vereinigung aufgehoben. Letztlich ergeben sich auch nach Auskunftslage keinerlei Hinweise darauf, dass von der äthiopischen Armee in der Somali-Region in jüngerer Vergangenheit noch Zwangsrekrutierungen durchgeführt worden sind.
In diesem Zusammenhang weist das Gericht nochmals darauf hin, dass der Kläger in der mündlichen Verhandlung mehrmals befragt wurde, ob die geschilderten Zwangsmaßnahmen von der Liyu-Police ausgegangen seien. Der Kläger erklärte dem Gericht ausdrücklich und wiederholt, es sei eine Zwangsrekrutierung durch die staatliche Armee gewesen. Er kenne zwar die Liyu-Police, habe zu dieser aber in Äthiopien keinen Kontakt gehabt.
Der Kläger hat daher nicht glaubhaft zur Überzeugung des Gerichts dargelegt, dass ihm eine Zwangsrekrutierung durch das äthiopische Militär droht.
e) Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass dem Kläger unter keinem Gesichtspunkt ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zusteht.
2. Dem Kläger steht auch kein Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigter nach Art. 16a Abs. 1 GG zu, da nicht einmal die weitergefassten Voraussetzungen für die Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes nach § 3 AsylG vorliegen.
3. Dem Kläger steht kein Anspruch auf subsidiären Schutz gem. § 4 AsylG zu. Er kann sich weder auf § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 AsylG noch auf § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG berufen.
a) Es gibt – insbesondere im Hinblick auf die obigen Ausführungen zum Flüchtlingsschutz – keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass dem Kläger bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland ein ernsthafter Schaden (Todesstrafe, Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung) im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 AsylG droht.
b) Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf subsidiären Schutz nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3. Nach dieser Vorschrift gilt als ernsthafter Schaden im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 AsylG eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. Der Begriff des internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konfliktes in § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG ist unter Berücksichtigung des humanitären Völkerrechts auszulegen (vgl. BVerwG, U.v. 24.6.2008 – 10 C 43/07 – juris). Danach müssen die Kampfhandlungen von einer Qualität sein, wie sie unter anderem für Bürgerkriegssituationen kennzeichnend sind und über innere Unruhen und Spannungen, wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten und ähnliche Handlungen, hinausgehen. Bei innerstaatlichen Krisen, die zwischen diesen beiden Erscheinungsformen liegen, scheidet die Annahme eines bewaffneten Konfliktes im Sinne des Art. 15 c QualRL nicht von vornherein aus. Der Konflikt muss aber jedenfalls ein bestimmtes Maß an Intensität und Dauerhaftigkeit aufweisen, wie sie typischerweise in Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Guerillakämpfen zu finden sind. Ein solcher innerstaatlicher bewaffneter Konflikt kann landesweit oder regional bestehen und muss sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstrecken (vgl. BVerwG, U.v. 24.6.2008 a.a.O.). Der Grad willkürlicher Gewalt, der vorliegen muss, kann aber umso geringer sein, je mehr der Schutzsuchende möglicherweise belegen kann, dass er aufgrund von in seiner persönlichen Situation liegenden Umständen spezifisch betroffen ist (vgl. EuGH, U.v. 17.2.2009 – C-465.7 – juris).
Ein innerstaatlicher Konflikt im obigen Sinne ist im Herkunftsland des Klägers nicht ersichtlich (vgl. nur VG Ansbach, U.v. 19.9.2017 – AN 3 K 16.30505 – juris; VG Ansbach, U.v. 14.2.2018 – AN 3 K 16.31836 – juris; VG Bayreuth, U.v. 6.3.2018 – B 7 K 17.32889 – juris). Das Gericht verkennt dabei nicht, dass es insbesondere in der Somali-Region zu vereinzelten Unruhen kommt. Diese Gewaltakte erreichen aber schon im Ansatz nicht das für eine Schutzgewährung hohe Niveau, demzufolge jedem Kläger allein wegen seiner Anwesenheit in dieser Region Schutz nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG zu gewähren ist. Es sind auch keine besonderen, in der Person des Klägers liegenden, Umstände ersichtlich, die auf eine erhöhte Gefährdung im Verhältnis zu sonstigen Angehörigen der Zivilbevölkerung schließen lassen (vgl. auch VG Bayreuth, U.v. 23.08.2018 – B 7 K 17.32608 – juris).
4. Nationale Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 AufenthG oder § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG sind ebenfalls nicht gegeben. Insoweit wird zunächst auf den streitgegenständlichen Bescheid Bezug genommen (§ 77 Abs. 2 VwGO).
a) Hervorzuheben ist insbesondere, dass eine Abschiebung trotz schlechter humanitärer Verhältnisse nur in sehr außergewöhnlichen Einzelfällen als unmenschliche oder erniedrigende Behandlung bewertet werden kann und die Voraussetzung des § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK erfüllt. Die derzeitigen humanitären Bedingungen in Äthiopien führen nicht zu der Annahme, dass bei einer Abschiebung des Klägers eine Verletzung des Art. 3 EMRK vorliegt. Der Kläger ist jung, gesund und erwerbsfähig. Er hat in Äthiopien acht Jahre die Schule besucht und daher zumindest eine gewisse Grundbildung. Es ist ihm zumutbar, in Äthiopien sämtlichen Tätigkeiten, auch schlichten Hilfstätigkeiten, nachzugehen. Warum der Kläger eine solche Beschäftigung bei einer Rückkehr nach Äthiopien nicht erlangen könnte, ist weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich. Daneben kann der Kläger im Bedarfsfall auf Unterstützung im Rahmen des Familienverbundes zurückgreifen. Der Kläger erklärte dem Gericht, eine Tante in Schweden habe ihn bereits bei der Ausreise unterstützt und einen hohen Geldbetrag zusammengesammelt. Es ist nicht ersichtlich, dass sich der Kläger in einer Notsituation nicht wieder an die Tante halten könnte, die ihn – selbst von Schweden aus – mit finanziellen Mitteln unterstützen kann. Darüber hinaus schenkt das Gericht – wie bereits ausgeführt – der klägerischen Einlassung, er habe in Äthiopien keinerlei Verwandte mehr, keinen Glauben. Die hohen Voraussetzungen für die Feststellung eines zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 5 AufenthG sind somit schon im Ansatz nicht erfüllt.
b) Dem Kläger droht auch wegen seines Gesundheitszustandes keine individuelle Gefahr für Leib oder Leben, die zur Feststellung eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG führen würde.
aa) Gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Nach der Rechtsprechung ist die Gefahr, dass sich eine Erkrankung des Ausländers aufgrund der Verhältnisse im Abschiebezielstaat verschlimmert, in der Regel als individuelle Gefahr einzustufen, die am Maßstab von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu prüfen ist (vgl. BVerwG, U.v. 17.10.2006 – 1 C 18/05 – juris). Dabei erfasst diese Regelung nur solche Gefahren, die in den spezifischen Verhältnissen im Zielstaat begründet sind, während Gefahren, die sich aus der Abschiebung als solche ergeben, nur von der Ausländerbehörde als inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis berücksichtigt werden können. Ein zielstaatsbezogenes Abschiebungshindernis kann sich aus der Krankheit eines Ausländers ergeben, wenn diese sich im Heimatstaat wesentlich verschlimmert, weil die Behandlungsmöglichkeiten dort unzureichend sind. Darüber hinaus kann sich – trotz an sich verfügbarer medikamentöser und ärztlicher Behandlung – das Abschiebungsverbot aber auch aus sonstigen Umständen im Zielstaat ergeben, die dazu führen, dass der betroffene Ausländer diese medizinische Versorgung tatsächlich nicht erlangen kann. Denn eine zielstaatsbezogene Gefahr für Leib und Leben besteht auch dann, wenn die notwendige Behandlung oder Medikation zwar allgemein zur Verfügung steht, dem betroffenen Ausländer individuell jedoch aus finanziellen oder sonstigen Gründen nicht zugänglich ist. In die Beurteilung mit einzubeziehen und bei der Gefahrenprognose zu berücksichtigen sind sämtliche zielstaatsbezogenen Umstände, die zu einer wesentlichen Verschlimmerung der Erkrankung führen können. Für die Annahme einer „konkreten Gefahr“ genügt jedoch nicht die bloße theoretische Möglichkeit, Opfer von Eingriffen in Leib, Leben oder Freiheit zu werden. Vielmehr entspricht der Begriff der Gefahr im Sinne von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG dem asylrechtlichen Prognosemaßstab der „beachtlichen Wahrscheinlichkeit“, wobei allerdings das Element der Konkretheit der Gefahr für „diesen Ausländer“ das zusätzliche Erfordernis einer einzelfallbezogenen, individuell bestimmten oder erheblichen Gefährdungssituation statuiert (vgl. zum Ganzen: BayVGH, B.v. 23.11.2012 – 13a B 12.30061 – juris).
Erforderlich, aber auch ausreichend für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist danach, dass sich die vorhandene schwerwiegende Erkrankung des Ausländers aufgrund zielstaatsbezogener Umstände in einer Weise verschlimmert, die zu einer erheblichen konkreten Gefahr für Leib oder Leben führt, d.h. dass eine wesentliche Verschlimmerung der Erkrankung alsbald nach der Rückkehr des Ausländers droht. Von einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes kann nicht schon bei jeder befürchteten ungünstigen Entwicklung des Gesundheitszustandes gesprochen werden, sondern nur bei außergewöhnlichen schweren physischen oder psychischen Schäden oder Zuständen. Dies stellt auch § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG klar, wonach eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen nur bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, vorliegt. Insbesondere ist es gemäß § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG nicht erforderlich, dass die medizinische Versorgung in Äthiopien mit der der Versorgung in Deutschland vergleichbar ist (vgl. zum Ganzen auch VG Bayreuth, U.v. 25.01.2018 – B 7 K 17.31917 – juris).
bb) Die geltend gemachten psychischen Erkrankungen des Klägers erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Es ist nicht ersichtlich, dass eine wesentliche Verschlechterung einer schwerwiegenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung alsbald nach der Rückkehr nach Äthiopien droht.
Mit Schriftsatz vom 16.08.2018 legte der Kläger ein nervenärztliches Attest … vor, wonach die dort tätige Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, … dem Kläger eine leichte depressive Episode (ICD-10:F32.0) sowie eine posttraumatische Belastungsstörung (ICD10:F43.1) bescheinigt.
(1) Dieses fachärztliche Attest genügt aber schon im Ansatz nicht den Anforderungen an eine Bescheinigung bzw. Substantiierung einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Zur Substantiierung eines Vorbringens einer Erkrankung an einer PTBS gehört angesichts der Unschärfen des Krankheitsbildes sowie seiner vielfältigen Symptomatik regelmäßig die Vorlage eines gewissen Mindestanforderungen genügenden fachärztlichen Attests. Aus diesem muss sich nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt hat und wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. Dazu gehören etwa Angaben darüber, seit wann und wie häufig sich der Patient in ärztlicher Behandlung befunden hat und ob die von ihm geschilderten Beschwerden durch die erhobenen Befunde bestätigt werden. Des Weiteren sollte das Attest Aufschluss über die Schwere der Krankheit, deren Behandlungsbedürftigkeit sowie den bisherigen Behandlungsverlauf (Medikation und Therapie) geben. Wird das Vorliegen einer PTBS auf traumatisierende Erlebnisse im Heimatland gestützt und werden die Symptome erst längere Zeit nach der Ausreise aus dem Heimatland vorgetragen, so ist in der Regel auch eine Begründung dafür erforderlich, warum die Erkrankung nicht früher geltend gemacht worden ist. Diese Anforderungen an die Substantiierung ergeben sich aus der Pflicht des Beteiligten, an der Erforschung des Sachverhalts mitzuwirken (§ 86 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 VwGO), die in besonderem Maße für Umstände gilt, die in die eigene Sphäre des Beteiligten fallen (vgl. hierzu BVerwG, U. v. 11.09.2007 – 10 C 17/07 – juris).
Diese höchstrichterliche Rechtsprechung hat der Gesetzgeber im Wesentlichen nachvollzogen und Vorgaben zu den qualitativen Anforderungen an ärztliche Atteste in § 60 a Abs. 2c AufenthG gemacht (BayVGH, B.v. 24.1.2018 – 10 ZB 18.30105 – juris; B.v. 9.11.2017 – 21 ZB 17.30468 – juris; VG Bayreuth, B.v. 8.8.2018 – B 7 S 18.31388 – juris). Auch nach dieser Vorschrift wird gesetzlich vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen. Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich medizinische Beurteilung des Krankheitsbilds (Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung sowie die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich erben, enthalten.
Der fachärztlichen Bescheinigung von Frau … vom 14.08.2018 ist nicht einmal zu entnehmen, wann der Kläger dort vorstellig gewesen ist und wie lange er bereits in fachärztlicher Behandlung ist. Es wird auch mit keinem Wort erwähnt, wie lange der Kläger schon psychische Probleme hat und wie sich der Krankheitsverlauf entwickelt hat. Es fehlt damit schon an einer eingehenden Anamnese und Exploration der Ärztin. Die Ärztin hat offensichtlich ungefiltert den Sachvortrag des Klägers übernommen und legt diesen uneingeschränkt der Diagnoseerstellung zugrunde. Nach Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung war bei dem 45-minütigem Arzttermin nicht einmal ein Dolmetscher zugegen. Es ist daher für das Gericht nicht nachvollziehbar, wie die Ärztin sich ein Bild von der Schlüssigkeit des klägerischen Vorbringens hat machen können. Nach dem Eindruck des Gerichts in der mündlichen Verhandlung drängt sich vielmehr der Verdacht auf, dass die Angaben gegenüber der Ärztin weitgehend vom Betreuer des Klägers, der beim Arzttermin zugegen war, gemacht wurden. Es widerspricht daher jeglicher ärztlicher Kunst und Sorgfaltspflicht, mit dem lapidaren Passus, „die vom Patienten geschilderten und von mir erhobenen Befunde lassen sich eindeutig mit den Diagnosen leichte depressive Störung und posttraumatische Belastungsstörung in Einklang bringen“ vorbehaltlos eine posttraumatische Belastungsstörung zu diagnostizieren. Dies gilt vorliegend umso mehr, da der Kläger – nach eigenen Angaben in der mündlichen Verhandlung – schon seit seiner Einreise in die Bundesrepublik Deutschland im Frühjahr 2015 mit psychischen Problemen zu kämpfen haben will. Plausible Anhaltspunkte dafür, warum sich der Kläger erst nunmehr – eine Woche vor der mündlichen Verhandlung im Asylverfahren – in fachärztlicher Behandlung begeben hat, enthalten weder das ärztliche Attest, noch der klägerische Vortrag in der mündlichen Verhandlung. Für das Gericht drängt sich daher der Verdacht auf, dass mit dem Vortrag einer posttraumatischen Belastungsstörung die Erfolgsaussichten für ein Abschiebeverbot gesteigert werden sollen.
Nach Auswertung des ärztlichen Attestes und dem Vorbringen des Klägers in der mündlichen Verhandlung ist daher eine PTBS beim Kläger nicht substantiiert dargelegt. In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Kläger widersprüchliche und unglaubwürdige bzw. gesteigerte Angaben zu den traumatisierenden Ereignissen (Inhaftierung und Folter durch das Militär, Verhaftung im Sudan) gemacht hat, so dass nicht einmal eindeutig und nachvollziehbar die auslösenden Ereignisse geklärt bzw. beleuchtet sind.
(2) Soweit eine leichte depressive Episode bescheinigt wird, erfüllt das Attest ebenfalls nicht die Anforderungen des § 60a Abs. 2c AufenthG. Zudem handelt es sich bei der leichten depressiven Episode schon im Ansatz um keine schwerwiegende oder lebensbedrohliche Erkrankung, die sich alsbald bei einer Abschiebung nach Äthiopien wesentlich verschlechtern würde, handelt (§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG).
(3) Psychische Erkrankungen – grundsätzlich auch eine PTBS – sind darüber hinaus selbst in Äthiopien behandelbar. Psychiatrische Behandlungen werden in mehreren Krankenhäusern in Addis Abeba angeboten. Insbesondere sind in Äthiopien auch verschiedene Psychopharmaka erhältlich, z.B.: Amitrypilline, Carbamazpine, Clonazpam, Diazepam, Haloperidol, Imipramine, Sodium, Volporate sowie Triflurperazine (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Äthiopien: Psychiatrische Versorgung vom 05.09.2013, Blatt 6). Auch wenn die vom Kläger derzeit eingenommenen Medikamente in Äthiopien nicht verfügbar sein sollten, ist es ihm zumutbar, sich z.B. über das ZIRF-Counselling Projekt über erhältliche Medikamente in Äthiopien zu erkundigen und sich – ggf. mit einem in Deutschland angelegten Medikamentenvorrat – auf eine Medikamentenumstellung in Äthiopien einzulassen. § 60 Abs. 7 AufenthG dient nämlich nicht dazu, eine bestehende Erkrankung optimal zu behandeln oder ihre Heilungschancen zu verbessern. Insbesondere bietet diese Vorschrift keinen allgemeinen Anspruch auf Teilhabe am medizinischen Fortschritt und Standard in der medizinischen Versorgung in Deutschland. Der Kläger muss sich auf den Standard der Gesundheitsversorgung in seinem Heimatland verweisen lassen, auch wenn dieses dem Niveau in Deutschland sicherlich nicht entspricht (vgl. § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG).
Für das Gericht ist auch nicht ersichtlich, dass der Kläger eine in seinem Heimatland übliche Behandlung seiner psychischen Probleme nicht erreichen könnte oder dass eine Behandlung in Äthiopien unzumutbar wäre. Bei finanziellen Engpässen kann er über die Beantragung einer Armutskarte bei seiner Heimatgemeinde die Finanzierung der medizinischen Behandlung über den Staat beantragen (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Äthiopien: Psychiatrische Versorgung vom 05.09.2013, Blatt 9). Soweit im ärztlichen Attest vom 14.08.2018 ausgeführt wird, in Äthiopien könne eine psychische Behandlung nicht durchgeführt werden, da der Kläger dort eine bedrohliche Situation zu befürchten habe, sowie dass Grundvoraussetzung für eine Stabilisierung und Verarbeitung einer posttraumatischen Belastungsstörung ein sicherer Aufenthaltsort sei, ist darauf hinzuweisen, dass diese Ausführungen ebenfalls vage und oberflächlich sind. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass der Kläger im Heimatland eine bedrohliche Situation zu befürchten hat, da die Fluchtgeschichte jenseits jeglicher Glaubwürdigkeit liegt.
cc) Im Übrigen – und ohne dass es noch entscheidungserheblich darauf ankommt – macht das Gericht von seinem Ermessen Gebrauch und weist das Vorbringen hinsichtlich einer psychischen Erkrankung des Klägers gem. § 74 Abs. 2 Satz 2 AsylG i. V. m. § 87b Abs. 3 VwGO als präkludiert zurück.
Nach § 74 Abs. 2 Satz 1 AsylG hat der Kläger die zur Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung anzugeben. Nach § 87b Abs. 3 Satz 1 VwGO kann das Gericht Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf der obigen Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde, der Beteiligte die Verspätung nicht genügend entschuldigt und der Beteiligte über die Folgen der Fristversäumung belehrt worden ist. Der Kläger wurde sowohl von der Beklagten im Bescheid vom 30.06.2017 als auch vom Gericht in der Klageeingangsmitteilung darauf hingewiesen, dass die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids anzugeben sind. Die Erkrankung des Klägers wurde aber erstmals am 16.08.2018 – und damit unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung – vorgebracht, obwohl der Kläger nach eigenen Angaben seit 2015 psychische Probleme hat. Weiterhin wurde der Kläger mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung – unter Hinweis auf § 87b Abs. 3 VwGO – nochmals aufgefordert, bis zum 01.08.2018 evtl. verfahrensrelevante gesundheitliche Beeinträchtigungen vorzubringen. Auch innerhalb dieser Frist erfolgte kein entsprechender Vortrag, obwohl nach Angaben in der Verhandlung eine Wartezeit von einem Monat für den Facharzttermin am … bestanden haben soll. Zwar ist das Attest auf den 14.08.2018 datiert und konnte daher – denknotwendigerweise – nicht innerhalb Monatsfrist des § 74 Abs. 2 AsylG bzw. bis zum 01.08.2018 vorgelegt werden, jedoch sind nach § 74 Abs. 2 Satz 1 AsylG bzw. § 87b Abs. 2 VwGO nicht nur Beweismittel, sondern auch die zur Klagebegründung dienenden Tatsachen und Erklärungen innerhalb der maßgeblichen Fristen vorzubringen. Es wäre dem anwaltlich vertretenen Kläger daher ohne weiteres zuzumuten gewesen, fristgerecht die Erkrankung des Klägers vorzubringen. Entschuldigungsgründe sind weder dargetan noch anderweitig ersichtlich. Letztlich würde die Berücksichtigung des verspäteten Vortrags nach Überzeugung des Gerichts zur Verzögerung der Erledigung des Rechtsstreits führen, da in diesem Fall das Gericht – in Anbetracht des unbrauchbaren Attestes – weitere Ermittlungen zum Krankheitsbild anstellen müsste.
5. Es bestehen auch gegen die Rechtmäßigkeit der Abschiebungsandrohung einschl. der Zielstaatbestimmung im Hinblick auf § 34 Abs. 1 AsylG i.V.m. § 59 AufenthG keine Bedenken. Zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung, auf den gemäß § 77 Abs. 1 AsylG abzustellen ist, sind Gründe, die dem Erlass der Abschiebungsandrohung gegenüber dem Kläger entgegenstünden, nicht ersichtlich. Denn er ist, wie oben ausgeführt, nicht als Flüchtling oder Asylberechtigter anzuerkennen. Ihm steht auch kein subsidiärer Schutz oder ein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG zu. Er besitzt zudem keine asylunabhängige Aufenthaltsgenehmigung (§ 34 Abs. 1 AsylG i.V.m. § 59 Abs. 1 und 2 AufenthG).
6. Gründe, die gegen die Rechtmäßigkeit der von der Beklagten festgesetzten Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots sprechen, liegen nicht vor.
7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden gem. § 83b AsylG nicht erhoben. Der Gegenstandswert bestimmt sich nach § 30 RVG. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.