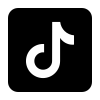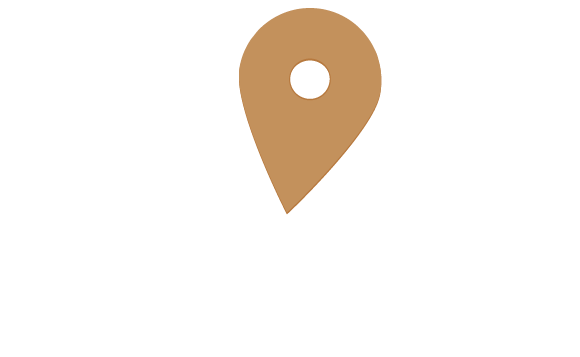Aktenzeichen M 28 K 17.31767
Leitsatz
1 Im Iran können zum Christentum konvertierte Muslime durch die aktive Glaubensausübung im konkreten Einzelfall landesweit einer beachtlichen Gefahr von Verfolgungshandlungen durch den iranischen Staat oder diesem zurechenbaren Akteuren ausgesetzt sein, jedenfalls dann, wenn sie ihren christlichen Glauben öffentlich leben. (Rn. 29) (redaktioneller Leitsatz)
2 Es ist nicht zu erwarten, dass ein Asylsuchender nach der Rückkehr in sein Herkunftsland eine Religion aktiv lebt, die er in seinem Zufluchtsland nur vorgeblich, oberflächlich oder aus asyltaktischen Gründen angenommen hat (BVerwG BeckRS 2015, 51672). (Rn. 30) (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Gründe
Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagte weder Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§§ 3 ff. AsylG), noch auf Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus (§ 4 AsylG), noch auf Feststellung von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 Satz 1 AufenthG (hinsichtlich der Ablehnung des Antrags auf Anerkennung als Asylberechtigte nach Art. 16 a GG ist der Bescheid vom 16. Januar 2017 bestandskräftig geworden, nachdem insoweit ausdrücklich kein Verpflichtungsantrag gestellt wurde und beim Aufhebungsantrag Ziffer 2. des Bescheids ausdrücklich ausgenommen worden ist; ohnehin wäre eine Klage insoweit allein deshalb ohne Erfolg geblieben, weil die Klägerin nach eigenem Vortrag u.a. über Griechenland und damit über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland gelangt ist, Art. 16 a Abs. 2 GG i.V.m. § 26 a Abs. 1 und 2 AsylG). Die Abschiebungsandrohung in Ziffer 5. des Bescheids vom 16. Januar 2017 und die Befristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots in Ziffer 6. dieses Bescheids sind rechtmäßig.
Hinsichtlich der allgemeinen Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes sowie die Feststellung von Abschiebungsverboten, ferner hinsichtlich der Abschiebungsandrohung und der Befristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots wird zunächst auf den Bescheid des Bundesamts vom 16. Januar 2017 verwiesen (§ 77 Abs. 2 AsylG). Ergänzend ist wie folgt auszuführen:
1. Im Falle einer Rückkehr in den Iran droht der Klägerin keine von einer Vorverfolgung im Iran abzuleitende Bedrohung, Verfolgung oder Gefährdung im Sinne der §§ 3 ff. AsylG, § 4 AsylG, § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG. Zur Überzeugung des Gerichts ist die Klägerin nicht staatlicherseits vorverfolgt aus dem Iran ausgereist:
a) Dies wird schon allein dadurch belegt, dass die Klägerin gemessen an ihren eigenen Angaben (Bl. 61 BA, S. 9 des Sitzungsprotokolls – SP -, vgl. a. S. 5 SP) auf legalem Wege ohne Probleme vom T … Flughafen I … aus per Flugzeug den Iran verlassen konnte. Gemessen an den vorliegenden Erkenntnismitteln (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran, Stand: November 2015, vom 9. Dezember 2015, S. 32; vgl. ferner: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran, Stand: Oktober 2016, vom 8. Dezember 2016, S. 18) wäre eine derartige Ausreise nicht möglich gewesen, wenn die Klägerin von den iranischen Sicherheitsbehörden gesucht worden wäre. Darüber hinaus wäre es auch gänzlich lebensfremd anzunehmen, dass die Klägerin, wenn sie eine staatliche Verfolgung befürchtet hätte, den für einen Verfolgten sehr risikoreichen und gefährlichen Weg der Ausreise über den T … Flughafen I … auch nur in Betracht gezogen hätte.
b) Hinzu kommt, dass die Klägerin nach eigenem Bekunden den Iran deshalb verlassen hat, weil ihr Vater entschieden hatte, dass sie und ihre Familie aufgrund der Probleme des Vaters den Iran verlassen (SP S. 4). Die Ausreise erfolgte am 10. Februar 2016 zusammen mit ihrer Mutter, nachdem ihr Vater und ihre (jüngere) Schwester bereits zuvor ausgereist waren (SP S. 10). Gemessen an diesen klägerischen Angaben waren demnach eigene Probleme der Klägerin mit dem iranischen Staat weder Anlass noch Ursache der klägerischen Ausreise aus dem Iran.
c) Unbeschadet des Vorstehenden ergibt sich aus den von der Klägerin beim Bundesamt und vor allem in der mündlichen Verhandlung geschilderten angeblichen persönlichen Probleme keine asylrelevante und asylerhebliche Bedrohung, Verfolgung oder Gefährdung im Sinne der §§ 3 ff. AsylG, § 4 AsylG, § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG:
aa) Soweit sich die Klägerin sowohl bei ihrer Asylantragstellung (Bl. 3 BA) als auch in ihrer Anhörung (Bl. 61 BA) als konfessionslos bezeichnet hat, hat die Klägerin sowohl beim Bundesamt (Bl. 63 BA) als auch in der mündlichen Verhandlung (SP S. 8) klargestellt, dass sie diese Religionslosigkeit nicht öffentlich bekundet hatte und deshalb insoweit keine Probleme gehabt hatte. Daran gemessen gibt es auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin im Hinblick auf ihre Religionslosigkeit im Iran asylrelevant und asylerheblich im Sinne der §§ 3 ff. AsylG, § 4 AsylG, § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG bedroht, verfolgt oder gefährdet gewesen sein könnte.
bb) Die von der Klägerin gegenüber dem Bundesamt und gegenüber dem Gericht vorgebrachten angeblichen Probleme mit der Sittenpolizei wegen ihrer Verschleierung – in der mündlichen Verhandlung erwähnte die Klägerin allein noch einen einmaligen Vorfall, der sich zwei bis zweieinhalb Jahre vor ihrer Ausreise ereignet haben soll (SP S. 4, S. 8 f.; vgl. auch das Vorbringen beim Bundesamt Bl. 63 und in der Klagebegründung) – stellen selbst bei Wahrunterstellung keine asylerhebliche Bedrohung, Verfolgung oder Gefährdung im Sinne der §§ 3 ff. AsylG, § 4 AsylG, § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG dar: Das Gericht stellt dabei nicht im Abrede, dass die Verschleierungsvorschriften im Iran nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Deutschlands im Einklang stehen. Asylrechtlich maßgeblich ist indes, dass es gemessen an der Darstellung der Klägerin weder zu asylerheblichen Verfolgungshandlungen im Sinne des § 3 a AsylG, noch zu einem ernsthaften Schaden im Sinne des § 4 Abs. 1 AsylG, insbesondere auch nicht zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG, noch zu einer unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne des § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 oder zu einer anderen konventionswidrigen Behandlung, noch zu einer erheblichen konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG gekommen ist. Soweit die Klägerin beim Bundesamt allgemein beklagt hat, die Verschleierung habe ihr das Leben schwer gemacht, wenn man nicht genau auf die Vorschriften achte, dann werde man sofort angesprochen, sie sei oft angesprochen worden, sie solle sich ordentlicher kleiden (Bl. 63 BA), ist ganz offensichtlich keine in diesem Sinne asylerhebliche Bedrohung, Verfolgung oder Gefährdung angesprochen. Aber auch der von der Klägerin geschilderte einmalige Vorgang, bei dem sie wegen Verstoßes gegen die Verschleierungsvorschriften kurz festgenommen worden sein soll, reicht hierfür nicht aus.
Unbeschadet dessen handelte es sich bei diesem einmaligen Vorgang, der bereits zwei bis zweieinhalb Jahre vor der Ausreise der Klägerin stattgefunden haben soll, um einen seit längerem abgeschlossenen Sachverhalt. Allein aufgrund des Zeitablaufs wäre zur Überzeugung des Gerichts nicht mehr zu befürchten, dass die Klägerin im Falle ihrer Rückkehr nach Iran wegen dieses Vorfalls erneut bedroht wäre; die Vermutungsregelung des Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 2011/95/EU (Qualifikationsrichtlinie) wäre widerlegt.
Es kommt nach alldem nicht mehr entscheidungserheblich darauf an, dass das Gericht auch erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt dieses Vorbringens hat, da die Klägerin keine genaueren Angaben zum Zeitpunkt dieses angeblichen Vorkommnisses machen konnte (vgl. SP S. 8 f.).
cc) Ferner zeigt auch das Vorbringen der Klägerin, ihre Schule habe sich geweigert, ihr das Schulzeugnis auszustellen (offensichtlich unrichtig ist die Darstellung der Bevollmächtigten in der Klagebegründung, die Schulleitung habe der Klägerin bewusst schlechte Schulnoten gegeben; derartiges hat die Klägerin weder beim Bundesamt noch in der mündlichen Verhandlung vorgetragen) keine asylrelevante und asylerhebliche Bedrohung, Verfolgung oder Gefährdung im Sinne der §§ 3 ff. AsylG, § 4 AsylG, § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG auf:
(1.) Das Gericht hält das diesbezügliche Vorbringen der Klägerin bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände schon für unglaubwürdig: In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin als Grund für die Nichtaushändigung des Zeugnisses ein angebliches Vorkommnis angeführt, bei dem sie an einer religiösen Veranstaltung im Gebetsraum der Schule nicht teilgenommen und anschließend provozierende Fragen gestellt haben will; eine Freundin habe gehört, wie im Büro unter den Lehrern über den Vorfall gesprochen worden sei, es sei gesagt worden, sie bekomme kein Zeugnis, weil sie ja dann immer weiter machen würde (SP S. 2 f.). Bei ihrer Anhörung durch das Bundesamt am 28. November 2016 hatte die Klägerin weder dieses Vorkommnis noch das von der Freundin belauschte Gespräch der Lehrer erwähnt, geschweige denn dieses Vorkommnis als Grund für die Nichtaushändigung des Zeugnisses angeführt. Vielmehr hatte sie dort zur Frage nach der Begründung für die Nichtaushändigung des Diploms vorgebracht, der Lehrer habe von der Familiensituation gewusst (Bl. 62 BA) sowie der Lehrer habe Angst gehabt, dass, wenn er es ihr gebe, er mit einer politischen Familie zusammenarbeiten würde, eine konkrete Begründung habe er nicht gegeben (Bl. 63 BA). Diese Widersprüche im zudem gesteigerten Vorbringen konnte die Klägerin auch auf diverse gerichtliche Vorhalte in der mündlichen Verhandlung hin (SP S. 5 ff.) nicht auflösen:
Die unsubstantiierte Behauptung der Klägerin, die Dolmetscherin sei eine Afghanin gewesen und habe es vielleicht nicht richtig verstanden (SP S. 6), überzeugt nicht. Die Niederschrift über die Anhörung wurde der Klägerin rückübersetzt, was diese auf dem Kontrollbogen mit ihrer Unterschrift bestätigt hat (Bl. 64, 70 BA). Spätestens bei dieser Rückübersetzung wäre ein etwaiges Missverständnis aufgefallen.
Auch der weitere Erklärungsversuch der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, die Sache mit der Freundin habe sie erst später erfahren (SP S. 6) – „später“ meint offenbar nach der Anhörung beim Bundesamt am 28. November 2016 -, überzeugt nicht: Selbst bei Wahrunterstellung dieses Vorbringens hätte die Klägerin das Vorkommnis selbst, also dass sie an einer religiösen Veranstaltung im Gebetsraum der Schule nicht teilgenommen und anschließend provozierende Fragen gestellt hatte, bereits bei ihrer Anhörung beim Bundesamt erwähnen können. Vor allem auch hat die Klägerin die diversen gerichtlichen Nachfragen, zu welchem konkreten Zeitpunkt sie das mit der Freundin erfahren habe (SP S. 6 ff,), zur Überzeugung des Gerichts bei Gesamtwürdigung aller Umstände gänzlich unglaubwürdig erst nach längerem Überlegen ausweichend, widersprüchlich und ungenau beantwortet. Das Gericht konnte sich in der mündlichen Verhandlung nicht des Eindrucks erwehren, dass dies nicht etwa an Erinnerungslücken lag, sondern dass die Klägerin bemüht war, ihre Antworten so zu gestalten, dass für ihre Kenntnis auch ein später Zeitpunkt in Betracht kommt, der nach der Anhörung beim Bundesamt am 28. November 2016 liegt: So hat die Klägerin etwa vorgebracht, die Freundin habe das Gespräch der Lehrer erst gehört, nachdem die Klägerin diese nach ihrer Ausreise aus dem Iran von Griechenland aus gebeten gehabt habe, in die Schule zu gehen und nach ihrem Zeugnis zu fragen (SP S. 7). Dieses Vorbringen ist unglaubwürdig: Es widerspricht der anfänglichen Einlassung der Klägerin (SP S. 2 ff.), bei der sie die angeblichen Ereignisse strikt chronologisch erzählt hatte, und gemessen an der die Freundin das Gespräch der Lehrer bereits erheblich früher, jedenfalls zeitlich deutlich vor der Ausreise der Klägerin aus dem Iran am 10. Februar 2016 gehört haben muss. Bei lebensnaher Betrachtungsweise ist auch allein plausibel, dass ein etwaiges Gespräch der Lehrer über das Vorkommnis und die Entscheidung über die hieraus zu ziehenden Konsequenzen im zeitlichen Zusammenhang mit dem angeblichen Vorkommnis geführt wurde. Der Klägerin wurde ja auch dann bereits im Juli 2014 die Aushändigung des Zeugnisses verweigert (SP S. 10), d.h. zu diesem Zeitpunkt muss die angebliche Entscheidung über die zu ziehenden Konsequenzen bereits gefallen gewesen sein. Hingegen erschließt sich nicht, warum die Lehrer zu einem erheblich späteren Zeitpunkt, nämlich etwa Mitte 2016 (vgl. SP S.8), als die Klägerin bereits in Griechenland war, (erneut) über das angebliche Vorkommnis und vor allem auch über die hieraus zu ziehenden Konsequenzen hätten sprechen sollen. Die Entscheidung, welche Konsequenzen aus dem Vorkommnis zu ziehen sind, nämlich der Klägerin das Zeugnis nicht auszuhändigen, war zu diesem Zeitpunkt längst gefallen und umgesetzt gewesen. Unglaubwürdig ist das klägerische Vorbringen einer späten Kenntnis zudem auch deshalb, weil die Klägerin die konkreten Nachfragen des Gerichts, zu welchem Zeitpunkt ihre Freundin ihr über das Gespräch der Lehrer berichtet habe, nicht überzeugend beantworten konnte: Nach längerem Überlegen meinte sie, es sei zwei Monate nachdem sie nach Deutschland gekommen sei gewesen, es sei im November 2016 gewesen. Nicht festlegen wollte sie sich auf erneute Nachfrage, ob es Anfang, Mitte oder Ende November 2016 gewesen sei. Auf Vorhalt ihrer mit diesem Vorbringen nicht vereinbaren anderen Einlassung, sie sei am 27. Oktober 2016 in Deutschland eingereist, meinte sie dann abweichend, es seien ein, zwei Monate gewesen. Schließlich meinte sie dann, es sei in der Zeit ihres Aufenthalts in Z … gewesen. Derart ausweichende, ungenaue und widersprüchliche Angaben zum Zeitpunkt ihrer Kenntnis haben unter Berücksichtigung des Eindrucks von der Klägerin, den das Gericht in der mündlichen Verhandlung gewinnen konnte, zu durchgreifenden Zweifeln am Wahrheitsgehalt des klägerischen Vorbringens geführt.
Bei einer Gesamtwürdigung aller vorgenannten Umstände konnte das Gericht mithin nicht die Überzeugung gewinnen, dass das Vorbringen der Klägerin hinsichtlich der Verweigerung des Schulzeugnisses der Wahrheit entspricht.
(2.) Unbeschadet des Vorstehenden läge selbst bei Wahrunterstellung des klägerischen Vorbringens in rechtlicher Hinsicht keine asylerhebliche Bedrohung, Verfolgung oder Gefährdung im Sinne der §§ 3 ff. AsylG, § 4 AsylG, § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vor: Gemessen an der klägerischen Darstellung ist es auch im Zusammenhang mit der angeblichen Verweigerung des Schulzeugnisses weder zu asylerheblichen Verfolgungshandlungen im Sinne des § 3 a AsylG, noch zu einem ernsthaften Schaden im Sinne des § 4 Abs. 1 AsylG, insbesondere auch nicht zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG, noch zu einer unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne des § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK oder zu einer anderen konventionswidrigen Behandlung, noch zu einer erheblichen konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG gekommen.
2. Auch die behauptete Hinwendung der Klägerin zum Christentum kann der Klage unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zum Erfolg verhelfen:
a) Zwar können im Iran gemessen an den vorliegenden Erkenntnismitteln (vgl. etwa die Lageberichte des Auswärtigen Amts vom 9. Dezember 2015, S. 15 f., sowie vom 8. Dezember 2016, S. 10) zum Christentum konvertierte Muslime durch die aktive Glaubensausübung im konkreten Einzelfall landesweit einer beachtlichen Gefahr von Verfolgungshandlungen durch den iranischen Staat oder diesem zurechenbaren Akteuren ausgesetzt sein, jedenfalls dann, wenn sie ihren christlichen Glauben öffentlich leben, so dass die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§ 3 ff. AsylG) oder zumindest des subsidiären Schutzes (§ 4 AsylG) oder zumindest die Feststellung von Abschiebungsverboten (§ 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG) in Betracht kommen kann (vgl. hierzu: OVG NW, U. v. 7.11.2012 – 13 A 1999/07.A – juris Rn. 48 ff.; HessVGH, U. v. 18.11.2009 – 6 A 2105/08.A – juris Rn. 34 ff.; OVG NW, B. v. 30.7.2009 – 5 A 1999/07.A – juris; SächsOVG, U. v. 3.4.2008 – A 2 B 36/06 – juris Rn. 34 ff.; BayVGH, U. v. 23.10.2007 – 14 B 06.30315 – juris Rn. 20 f.).
Die Annahme einer solchen Verfolgungsgefährdung setzt im konkreten Einzelfall allerdings voraus, dass die vorgetragene Hinwendung des Asylsuchenden zu der angenommenen Religion zur vollen Überzeugung des Gerichts auf einer inneren Glaubensüberzeugung beruht, mithin eine ernsthafte, dauerhafte und nicht lediglich auf Opportunitätserwägungen oder asyltaktischen Gründen beruhende Hinwendung zum Christentum vorliegt und der neue Glaube die religiöse Identität des Schutzsuchenden prägt. Hierzu gehört auch, aber nicht nur, dass dem Konvertiten die wesentlichen Grundelemente seiner neuen Religion vertraut sind, wobei seine Persönlichkeit und seine intellektuellen Fähigkeiten zu berücksichtigten sind. Allein der formale Übertritt zum Christentum durch eine kirchenrechtlich wirksame Taufe genügt nicht. Das Gericht ist auch nicht an die Beurteilung des Amtsträgers einer christlichen Kirche gebunden, der Taufe des Betroffenen liege eine ernsthafte und nachhaltige Glaubensentscheidung zugrunde. Eine beachtliche Verfolgungsgefährdung lässt sich ferner auch nicht allein daraus ableiten, dass sich der Asylsuchende in Deutschland religiös betätigt hat, selbst wenn dies öffentlich (z.B. im Internet) bekannt geworden ist. Das Gericht muss vielmehr die volle Überzeugung gewinnen, dass der Asylsuchende die religiöse Betätigung seines Glaubens für sich selbst als verpflichtend zur Wahrung seiner religiösen Identität empfindet. Es muss davon ausgehen können, dass der Asylsuchende seinen neuen Glauben in einer Weise verinnerlicht hat, dass es ihm ein tief empfundenes Bedürfnis ist, diesen Glauben auch im Fall der Rückkehr in das Herkunftsland ungehindert leben zu können. Hingegen ist nicht zu erwarten, dass ein Asylsuchender nach der Rückkehr in sein Herkunftsland eine Religion aktiv lebt, die er in seinem Zufluchtsland nur vorgeblich, oberflächlich oder aus asyltaktischen Gründen angenommen hat (zum Ganzen: BVerwG, B. v. 25.8.2015 – 1 B 40.15 – juris Rn. 9 ff. m.w.N.; BayVGH, B. v. 7.11.2016 – 14 ZB 16.30380 – juris Rn. 7 ff., 12, B. v. 16.11.2015 – 14 ZB 13.30207 – juris Rn. 5 ff. m.w.N.; OVG Nordrhein-Westfalen, B. v. 10.2.2017 – 13 A 2648/16.A – juris Rn. 11 f., B. v. 27.4.2015 – 13 A 440/15.A – juris Rn. 10 ff. m.w.N., B. v. 24.5.2013 – 5 A 1062/12.A – juris Rn. 8 ff. m.w.N.; U. v. 7.11.2012 – 13 A 1999/07.A – juris Rn. 37 ff. m.w.N; OVG Lüneburg, B. v. 16.9.2014 – 13 LA 93/14 – juris Rn. 4 ff. m.w.N.; VGH BW, B. v. 23.4.2014 – A 3 S 269/14 – juris Rn. 6 m.w.N.).
b) Gemessen an diesen Grundsätzen ist im Fall der Klägerin bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände, insbesondere ihrer Einlassung im behördlichen Asylverfahren und gegenüber dem Gericht zur Überzeugung des Gerichts davon auszugehen, dass die behauptete Hinwendung zum Christentum nicht auf einer inneren Glaubensüberzeugung beruht, welche die religiöse Identität der Klägerin prägte, vielmehr dass dieser asyltaktische Überlegungen zugrunde liegen. Im Einzelnen:
Die Klägerin hat nichts vorgetragen, was darauf hindeutete, dass und ggf. aufgrund welcher Erlebnisse, Erfahrungen oder sonstigen eigenen Beweggründe sie sich dem Christentum im Sinne eines religiösen Bekenntnisses zugewandt hätte. Vielmehr zeigen allein die näheren Umstände der Taufe der Klägerin am 29. Januar 2017 eindrücklich, dass hierfür für die Klägerin zur Überzeugung des Gerichts rein asyltaktische Gründe maßgeblich waren: Gemessen an ihrer Einlassung beim Bundesamt hat sich die Klägerin im Iran – nicht öffentlich, aber doch heimlich – als religionslos verstanden (Bl. 63 BA). Auch in Deutschland hat sie sich sowohl bei ihrer Asylantragstellung am 10. November 2016 als auch bei der Anhörung durch das Bundesamt am 28. November 2016 ausdrücklich als konfessionslos bezeichnet (Bl. 3 BA, Bl. 61 BA). Dies hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bestätigt und bekräftigt, dass sie noch keine neue Religion angenommen hatte (SP S. 11). Indes hat sich die Klägerin dann nur zwei Monate später am 29. Januar 2017 taufen lassen (SP S. 12, S. 13; vgl. auch die Taufbescheinigung des E … … … … G … vom 30. Januar 2017; die Klageerhebung erfolgte nur einen Tag später am 30. Januar 2017). Schon diese sehr kurze Zeitspanne zwischen der Religionslosigkeit der Klägerin und ihrer Taufe streiten massiv gegen die Annahme, dieser Taufe habe eine identitätsprägende innere Glaubensüberzeugung zugrunde gelegen. Hinzu kommt, dass die Klägerin nach eigenem Bekunden vor ihrer Taufe nicht einmal eine besondere Taufvorbereitung absolviert hatte (SP S. 13) und zum Zeitpunkt der Taufe trotz angeblicher Kurse vom Christentum „noch nicht viel verstanden“ hatte (SP S. 12). Dass sich die Klägerin als erwachsene Konvertitin dennoch taufen ließ, belegt zusätzlich, dass die Taufe der Klägerin nicht Ausdruck einer identitätsprägenden inneren Glaubensüberzeugung gewesen sein kann. Die Klägerin konnte in der mündlichen Verhandlung auch kein überzeugendes Motiv für ihre Taufe nennen: Die substanzlosen Einlassungen, was sie verstanden habe, sei für sie „interessant“ gewesen, es habe ihr „innerliche Ruhe“ gegeben, haben mit einem spezifisch religiösen Bekenntnis aufgrund einer identitätsprägenden Hinwendung zum Christentum nicht ansatzweise etwas zu tun.
Auch aus den Angaben der Klägerin zu ihren Glaubensbetätigungen lassen sich keine durchgreifenden Anhaltspunkte für eine identitätsprägende innere Glaubensüberzeugung im Sinne eines religiösen Bekenntnisses ableiten. Zwar hat die Klägerin eine Bestätigung der Pfarrerin der J … G … vom 21. Juli 2017 vorgelegt, wonach sie regelmäßig an Gottesdiensten und Veranstaltung der Kirchengemeinde teilnehme. Derartige Verhaltensweisen sind für sich allein betrachtet für die gerichtliche Überzeugungsbildung hinsichtlich einer identitätsprägenden inneren Glaubensüberzeugung allerdings nicht ausreichend, weil einem derartigen Verhalten auch rein asyltaktische Überlegungen zu Grunde liegen können. Hinsichtlich der Betätigung des christlichen Glaubens in ihrem Leben hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zum einen davon gesprochen, sie habe gelernt „Nächstenliebe zu geben“, sie „bete für alle“, das sei für sie ein „schönes Gefühl“, sie habe „gelernt, den Namen Gottes nicht einfach so zu erwähnen“ (SP S. 13 f.). Derart oberflächliche und floskelhafte Wendungen streiten nicht durchgreifend für eine von einer identitätsprägenden inneren Glaubensüberzeugung getragene Glaubensbetätigung. Zum andern hat die Klägerin davon gesprochen, es sei für sie das Wichtigste, ihren „Zorn abzulegen“, sie habe zuvor eine „sehr scharfe Zunge“ gehabt, sie sei „nervös“ gewesen, habe „Vater und Mutter angeschrien“, wenn sie jemand sie um Hilfe bitte, dann leiste sie Hilfe (SP S. 13 f.). Damit weist die Klägerin auf allgemein moralisch erwünschte Verhaltensweisen hin, hingegen nicht auf eine spezifisch christlich-religiöse Glaubensbetätigung, die auf eine identitätsprägende innere Glaubensüberzeugung im Sinne eines religiösen Bekenntnisses hinweisen könnte.
Obwohl die Klägerin gemessen an der von ihr vorgelegten Bestätigung der Pfarrerin der J … G … vom 21. Juli 2017 regelmäßig an Gottesdiensten teilnimmt, deutet auch das Wissen der Klägerin über die christliche Religion nicht hinreichend auf eine identitätsprägende innere Glaubensüberzeugung hin. Zwar konnte die Klägerin in der mündlichen Verhandlung christliche Feiertage und deren Bedeutung nennen. Die gerichtliche Frage nach der Leidensgeschichte Jesu Christi, von der die Klägerin bei ihren Gottesdienstbesuchen an Karfreitag und Ostern 2017 gehört haben muss, konnte sie indes nur höchst rudimentär – Jesus wurde gekreuzigt, Pilatus war Herrscher, Jesus habe sehr viel leiden müssen – beantworten, vielmehr musste sie einräumen, dass sie die Frage nicht beantworten könne (SP S. 14 f.). Wer als erwachsener Konvertit den christlichen Glauben aufgrund einer identitätsprägenden inneren Glaubensüberzeugung annimmt, bei dem ist zu erwarten, dass er die für den christlichen Glauben zentrale Leidensgeschichte Jesu Christi viel genauer schildern kann. Auf die Frage nach den zentralen wichtigen Glaubensaussagen des Christentums wies die Klägerin nur auf Aussagen Jesu zum Beten und zum Almosengeben hin. Weitere, für das Christentum weitaus bedeutsamere und zentralere Glaubensaussagen konnte die Klägerin nicht nennen.
Auch sonst hat das Vorbringen der Klägerin das Gericht nicht davon überzeugen können, sie habe sich aufgrund einer identitätsprägenden inneren Glaubensüberzeugung dem Christentum zugewandt. Ihre Einlassung, sie habe „innerlich geglaubt“, dass Jesus für uns sein Leben hingegeben habe und dass durch die Taufe alle Sünden vergeben seien, hat sich in den entsprechenden Behauptungen erschöpft und ist substanzlos und oberflächlich geblieben. Unglaubwürdig ist das klägerische Vorbringen, sie habe „wirklich innerlich geglaubt und gewünscht“, dass durch die Taufe alle ihre Sünden vergeben seien, nachdem sich die Klägerin aus den oben genannten Gründen zur Überzeugung des Gerichts aus rein asyltaktischen Gründen taufen lies: Wer sich noch am 28. November 2016 als religionslos bezeichnet und angibt, keinen Glauben zu haben, dem kann schlechterdings nicht geglaubt werden, dass er am 29. Januar 2017 wirklich und innerlich glaubt und wünscht, durch seine Taufe würden seine Sünden vergeben, zumal wenn diese Person keine besondere Taufvorbereitung absolviert hat, selbst einräumt, bei der Taufe vom Christentum noch nicht viel verstanden zu haben, und keine Erlebnisse, Erfahrungen oder sonstigen eigenen Beweggründe für die Hinwendung zum Christentum nennen kann. Sonstige Einlassungen der Klägerin, die auf eine identitätsprägende innere Glaubensüberzeugung im Sinne eines religiösen Bekenntnisses hindeuten könnten, sind für das Gericht ersichtlich.
Nach alldem ist bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände zur Überzeugung des Gerichts davon auszugehen, dass die behauptete Hinwendung zum Christentum im Fall der Klägerin nicht auf einer inneren Glaubensüberzeugung beruht, welche deren religiöse Identität prägte, vielmehr dass dieser Behauptung Opportunitätserwägungen und asyltaktische Überlegungen zu Grunde liegen.
Die gemäß § 83 b AsylG gerichtskostenfreie Klage war nach alldem mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.
Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.