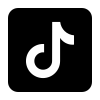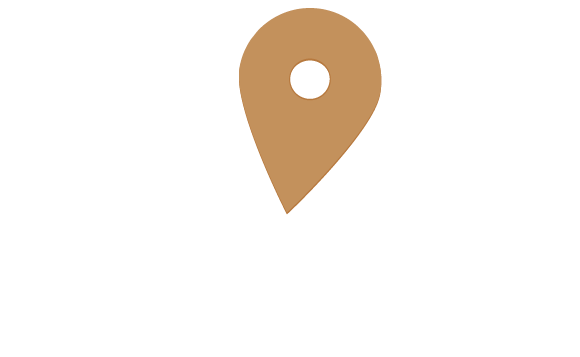Aktenzeichen L 4 KR 349/15
Leitsatz
1 Eine schriftliche Unterrichtung über die Einholung eines Gutachtens des MDK kann unterbleiben, wenn dem Kläger bereits bei Antragstellung bewusst war, dass die KK den MDK zur Prüfung einschaltet. Bezieht sich der Versicherte in der Übersendung von medizinischen Unterlagen auf ein vorangegangenes Telefongespräch bezüglich der Einschaltung des MDK, belegt dies, dass der Verfahrensablauf bereits bekannt war, sodass es einer erneuten Mitteilung durch die Beklagte nach Eingang des Antrags nicht mehr bedurfte. (Rn. 19) (redaktioneller Leitsatz)
2 Ein Berufen auf das Erfordernis der schriftlichen Mitteilung nach § 13 Abs. 3a S. 2 SGB V stellt in diesem Fall einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. (Rn. 19) (redaktioneller Leitsatz)
3 Aus dem Wortlaut des § 31 Abs. 6 SGB V ergibt sich keine Rückwirkung für die Zeit vor dem Inkrafttreten. Anhaltspunkte, dass der Gesetzgeber nur eine Klarstellung beabsichtigt hat, finden sich in der Gesetzesbegründung nicht. (Rn. 20) (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
S 6 KR 378/14 2015-07-14 Urt SGAUGSBURG SG Augsburg
Tenor
I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 14. Juli 2015 wird zurückgewiesen.
II. Außergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Klägers ist zulässig, jedoch unbegründet.
Der klägerische Antrag betrifft nach Inkrafttreten der Neufassung des § 31 Abs. 6 SGB V und der Bewilligung durch die Beklagte nur noch den Zeitraum vom 12. Mai 2014 bis 9. März 2017. Der Genehmigungsbescheid der Beklagten vom 27. März 2017 ersetzt insoweit gemäß § 96 Abs. 1 SGG den streitigen Bescheid vom 4. Juni 2014 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 8. September 2014. Nachgewiesen sind in diesem Zeitraum verauslagte Kosten vom 14. Mai 2014 bis 3. März 2017 in Höhe von 40.005. EUR (überwiegend Bedrocan, aber auch Argyle (1.120.- EUR), Pedanio 22/1 (280.- EUR), Princeton MCT K007 (210.- EUR), Benica (750.- EUR) und Bediol (750.- EUR). Es handelt sich um Cannabisblüten des niederländischen Herstellers Bedrocan.
Die Genehmigungsfiktion des § 13 Abs. 3 a SGB V, eingefügt mit Gesetz vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 277), greift vorliegend nicht. Dabei kann offen bleiben, ob am 23. Mai 2014 fernmündlich ein wirksamer ablehnender Verwaltungsakt gegenüber dem Kläger ergangen ist, da aufgrund der Einschaltung des MDK von einer fünfwöchigen Frist gemäß § 13 Abs. 3 a S. 1 SGB V auszugehen ist. Zwar ist nach Antragstellung keine schriftliche Unterrichtung gemäß § 13 Abs. 3 a S. 2 SGB V an den Kläger ergangen. Diese konnte jedoch unterbleiben, da dem Kläger bereits bei Antragstellung bewusst war, dass die Beklagte den MDK zur Prüfung einschaltet. So hat sich der Kläger in seinem Antragschreiben, das bei der Beklagten am 12. Mai 2014 eingegangen ist, auf ein vorangegangenes Telefongespräch bezogen und mitgeteilt: „Wie bereits telefonisch mit Ihnen besprochen sende ich zur Prüfung durch den medizinischen Dienst folgende Unterlagen: ( …)“. Damit war dem Kläger der Verfahrensablauf bereits bekannt, so dass es einer erneuten Mitteilung durch die Beklagte nach Eingang des Antrags nicht mehr bedurfte. Ein Berufen auf das Erfordernis der schriftlichen Mitteilung nach § 13 Abs. 3 a S. 2 SGB V stellt in diesem Fall einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) dar.
Ein Anspruch ergibt sich nicht aus § 31 Abs. 6 SGB V. § 31 Abs. 6 SGB V wurde eingefügt durch Art. 4 Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 6. März 2017 (BGBl. I S. 403) mit Wirkung vom 10. März 2017. Strittig ist vorliegend die Rechtslage vor dem 10. März 2017. Für den abgelaufenen Zeitraum kann lediglich ein Anspruch auf Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3 SGB V zur Geltung gebracht werden – hier in Form der 2. Fallvariante „zu Unrecht abgelehnt“. Die Höhe der geltend gemachten Kosten bis zum 10. März 2017 ist mit 40.005.- EUR ausreichend glaubhaft gemacht und nicht bestritten. Aus dem Wortlaut des § 31 Abs. 6 SGB V ergibt sich nämlich keine Rückwirkung für die Zeit vor dem Inkrafttreten am 10. März 2017. Anhaltspunkte, dass der Gesetzgeber nur eine Klarstellung beabsichtigt hat, finden sich in der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 18/8965, S. 23 ff) nicht. Vielmehr wird deutlich, dass der Gesetzgeber mit § 31 Abs. 6 SGB V eine „Neuregelung“ (S. 25) treffen wollte bzw. von einem „Ausnahmecharakter der Regelung“ (S. 25) ausging.
Ein Anspruch des Klägers auf Behandlung mit Cannabis ergibt sich nicht aus § 31 Abs. 1 S. 1 SGB V. Danach haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln, soweit Arzneimittel nicht nach § 34 SGB V oder durch Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V ausgeschlossen sind. Wie das Sozialgericht zutreffend ausgeführt hat, ist jedoch das vom Kläger begehrte Cannabis der Anlage 2 zum BtMG als verkehrs-, aber nicht verschreibungsfähiges Betäubungsmittel zuzuordnen, da der Kläger dieses nicht in Form eines Fertigarzneimittels verwendet. Damit kann das beantragte Cannabis nicht verordnet werden, so dass eine Kostenübernahme durch die Beklagte gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V nicht in Betracht kommt. Mangels der Eigenschaft als Fertigarzneimittel ist auch keine Verordnungsfähigkeit als Rezepturarzneimittel entsprechend der Anlage 3 zum BtMG gegeben, da es sich insoweit um eine Zubereitung handeln muss, die als Fertigarzneimittel zugelassen ist.
Insoweit verweist der Senat auch auf den Beschluss im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, in dem bereits ausgeführt wurde: „Cannabisblüten sind, sofern sie zur Herstellung von Zubereitungen zu medizinischen Zwecken bestimmt sind, in Anlage II des BTMG gelistet und damit zwar verkehrsfähig, aber betäubungsmittelrechtlich nicht verschreibungsfähig. Der Senat geht nach summarischer Prüfung davon aus, dass damit auch sozialversicherungsrechtlich (§ 73 Abs. 2 Nr. 7 SGB V) eine Verordnungsfähigkeit nicht gegeben ist, weil das Betäubungsmittelrecht bereits eine auch sozialrechtlich bindende Schranke für die Leistungspflicht der GKV bildet. Auf eine ordnungsgemäße Verschreibung (= Verordnung) kann auch nicht verzichtet werden, da es sich bei der begehrten Cannabistherapie zu Lasten der GKV um eine ärztliche Behandlung im Sinne des § 15 Abs. 1, § 20 Abs. 1 SGB V handeln muss, d.h. eine Selbsttherapie, wie sie von der erteilten Erlaubnis der Bundesopiumstelle umfasst ist, nicht ausreicht. Die erteilte Erlaubnis bedingt lediglich die straffreie Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr, demzufolge kann auch die von der behandelnden Ärztin Dr. K. abgegebene Erklärung vom 16.4.2014 keine den Vorschriften des SGB V (§ 27 Abs. 1 Nr. 3 SGB V) entsprechende ärztliche Verordnung darstellen (vgl. Beschluss des Senats vom 7.01.2014, L 4 KR 420/13 B ER). ( …)“ (Bayer. Landessozialgericht, Beschluss vom 18. März 2016, a.a.O., S. 6/7).
Auch fehlte es für eine Schmerztherapie mit Cannabisblüten an einer nach § 135 SGB V erforderlichen entsprechenden Anwendungsempfehlung des G-BA (vgl. auch LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 25. August 2016, Az.: L 1 KR 340/16 B ER – juris Rn. 6).
Ein Anspruch besteht auch nicht nach § 35 c SGB V bzw. den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen des off-label-use (z.B. BSG, Urt. v. 13. Dezember 2016, Az.: B 1 KR 1/16 R). Die Anwendung von § 35 c SGB V scheidet bereits deshalb aus, weil es sich bei den begehrten Cannabisblüten um kein Fertigarzneimittel handelt, das nach dem Arzneimittelgesetz einer Zulassung bedürfte. Ein in Deutschland zugelassenes Fertigarzneimittel, das lediglich Medizinal-Cannabisblüten enthält, gab es nicht.
Ein off-label-use kommt auch darüber hinaus nicht in Betracht. Dieser kommt nach der Rechtsprechung (vgl. BSGE 97, 112; 109, 211; BSG, Urt. v. 13. Dezember 2016, Az.: B 1 KR 1/16 R – juris) nur dann in Betracht, wenn es – um die Behandlung einer schwerwiegenden (lebensbedrohlichen oder die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigenden) Erkrankung geht, – keine andere Therapie verfügbar ist und – aufgrund der Datenlage die begründete Aussicht besteht, dass mit dem betreffenden Präparat ein Behandlungserfolg (kurativ oder palliativ) erzielt werden kann.
Dabei ist auf die im jeweiligen Zeitpunkt der Behandlung vorliegenden Erkenntnisse abzustellen (BSGE 95, 132). Es müssen Forschungsergebnisse vorliegen, die erwarten lassen, dass das betroffene Arzneimittel für die relevante Indikation zugelassen werden kann. Das BSG stellt hierbei auf Erkenntnisse in der Qualität einer kontrollierten klinischen Prüfung der Phase III ab (BSG v. 13. Dezember 2016, a.a.O., juris Rn. 16 m.w.N.). Vorliegend liegen jedoch unstreitig, wie auch das Ergebnis der mündlichen Verhandlung ergeben hat, keine aussagekräftigen Studien bezogen auf das Krankheitsbild des Klägers vor. Auch der MDK hat ausgeführt, dass zur Behandlung mit Cannabis bisher keine evidenzbasierten Studien vorliegen. Er weist darauf hin, dass im Gegenteil kürzlich Hinweise auf die potentielle kardiovaskuläre Toxizität der Substanz publiziert wurden (Thomas, Kloner, Rezkalle, Adverse cardiovascular, cerebrovascular and peripheral vascular effects of Marijuana inhalation: „What Cardiologists need to know“, in: AM J. Kardiol 2014, 113 (1: 187 – 190); Hartung, Kauferstein u.a., Sudden unexpected death under acute influence of Cannabis, in: Forensic SCI INT 2014, 237: e. 11 – 13). Schließlich weist auch die behandelnde Internistin Dr. K. darauf hin, dass zu Cannabis keine evidenzbasierten Studien vorlagen.
Der Kläger hat sich daher im Berufungsverfahren vor allem auf eine lebensbedrohliche bzw. vergleichbare Erkrankung bezogen und sich dabei auf den Beschluss des BVerfG vom 6. Dezember 2005 (BVerfG, a.a.O.) gestützt. Ein Anspruch besteht allerdings auch nicht im Hinblick auf diesen sog. Nikolausbeschluss des BVerfG bzw. nach § 2 Abs. 1 a SGB V (eingefügt mit Gesetz vom 22. Dezember 2011, BGBl. I S. 2983). Nach § 2 Abs. 1 a S. 1 SGB V können Versicherte mit einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung oder mit einer zumindest wertungsmäßig vergleichbaren Erkrankung, für die eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht, auch eine nach Absatz 1 Satz 3 abweichende Leistung beanspruchen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht. Eine für die Bejahung des Leistungsanspruchs unter diesem Gesichtspunkt erforderliche notstandsähnliche Situation liegt nur dann vor, wenn ohne die streitige Behandlung sich ein tödlicher Krankheitsverlauf innerhalb eines kürzeren, überschaubaren Zeitraums mit großer Wahrscheinlichkeit verwirklichen wird oder ein nicht kompensierbarer Verlust eines wichtigen Sinnesorgans oder einer herausgehobenen Körperfunktionen akut droht (z.B. BSG, Urteil vom 17. Dezember 2013 – B 1 KR 70/12 R sowie BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 26. März 2014 – 1 BvR 2415/13 – juris). Diese Voraussetzungen wurden von der Rechtsprechung z.B. bereits im Falle einer multiplen Sklerose (BSG, vom 27. März 2007 – B 1 KR 17/06 R) sowie für eine infantile Zerebralparese mit spastischer Paraparese der Beine (BSG, Urteil vom 8. November 2011 – B 1 KR 19/10 R) verneint.
Die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 a S. 1 SGB V liegen im Falle des Klägers nach Überzeugung des Senats nicht vor. Dies gilt zunächst im Hinblick auf das Krankheitsbild des Klägers in Form hereditärer und idiopathischer Neuropathien. Hierbei kommt es durch rezidivierende Drucklähmungen peripherer Nerven zu erheblichen Schmerzen. Grundsätzlich sind Schmerzzustände nicht lebensbedrohend (so z.B. auch LSG Berlin-Brandenburg, a.a.O., juris – Rn. 3 u. 6). Die behandelnde Ärztin Dr. K. hat zwar in ihrer Äußerung vom 2. September 2014 die Ansicht vertreten, dass nach ihrer Einschätzung die Erkrankung wertungsgleich einer lebensbedrohlichen Erkrankung sei. Sie hat dies mit einem zunehmenden Untergewicht und einer Abnahme der Kräfte begründet. Bei dem Untergewicht des Klägers sei nicht von der Hand zu weisen, dass bei weiterer kontinuierlicher Gewichtsabnahme dies auch auf durchaus absehbare Zeit zum Tod führen würde.
Der Senat hält wie bereits in der Entscheidung im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes daran fest, dass das beim Kläger vorliegende Krankheitsbild zwar sehr beeinträchtigende Zustände mit sich gebracht hat, von einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder einer diesem Zustand gleichzusetzenden, zum Beispiel mit dem Verlust eines Sinnesorgans einhergehenden Erkrankung aber nicht auszugehen ist. Eine existenziell bedeutsame Leistung der Krankenversicherung steht daher nach Auffassung des Senats nicht im Raum (BVerfG vom 29. November 2007, 1 BvR 2496/07, Rn. 16).
Auch nach den Feststellungen des MDK vom Juli 2014 im Widerspruchsverfahren lag keine lebensbedrohliche oder regelmäßig tödliche Erkrankung oder zumindest wertungsmäßig vergleichbare Erkrankung vor. Eine derartige Erkrankung wird auch nicht von der Internistin in dem dem Antrag beigefügten Arztbericht vom 16. April 2014 benannt. Dieser wird darauf gestützt, dass ein seltenes Krankheitsbild mit Neigung zu Druckparesen vorliegt. Im Vordergrund standen ganz offensichtlich die erheblichen Schmerzen, die der Kläger hatte. Die Ärztin beschreibt zwar, dass „generalisiert auch eine erhebliche Kraftminderung“ gegeben sei, beschreibt das Krankheitsbild aber damals deutlich weniger dramatisch als im September 2014. Das Gewicht war bis April 2014 zwar von 83 kg auf 62 kg zurückgegangen, als Gründe für die Cannabistherapie wurden jedoch angegeben: (1) Verbesserte Schmerzbehandlung mit günstigerem Nebenwirkungsprofil (2) Rückgang der Krampfneigung an der Extremitätenmuskulatur (3) Besserung der Lebensqualität und Stabilisierung des Körpergewichts und damit der körperlichen Leistungsfähigkeit.
Ein Erkrankungszustand vergleichbar einer lebensbedrohlichen Situation wurde nicht beschrieben und lässt sich aus dem Antrag auch nicht konstatieren. Die Begründung erscheint im Hinblick auf den Prozessverlauf nachgeschoben, zumal sich auch aus den Arztbriefen der Kliniken der Kreisspitalstiftung W. über kurzfristige stationäre Aufenthalte keine lebensbedrohliche Situation oder eine wertungsmäßig vergleichbare Erkrankung ergibt. Die Behandlung erfolgte dort wegen funktioneller Magenentleerungsstörungen, Übelkeit, Erbrechen, die bereits am nächsten Tag nicht mehr vorhanden waren, so dass der Kläger wieder entlassen werden konnte. Als Empfehlungen wurden (lediglich) eine Vorstellung in einer Schmerzambulanz bzw. eine Optimierung der Medikation abgegeben. Der Senat teilt auch nicht die vom Kläger in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Ansicht, dass im August 2015 bereits eine lebensbedrohliche Situation vorgelegen habe, die zur mehrmaligen notfallmäßigen Aufnahme in ein Krankenhaus geführt habe. Zum einen wurde bereits oben ausgeführt, dass sich aus den Arztbriefen der Kliniken der Kreisspitalstiftung W. vom 8. Juli 2015 und 11. August 2015 über kurzfristige stationäre Aufenthalte keine lebensbedrohliche Situation oder eine wertungsmäßig vergleichbare Erkrankung ergibt. Zum anderen waren die Krankenhausaufenthalte trotz laufender Cannabistherapie notwendig geworden. Dies ergibt sich einerseits aus der Epikrise der Arztbriefe, nach der der Kläger unter einer Cannabis- und einer Buprenorphintherapie stand. Andererseits ergibt sich aus der Auflistung der Rathaus-Apotheke P., dass der Kläger sowohl im Juli 2015 als auch im August 2015 regelmäßig die nach seinen Ausführungen seinen Bedarf deckenden Mengen (110 g/Monat) an Bedrocan bezogen hat.
Schließlich ist auch nicht vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 a S. 1 SGB V auszugehen, falls der Kläger weder Cannabis als Schmerzmittel genommen hätte noch – aufgrund der Nebenwirkungen – eine Therapie mit Buprenorphin, Pregabalin oder Tilidin fortgeführt hätte. Nach Ansicht des MDK ist nicht belegt, dass sonstige Schmerztherapien bisher überhaupt bzw. in ausreichend hoher Dosis und über ausreichend lange Zeit zur Anwendung gekommen waren. Zur Behandlung neuropathischer Schmerzen sind nach Darstellung des MDK in seiner Stellungnahme vom 25. Juli 2014 vier systemisch verabreichte Substanzgruppen empfohlen, nämlich Antidepressiva, Antikonvulsiva mit Wirkung am Calciumkanal, Antikonvulsiva mit Wirkung am Natriumkanal und Opioide. Soweit die behandelnde Ärztin Dr. K. hiergegen Einwendungen erhebt, kann der Senat dies offen lassen, da zu berücksichtigen ist, dass der Kläger, wie sich aus den Arztbriefen des Krankenhauses vom Juli und August 2015 ergibt, tatsächlich neben Cannabis auch weiterhin unter „Dauertherapie mit … Buprenorphin“ stand, somit also auch diese Therapie fortführte. Dies spricht im Übrigen auch dafür, dass es sich bei den von Dr. K. im Rahmen der Antragstellung bescheinigten Nebenwirkungen der Therapie mit Buprenorphin wie Müdigkeit, Trägheit, Appetitmangel, Obstipation, Übelkeit und Störungen im Temperaturempfinden, gelegentlichen Entzugserscheinungen und bei Erhöhung der Dosierung im Rahmen von Schmerzspitzen Lethargie und unkontrolliertem Zucken der Augen bzw. bei der Therapie mit Pregabalin in Form von Übelkeit, Schwindel und Benommenheit nur um – wenn auch zum Teil beträchtliche – Unannehmlichkeiten und Beeinträchtigungen handelt.
Ein Anspruch auf die Versorgung mit Medizinal-Cannabisblüten aufgrund eines Ausnahmefalls eines sogenannten Seltenheitsfalls oder sog. Systemversagens liegt nicht vor. Ein Seltenheitsfall ist gegeben bei einer Krankheit, die weltweit nur extrem selten auftritt und die deshalb im nationalen wie im internationalen Rahmen weder systematisch erforscht noch systematisch behandelt werden kann (vgl. BSG, Urteil vom 8. September 2009 – B 1 KR 1/09 R und 19. Oktober 2004 – B 1 KR 27/02 R zitiert nach juris). Zwar handelt es sich bei der Erkrankung des Klägers um ein relativ seltenes Krankheitsbild. Es ist aber ausgeschlossen, für die Seltenheitsfälle allein auf die Häufigkeit einer Erkrankung abzustellen (BSGE 111, 168; BSG v. 13. Dezember 2016, a.a.O., juris Rn. 22).
Die Erkrankung wird durch die Gabe der Cannabisblüten nicht geheilt. Es wird auch nicht vorgetragen, dass die Cannabisblüten auf die Grunderkrankung heilend einwirken sollen, behandelt werden sollen vielmehr die vorhandenen Schmerzzustände. Für Schmerzzustände stehen aber zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, so dass also eine systemische Behandlung zwar nicht möglich ist, aber eine systematische Behandlung in Form einer Schmerztherapie durchaus denkbar ist, wie auch der MDK mehrfach ausgeführt hat (so der Senat auch bereits in dem Beschluss vom 18. März 2016, a.a.O.). Hinzukommen die o.g. wissenschaftlichen Bedenken beim Einsatz von Cannabis.
Die Berufung ist daher zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG. Zwar bewilligte die Beklagte während des Berufungsverfahrens mit Bescheid vom 27. März 2017 eine Kostenübernahme für die Cannabistherapie für die Zukunft, eine kostenmäßige Belastung der Beklagten ist diesbezüglich jedoch nicht angezeigt, da dies auf einer Neufassung des § 31 Abs. 6 SGB V beruhte und die Beklagte unverzüglich ihre Leistungspflicht anerkannt hat. Eine Kostenbeteiligung der Beklagten ist daher nicht sachgerecht (s.a. Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/ Schmidt, SGG, 12. Aufl., § 193 Rn. 12 c und 12 d m.w.N.).
Gründe für die Zulassung der Revision bestehen nicht (§ 160 Abs. 2 SGG).