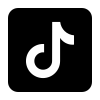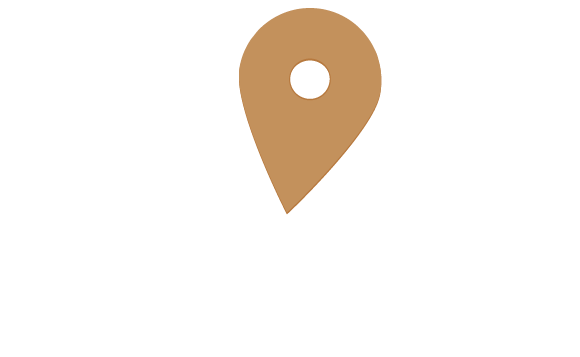Aktenzeichen W 1 K 16.23
VwGO VwGO § 113 Abs. 5 S. 1
BayBG BayBG Art. 96 Abs. 2 S. 1
BayBhV BayBhV § 2, § 3, § 7 Abs. 1 S. 1
Leitsatz
1 Die gesundheitliche Absicherung im Wege der gesetzlichen Krankenversicherung auf der einen und der Beihilfe auf der anderen Seite sind nicht miteinander vergleichbar, sondern weisen wesentliche Strukturunterschiede auf, so dass der Beamte einen Anspruch auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG mit der Verfahrensweise in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht geltend machen kann. (redaktioneller Leitsatz)
2 Die gesetzliche Krankenversicherung steht im Gegensatz zu der privaten Eigenvorsorge des Beamten und der lediglich ergänzenden nachrangigen Unterstützung durch den Dienstherrn. Die Krankheitsvorsorge aufgrund von Beihilfe und Privatversicherung unterscheidet sich von der gesetzlichen Krankenversicherung im Hinblick auf ihre verfassungsrechtliche Verankerung, die Finanzierung, die Leistungsvoraussetzungen, das Leistungsspektrum und die Leistungsformen. (redaktioneller Leitsatz)
3 Welche Leistungen von der Beihilfe im Krankheitsfall erbracht werden, obliegt allein der Bestimmung durch den jeweiligen Normgeber, der die Beihilfevorschriften erlassen hat, und dem hierbei ein weiter Gestaltungsspielraum zukommt. (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor in gleicher Höhe Sicherheit leistet.
Gründe
Die Klage ist zulässig, jedoch unbegründet, da die Klägerin keinen Anspruch auf Erstattung der streitgegenständlichen Aufwendungen für die bei ihrem Sohn vorgenommene Operation zur Korrektur der Ohren im Rahmen der Beihilfevorschriften hat. Die ergangenen Behördenbescheide sind vielmehr rechtmäßig und verletzen die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).
Gemäß Art. 96 Abs. 2 Satz 1 BayBG werden Beihilfeleistungen zu den nachgewiesenen medizinisch notwendigen und angemessenen Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Pflegefällen und zur Gesundheitsvorsorge des Beamten bzw. der Beamtin sowie berücksichtigungsfähige Angehöriger nach Maßgabe der aufgrund von Art. 96 Abs. 5 Satz 1 BayBG erlassenen Rechtsverordnung (Bayer. Beihilfeverordnung – BayBhV) gewährt. Maßgeblich ist im vorliegenden Falle, die seit dem 1. Oktober 2014 gültige Fassung der Bayer. Beihilfeverordnung. Aufwendungen der beihilfeberechtigten Personen sowie ihrer berücksichtigungsfähigen Angehörigen (§§ 2, 3 BayBhV) in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und sonstigen Fällen sind beihilfefähig, wenn sie dem Grunde nach medizinisch notwendig und der Höhe nach angemessen sind und die Beihilfefähigkeit nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist (§ 7 Abs. 1 Satz 1 BayBhV).
Der beihilferechtliche Begriff der „medizinischen Notwendigkeit“ von Aufwendungen als Voraussetzung für die Beihilfegewährung setzt voraus, dass die Aufwendungen für eine medizinisch gebotene Behandlung entstanden sind, die der Wiedererlangung der Gesundheit, der Besserung oder Linderung von Leiden sowie der Beseitigung oder zum Ausgleich körperlicher Beeinträchtigungen dient. Entsprechend dem Zweck der Beihilfengewährung müssen die Leiden und körperlichen Beeinträchtigungen Krankheitswert besitzen. Die Behandlung muss darauf gerichtet sein, eine Krankheit zu therapieren. Da die Vorschriften der bayerischen Beihilfeverordnung keinen eigenständigen Krankheitsbegriff statuieren, ist grundsätzlich auf den sozialversicherungsrechtlichen Krankheitsbegriff nach § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V und die dazu ergangene Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zurückzugreifen (vgl. BVerwG, B.v. 30.9.2011 – 2 B 66/11 – juris m.w.N.). Eine Krankheit i.S.d. Norm ist ein regelwidriger, vom Leitbild – nicht dem Idealbild – des gesunden Menschen abweichender Körper- oder Geisteszustand, der ärztlicher Behandlung bedarf oder den betroffenen arbeitsunfähig macht. Krankheitswert im Rechtssinne kommt dabei nicht jeder körperlichen Unregelmäßigkeit zu. Erforderlich ist vielmehr, dass die Person in ihren Körperfunktionen beeinträchtigt wird oder dass sie an einer Abweichung vom Regelfall leidet, die entstellend wirkt (vgl. BSG, U.v. 28.2.2008 – B 1 KR 19/07 – juris; OVG Hamburg, B.v. 18.2.2009 – 1 Bf 108/08.Z – juris). Um eine Entstellung annehmen zu können, genügt nicht jede körperliche Anormalität. Vielmehr muss es sich objektiv um eine erhebliche Auffälligkeit handeln, die naheliegende Reaktionen der Mitmenschen wie Neugier oder Betroffenheit hervorruft und damit zugleich erwarten lässt, dass der Betroffene ständig viele Blicke auf sich zieht, zum Objekt besonderer Beachtung anderer wird und sich deshalb aus dem Leben in der Gemeinschaft zurückzuziehen und zu vereinsamen droht, so dass die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefährdet ist. Um eine Auffälligkeit eines solchen Ausmaßes zu erreichen, muss eine beachtliche Erheblichkeitsschwelle überschritten sein. Es genügt nicht allein ein markantes Gesicht oder generell die ungewöhnliche Ausgestaltung von Organen, etwa die Ausbildung eines sechsten Fingers an einer Hand. Vielmehr muss die körperliche Auffälligkeit in einer solchen Ausprägung vorhanden sein, dass sie sich schon bei flüchtiger Begegnung in alltäglichen Situationen quasi „im Vorbeigehen“ bemerkbar macht und regelmäßig zur Fixierung des Interesses anderer auf den Betroffenen führt. Dies gilt gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Rechtsordnung im Interesse der Eingliederung behinderter Menschen fordert, dass nicht behinderte Menschen ihre Wahrnehmung von Behinderung korrigieren müssen. Die Feststellung, dass im Einzelfall ein Betroffener wegen einer körperlichen Anormalität an einer Entstellung leidet, ist in erster Linie Tatfrage (vgl. zum Ganzen BSG, a.a.O.).
Unter Beachtung dieser Grundsätze ist zunächst feststellen, dass die konkrete anatomische Ausprägung der Ohren des Sohnes der Klägerin diesen nicht in seinem Hörvermögen und damit nicht in seinen Körperfunktionen beeinträchtigt hat, wie sich u.a. der Stellungnahme des Universitätsklinikums Freiburg vom 17. Dezember 2015 entnehmen lässt. Diesbezüglich ist auch ansonsten von der Klägerseite nichts vorgetragen worden. Ausgehend von den dargestellten Maßstäben ist das Gericht darüber hinaus auch der Überzeugung, dass die Ohren des Sohnes der Klägerin vor der Durchführung der hier streitgegenständlichen Operation nicht entstellend gewirkt haben. Wie aus dem vorgelegten Bildmaterial ersichtlich ist, stehen die Ohren des Sohnes der Klägerin zwar etwas weiter ab als dies bei der Mehrheit der Bevölkerung der Fall ist. Das Erscheinungsbild der Ohren ist jedoch in keiner Weise so hervorstechend, dass die geforderte beachtliche Erheblichkeitsschwelle überschritten wird. Dass der Sohn der Klägerin zum Objekt besonderer Beachtung seiner Umwelt würde und schon bei flüchtiger Begegnung im Alltag das Interesse anderer auf sich fixieren würde, ist in keiner Weise ersichtlich. Das Ausmaß der Abweichung fällt nach Überzeugung des Gerichts vielmehr nicht erheblich aus und springt dem Betrachter auch nicht einmal unmittelbar ins Auge. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Fehlstellung der Ohren vorliegend eine Asymmetrie aufweist. Allerdings ist auch diese nicht geeignet, beim objektiven Betrachter das Bild einer entstellenden Wirkung hervorzurufen, zumal die Asymmetrie nur geringfügig ausfällt, wie sich neben den vorgelegten Bildern auch der Stellungnahme des Universitätsklinikums Freiburg vom 17. Dezember 2015 entnehmen lässt, wonach der Mastoid-Helix-Randabstand 28 bzw. 27mm beträgt – mithin zwischen beiden Ohren ein Unterschied von nur 1 mm besteht. Des Weiteren erscheinen die Ohrmuscheln im Übrigen für den neutralen unbefangenen Betrachter normal ausgeprägt; sie weisen im Erscheinungsbild zumindest keine erkennbaren Besonderheiten auf, wie sich ebenfalls dem vorgelegten Bildmaterial aus der Seitenansicht ergibt. Schließlich ist auch zu beachten, dass es sich bei abstehenden Ohren keineswegs um ein Einzelphänomen handelt und die Ausprägungsformen der menschlichen Ohrmuschel – wie allgemein bekannt ist – eine hohe Variantenzahl aufweist. Schließlich kann auch aus dem vom Universitätsklinikum Freiburg bestätigten Mastoid-Helix-Winkel von „deutlich über 45 Grad“ nicht per se eine entstellende Wirkung hergeleitet werden. Entsprechend dem von der Klägerseite vorgelegten Aufsatz aus dem deutschen Ärzteblatt 97, Heft 4, vom 28. Januar 2000 ergibt sich, dass Ohren überhaupt erst ab einem Muschel-Schädel-Winkel von mehr als 45 Grad als abstehend bezeichnet werden. Zur Überzeugung des Gerichts können jedoch Ohren, die aus ärztlicher Sicht als abstehend zu bezeichnen sind, noch nicht mit einer entstellenden Wirkung gleichgesetzt werden. Denn auch abstehende Ohren weisen in ihrem Ausprägungsgrad eine erhebliche Variantenvielfalt auf, wobei vorliegend – wie dargelegt – die Schwelle zur entstellenden Wirkung gerade nicht überschritten ist. Auch ist im hiesigen Fall nicht entscheidend, welche medizinische Einschätzung das Universitätsklinikum Freiburg zu der Frage einer entstellenden Wirkung vertritt, nachdem es sich bei der Bewertung, ob eine entstellende Wirkung gegeben ist, nicht um eine medizinische Fachfrage handelt.
Darüber hinaus leidet der Sohn der Klägerin auch nicht an einer psychischen Erkrankung als Folge der von der Klägerin angenommenen entstellenden Wirkung der abstehenden Ohren. Die Klägerin berichtet insoweit lediglich sehr vage im Schreiben vom 29. November 2015 davon, dass „befürchtete Hänseleien im Zeitraum zwischen der Voruntersuchung und der Operation bereits eingetreten seien“. Dass diese zu einer Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit ihres Sohnes geführt hätten, wurde weder diagnostiziert noch vorgetragen. Aber selbst das Vorliegen einer psychischen Belastung würde keinen operativen Eingriff auf Kosten der beamtenrechtlichen Beihilfe rechtfertigen. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts fehlt es nämlich an der Notwendigkeit i.S.d. § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V für operative Eingriffe in den gesunden Körper, durch die psychischen Krankheiten entgegengewirkt werden soll, die auf einem subjektiv als unzulänglich empfundenen körperlichen Zustand ohne Krankheitswert zurückzuführen sind. Denn nach dem gegenwärtigen Stand der medizinischen Erkenntnisse ist generell zweifelhaft, ob derartige Eingriffe zur Überwindung einer psychischen Krankheit geeignet sind. Die psychischen Wirkungen der körperlichen Veränderungen können nicht eingeschätzt werden, insbesondere ist nach dem Eingriff eine Symptomverschiebung zu besorgen. Hinzu kommt, dass der operative Eingriff dem subjektiven Empfinden des Betroffenen geschuldet ist, der eine körperliche Eigenschaft als belastend empfindet und sich damit nicht abfindet. Letztlich müssten kosmetische Operationen auf Kosten der Allgemeinheit durchgeführt werden, wenn psychotherapeutische Maßnahmen nicht helfen, weil der Betroffene auf einen Eingriff fixiert ist (vgl. BSG, U.v. 28.2.2008 – B 1 KR 19/07 – juris; BVerwG, B.v. 30.9.2011 – 2 B 66/11 – juris). Wenn aber eine Operation bereits bei eingetretenen psychischen Erkrankungen nicht erstattungsfähig ist, so gilt dies erst recht bei nur subjektiv – hier durch Erziehungsberechtigte – prognostizierte Probleme und Beschwerden. Dass derartige Probleme entstehen, stellt nach Überzeugung des Gerichts zudem auch keinesfalls den Regelfall dar, sondern ist von einer Vielzahl weiterer äußerer Einflussfaktoren abhängig, wie etwa dem anderweitig vermittelten Selbstbewusstsein des jeweiligen Kindes, der Umgebung, in der es aufwächst, sowie dem sich derzeit im Rahmen des Inklusionsgedankens wandelnden Gesellschaftsbild zu nicht der „Norm“ entsprechenden Menschen.
Schließlich kann auch der klägerische Vortrag, wonach Operationen der vorliegenden Art bei Kindern bis zum Alter von 12 Jahren üblicherweise sowohl von den gesetzlichen als auch den privaten Krankenversicherungen übernommen werden, zu keinem anderen Ergebnis führen. Eine Orientierung an diesem Vorgehen ist insbesondere nicht deshalb angezeigt, weil die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zur Bestimmung des Krankheitsbegriffs auf die sozialgerichtliche Rechtsprechung und den Krankheitsbegriff aus dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung zurückgreift. Dies ist nämlich nur deshalb der Fall, weil die Beihilfevorschriften den Krankheitsbegriff nicht gesondert definieren. Welche Leistungen jedoch im Krankheitsfall erbracht werden, obliegt allein der Bestimmung durch den jeweiligen Normgeber, vorliegend demzufolge durch den Beklagten, dem hierbei ein weiterer Gestaltungsspielraum zukommt. Die gesundheitliche Absicherung im Wege der gesetzlichen Krankenversicherung auf der einen und der Beihilfe auf der anderen Seite sind nicht miteinander vergleichbar, sondern weisen wesentliche Strukturunterschiede auf, so dass der Beamte einen Anspruch auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG mit der Verfahrensweise in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht geltend machen kann. Bei den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung handelt es sich um Leistungen aus öffentlichen Kassen, die der grundsätzlich umfassenden Sicherung des Betroffenen und seiner Familie in Krankheitsfällen dienen. Die gesetzliche Krankenversicherung steht im Gegensatz zu der privaten Eigenvorsorge des Beamten und der lediglich ergänzenden nachrangigen Unterstützung durch den Dienstherrn. Die Krankheitsvorsorge aufgrund von Beihilfe und Privatversicherung unterscheidet sich von der gesetzlichen Krankenversicherung im Hinblick auf ihre verfassungsrechtliche Verankerung, die Finanzierung, die Leistungsvoraussetzungen, das Leistungsspektrum und die Leistungsformen. Prägende Grundsätze der gesetzlichen Krankenversicherung sind vor allem die solidarische Finanzierung, der soziale Ausgleich, die Sach- und Dienstleistung als Leistungsform sowie die Organisation ihrer Träger als Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts (vgl. BVerwG, U.v. 15.12.2005 – 2 C 35/04 – juris). Schließlich ist auch ein Verstoß gegen die verfassungsrechtliche in Art. 33 Abs. 5 GG verankerte Fürsorgepflicht vorliegend nicht ersichtlich. Es ist nämlich weder vorgetragen noch erkennbar, dass die Klägerin mit erheblichen finanziellen Aufwendungen belastet bliebe, die sie in nicht mehr zumutbarer Weise aus ihrer Alimentation bestreiten müsste. Vielmehr ist die (endgültige) Zahlung der hier ungedeckten einmaligen Kosten in Höhe von 1.359,36 EUR der Klägerin zuzumuten.
Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.