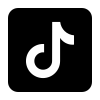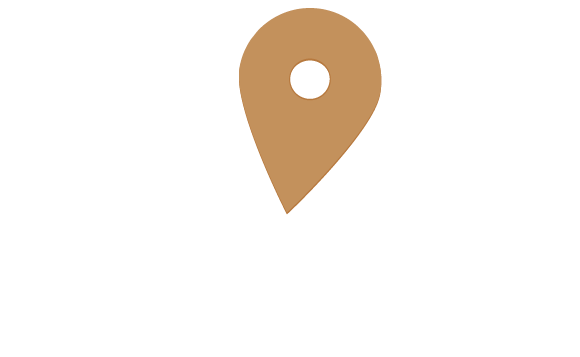Aktenzeichen M 12 K 15.5504
BayBeamtVG BayBeamtVG Art. 46
Leitsatz
Unfallbedingte Körperschäden, die erst im Laufe der Zeit bemerkbar werden, können auch später noch als weitere Dienstunfallfolgen anerkannt werden. Enthält eine Bescheid allerdings die Feststellung, dass „Beschwerden im psychischen Bereich“ nicht auf den Dienstunfall zurückzuführen sind und ergibt die Auslegung unter Heranziehung der vorgelegten Atteste, dass hiermit eine PTB nicht als Dienstunfallfolge anerkannt wurde, ist die Anerkennung einer PTB wegen desselben Unfalls auf erneuten Antrag nur möglich, wenn die Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen des Verfahrens vorliegen. (redaktioneller Leitsatz)
Ein Anspruch auf Wiederaufgreifen wegen neuer Beweismittel (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG) ergibt sich nicht aus einem neuen Gutachten desselben Neurologen, das bei gleicher Symptomatik zur geänderten Einschätzung gelangt, dass nunmehr eine PTB feststehe. Denn ein Sachverständigengutachten ist nur dann ein neues Beweismittel, wenn es selbst auf neuen, seinerzeit nicht bekannten Tatsachen beruht und nicht nur eine neue Bewertung vornimmt. (redaktioneller Leitsatz)
Ein neues Gutachten ist nicht geeignet, eine günstigere Entscheidung herbeizuführen, wenn es selbst die PTB nicht sicher feststellt und den Anforderungen der Rechtsprechung an die Diagnose einer PTB nicht genügt. Zudem ist ein Verkehrsunfall mit leichten körperlichen Verletzungen kein hinreichend schweres Ereignis, um bei gebotener objektiver Betrachtung eine PTB auszulösen. (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
I.
Die Klage wird abgewiesen.
II.
Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
III.
Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Gründe
Verfahrensgegenstand ist vorliegend der Bescheid des Beklagten vom 30. Juli 2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 29. Oktober 2015, mit dem der Antrag des Klägers auf Wiederaufgreifen des Verfahrens abgelehnt worden ist.
Die sich hiergegen richtende Klage ist zulässig, aber unbegründet.
I.
Der Kläger hat weder nach Art. 51 des Bayerischen Verfahrensgesetzes (BayVwVfG) noch unter dem Gesichtspunkt des sogenannten Wiederaufgreifens im weiteren Sinne (Art. 51 Abs. 5 i. V. m. Art. 48, 49 BayVwVfG) einen Anspruch auf Wiederaufgreifen des mit Bescheid vom 31. Januar 2012 abgeschlossenen Verfahrens. Damit besteht auch kein Anspruch auf die Anerkennung einer posttraumatischen Belastungsstörung als weitere Unfallfolge des am 14. November 2011 erlittenen Dienstunfalls (§ 113 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). Der den Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens ablehnende Bescheid vom 30. Juli 2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 29. Oktober 2015, erweist sich vielmehr als rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).
1. Ein Anspruch des Klägers auf die beantragte Anerkennung einer posttraumatischen Belastungsstörung als weitere Unfallfolge des Dienstunfalls vom 14. November 2011 kommt vorliegend nur dann in Betracht, wenn ihm zugleich ein Anspruch auf Wiederaufgreifen des mit Bescheid vom 31. Januar 2012 bereits abgeschlossenen Verwaltungsverfahrens zusteht. Denn entgegen dem Vorbringen der Klagepartei ist hier davon auszugehen, dass der Beklagte bereits mit Bescheid vom 31. Januar 2012 verbindlich darüber entschieden hat, dass die beim Kläger bestehenden psychischen Beschwerden, die laut Attest von Herrn Dr. med. P. als eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu klassifizieren sind, nicht auf den Dienstunfall vom 14. November 2011 zurückzuführen sind und damit nicht als weitere Unfallfolgen anerkannt werden können. Die Argumentation der Klagepartei, wonach es sich bei der PTBS um einen erstmals im Juni 2015 bemerkbar gewordenen, neuen Körperschaden handelt, geht fehl.
Zwar weist die Klägerbevollmächtigte zutreffend darauf hin, dass dienstunfallbedingte Körperschäden, die erst im Laufe der Zeit bemerkbar werden, auch noch zu einem späteren Zeitpunkt als weitere Dienstunfallfolgen anerkannt werden können, sofern sie dem Dienstherrn innerhalb der in Art. 47 BayBeamtVG vorgesehenen Ausschlussfristen gemeldet werden. Entgegen der Auffassung des Klägers kann vorliegend jedoch nicht angenommen werden, dass es sich bei der mit Attest vom 22. Juni 2015 diagnostizierten PTBS um einen solchen, erstmals im Jahr 2015 bemerkbar gewordenen Körperschaden handelt, über dessen Anerkennung noch gar nicht mit dem Bescheid vom 31. Januar 2012 entschieden wurde. Vielmehr ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die beim Kläger im Attest vom 22. Juni 2015 nunmehr eindeutig als PTBS beschriebene Symptomatik als solche bereits Gegenstand des damaligen Verwaltungsverfahrens gewesen ist und somit vom Regelungsgegenstand der ablehnenden Entscheidung vom 31. Januar 2012 erfasst wird. Zwar wird in Ziffer 3 dieses Bescheides lediglich festgestellt, dass die „Beschwerden im psychischen Bereich“ nicht ursächlich auf den Dienstunfall zurückzuführen sind und nicht ausdrücklich die Anerkennung einer PTBS als weitere Unfallfolge abgelehnt. Inhalt und Bindungswirkung einer Regelung sind jedoch insbesondere anhand der Gründe des Bescheides näher auszulegen (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 13. Aufl. 2012, § 43 Rn. 15). Vorliegend wird aus den Gründen des Bescheides vom 31. Januar 2012 (vgl. Seiten 3 und 4 des Bescheides) deutlich, dass sich die Regelung unter Ziffer 3 nur auf diejenigen psychischen Beschwerden beziehen kann, die in den damals von Herrn Dr. med. P. eingeholten Attesten beschrieben werden. Vom Regelungsgegenstand des mit Bescheid des Beklagten vom 31. Januar 2012 abgeschlossenen Verwaltungsverfahrens erfasst ist damit auch das derzeitige Krankheitsbild des Klägers, welches sich in Verlauf, Symptomatik und Behandlungsbedürftigkeit nicht von den in den Attesten von Herrn Dr. med. P. vom 5. Dezember 2011, 12. Dezember 2011 und 9. Januar 2012 geschilderten psychischen Beschwerden unterscheidet. Es handelt sich um dieselbe psychische Erkrankung, lediglich hat Herr Dr. med. P. nunmehr klargestellt, dass er, im Gegensatz zu seinen früheren Attesten, in denen er noch nicht alle Kriterien einer PTBS als erfüllt ansah (vgl. insbesondere Attest vom 12. Dezember 2011), er nunmehr vom Vorliegen einer PTBS ausgeht. Die mit Attest vom 22. Juni 2015 diagnostizierte PTBS ist jedoch nicht als ein neuer Körperschaden anzusehen, der erstmals im Jahr 2015 zu den bereits bestehenden psychischen Beschwerden hinzugetreten wäre. Der Weg zu einer erneuten Sachentscheidung des Beklagten ist daher nur dann eröffnet, wenn dem Kläger in einem ersten Schritt auch ein Anspruch auf Wiederaufgreifen des mit Bescheid vom 31. Januar 2012 des bereits abgeschlossenen Verwaltungsverfahrens zusteht.
2. Der Kläger hat keinen Anspruch darauf, dass der Beklagte das Verfahren gemäß Art. 51 BayVwVfG wiederaufgreift und in Abänderung von Ziffer 3 des Bescheides vom 31. Januar 2012 eine posttraumatische Belastungsstörung als weitere Unfallfolge des am 14. November 2011 erlittenen Dienstunfalls anerkennt.
2.1. Nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayVwVfG hat die Behörde auf Antrag des Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung eines unanfechtbaren Verwaltungsakts zu entscheiden, wenn neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würden.
Diese Regelung soll die Wiederaufnahme eines Verfahrens in Fällen ermöglichen, in denen ein Betroffener wegen Beweisschwierigkeiten, die nunmehr behoben sind, einen Nachteil erlitten hat (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 13. Aufl. 2012, § 51 Rn. 32). Mit der Wirkung des Wiederaufgreifens, ausnahmsweise Bestands- und Rechtskraft zu durchbrechen, ist es jedoch unvereinbar, wenn ein Verfahren aufgrund neuer Beweismittel beliebig oft wiederaufgegriffen werden könnte. Ein neues, im Ausgangsverfahren noch nicht berücksichtigtes Beweismittel im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayVwVfG muss daher so beschaffen sein, dass es die Richtigkeit der tatsächlichen Entscheidungsgrundlage des Erstbescheides erschüttert. Es muss zu der sicheren Überzeugung führen können, dass die Behörde damals von falschen tatsächlichen Voraussetzungen ausgegangen ist und in Kenntnis der wirklichen Verhältnisse zugunsten des Betroffenen entschieden haben würde. An dieser Beweiseignung fehlt es, wenn sich das dem ursprünglichen Bescheid entgegengehaltene Angriffsmittel bei unveränderter Tatsachenlage darin erschöpft, der rechtlichen Bewertung dieser Tatsachen im ursprünglichen Bescheid zu widersprechen (vgl. BVerwG, U. v. 28.7.1989 – 7 C 78/88 – juris Rn. 12). Sachverständigengutachten können daher nur dann als neue Beweismittel gelten, wenn sie nach Abschluss des Verwaltungsstreitverfahrens erstellt worden sind und neue, seinerzeit nicht bekannte Tatsachen verwerten, wenn sie also selbst auf neuen Beweismitteln beruhen (BVerwG, U. v. 27.1.1994 – 2 C 12/92 – juris; BayVerfGH v.14.9.2009, Vf.58-VI-08). Fachliche Meinungen, wissenschaftliche Ansichten und bloße Folgerungen sachkundiger Personen genügen für sich gesehen hingegen regelmäßig nicht, um als Gegenstand neuer Beweismittel einen Anspruch auf Wiederaufgreifen zu begründen (BVerwG, U. v. 28.7.1989 – 7 C 78/88 – juris). Für die Zulässigkeit des Antrags auf Wiederaufgreifen des Verfahrens muss diesbezüglich auch die Eignung des neuen Beweismittels für eine günstigere Entscheidung schlüssig dargelegt werden (BayVGH, B. v. 8.11.2012 – 7 ZB 12.1196 – juris).
2.2. Gemessen an diesen Vorgaben genügen die beiden vom Kläger vorgelegten ärztlichen Stellungnahmen von Herrn Dr. med. P. vom 22. Juni 2015 und vom 9. April 2016 sowie der ebenfalls vorgelegte Bescheid des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS) vom 23. Juli 2015 nicht den Anforderungen an ein neues Beweismittel im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 BayVwVfG.
Der Beklagte hat die Feststellung, dass die psychischen Beschwerden des Klägers nicht auf den Dienstunfall vom 14. November 2011 zurückzuführen sind, im Bescheid vom 31. Januar 2012 darauf gestützt, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem geltend gemachten Körperschaden und dem Dienstunfall nicht nachweisbar sei. Der Kläger habe bereits vor dem Dienstunfall unter psychischen Beschwerden gelitten und sei offenbar selbst davon ausgegangen, dass diese in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Dienstunfall zu sehen seien. Die vom Kläger vorgelegten ärztlichen Unterlagen vermögen die Richtigkeit der den Erstbescheid tragenden tatsächlichen Feststellungen nicht zu erschüttern:
Das Attest von Herrn Dr. med. P. vom 22. Juni 2015 beinhaltet vorliegend lediglich eine andere fachliche Bewertung des bereits bekannten Sachverhalts. Zwar zieht der den Kläger behandelnde Neurologe darin – entgegen seinen früheren Attesten – aufgrund der seit dem Unfall vom 14. November 2011 beim Kläger bestehenden Symptomatik den Schluss, dass dieser ursächlich für das Entstehen einer PTBS gewesen ist. Diese Einschätzung beruht jedoch ihrerseits nicht auf neuen Tatsachen, sondern lediglich auf einer anderen fachlichen Bewertung des bereits bekannten Sachverhalts. So führt der Neurologe in seinem Attest keine neuen Tatsachen oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf, die nicht bereits in dem mit Bescheid vom 31. Januar 2011 abgeschlossenen Verwaltungsverfahren bekannt gewesen wären. Vielmehr stützt er seine geänderte Einschätzung auf dieselbe Symptomatik (deutliche Unsicherheit, Ängstlichkeit und Unruhe, Schlafstörungen, aufdrängende Erinnerungen an das Unfallgeschehen), die er bereits in seinen früheren ärztlichen Attesten beschrieben hat (vgl. insbesondere Attest vom 5. Dezember 2011: „Er fühlt sich unsicher, ängstlich, nervös, kann nicht abschalten. Häufig muss er an den Unfall denken, nachts drängen sich entsprechende Unfallbilder auf, sein Schlaf ist gestört“). Des Weiteren geht Herr Dr. med. P. unverändert von demselben, das Trauma hervorrufenden Unfallhergang aus. Auch dem Attest vom 9. April 2016 lassen sich keine neuen, zu einer für den Kläger günstigeren Entscheidung zwingende Tatsachen entnehmen. Das Attest beruht ebenfalls weder auf neuen Tatsachen noch auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern bewertet aufgrund einer neuerlichen Untersuchung des Klägers lediglich bekannte Tatsachen fachlich anders als bisher.
Schließlich stellt auch der Bescheid des ZBFS vom 23. Juli 2015 kein neues Beweismittel im vorgenannten Sinne dar. Dem Bescheid vom 23. Juli 2015 lassen sich in keiner Weise Ausführungen dazu entnehmen, dass das Versorgungsamt aufgrund neuer Tatsachen oder neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu der Einschätzung gelangt ist, dass die PTBS auf den Dienstunfall vom 14. November 2011 zurückzuführen ist.
2.3. Der Kläger hat überdies auch nicht schlüssig dargelegt, dass die von ihm vorgelegten ärztlichen Unterlagen eine für ihn günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würden, hätten diese bereits damals in das Verfahren Eingang gefunden.
Vorliegend kann bereits nicht davon ausgegangen werden, dass der den Kläger untersuchende Neurologe gesichert eine PTBS diagnostiziert hat. Zwar stellt Herr Dr. med. P. in seinem beiden Attesten vom 22. Juni 2015 und vom 9. April 2016 eine entsprechende Diagnose und führt aus, dass für ihn außer Zweifel stehe, dass sowohl ein Ereignis, welches eine PTBS bewirken konnte als auch die entsprechenden Symptome beim Kläger vorgelegen hätten (vgl. Attest vom 9. 4. 2016, letzter Absatz). Diese Ausführungen werden von Herrn Dr. med. P. in seinem Schreiben an das Gericht vom 4. Mai 2016 jedoch selbst wieder relativiert. Darin führt er aus, dass es seiner Ansicht nach viel wichtiger wäre, in einem entsprechenden Gutachten klären zu lassen, inwiefern beim Kläger die posttraumatische Störung vorliegt und wie sein Gesundheitszustand durch die Unfallfolgen einzuschätzen ist. Diese Aussage lässt darauf schließen, dass offenbar weiterhin Unsicherheiten bestehen, ob beim Kläger eine PTBS vorliegt oder nicht.
Darüber hinaus genügen die vorgelegten Atteste auch nicht den Mindestanforderungen, die nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts an die substantiierte Geltendmachung einer psychischen Erkrankung wie insbesondere einer posttraumatischen Belastungsstörung zu stellen sind. Danach muss sich aus den vorgelegten Attesten nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt hat und wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. Dazu gehören etwa Angaben darüber, seit wann und wie häufig sich der Patient in Behandlung befunden hat und ob die von ihm geschilderten Beschwerden durch die erhobenen Befunde bestätigt werden. Des Weiteren sollte das Attest Aufschluss über die Schwere der Krankheit, deren Behandlungsbedürftigkeit sowie den bisherigen Behandlungsverlauf (Medikation und Therapie) geben (vgl. BVerwG, U. v. 11. 9. 2007 – 10 C 17/07 – juris Rn. 15). Vorliegend wurde die Diagnose einer PTBS bereits von keinem Facharzt für Psychiatrie gestellt. Herr Dr. med. P. ist Facharzt für Neurologie, nicht jedoch auch für Psychiatrie.
Darüber hinaus ist vorliegend auch nicht ersichtlich, dass es sich bei dem Unfallgeschehen vom 14. November 2011 um ein Ereignis von hinreichender Schwere handelt, um eine posttraumatische Belastungsstörung hervorrufen zu können. Das Krankheitsbild der PTBS wird in dem von der Weltgesundheitsorganisation erstellten Diagnoseklassifikationssystem ICD-10 („Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“) als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde, beschrieben. Dass das behauptete traumatisierende Ereignis tatsächlich stattgefunden hat, muss dabei gegenüber dem Tatrichter und nicht gegenüber einem ärztlichen Gutachter nachgewiesen bzw. wahrscheinlich gemacht werden. Denn der objektive Erlebnisaspekt ist nicht Gegenstand der gutachterlichen ärztlichen Untersuchung. Allein mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Mitteln kann nicht sicher darauf geschlossen werden, ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses geartet war (vgl. BayVGH, U. v. 15.12.2010 – 9 ZB 10.30376). Vorliegend konnte ein solches Trauma im Sinne eines Ereignisses von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophenartigem Ausmaß dem Gericht gegenüber nicht nachgewiesen werden. Aus der Formulierung der ICD-Klassifikation „belastendes Ereignis oder Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die fast bei jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“, folgt, dass nach ICD-10 das subjektive Empfinden einer besonderen Belastung allein nicht ausreicht, um die Schwere des Ereignisses bejahen zu können. Denn „nahezu bei jedem“ bedeutet, dass es sich um ein derartig außergewöhnlich belastendes Ereignis handeln muss, dass es nicht nur bei besonders empfindsamen, sondern auch bei psychisch robusten Menschen mit einem überdurchschnittlich starken Nervenkostüm tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Für die Frage, ob ein Ereignis mit katastrophenartigem Ausmaß vorliegt, sind damit objektive Kriterien maßgebend (vgl. LSG NRW, U. v 16.5.2007 – L 17 U 127/06 – juris Rn. 25). Ein Ereignis mit katastrophenartigem Ausmaß ist dabei insbesondere bei Geschehen wie Folter, Vergewaltigung, schweren Naturkatastrophen oder Terroranschlägen anzunehmen. Bei Zugrundelegung objektiver Kriterien lässt sich vorliegend angesichts der nur leichten körperlichen Verletzungen, die beide Kraftfahrzeugführer davon getragen haben, ein außergewöhnlich belastendes Ereignis, welches mit Ereignissen wie Folter, Vergewaltigung, schweren Naturkatastrophen oder Terroranschlägen vergleichbar wäre, nicht feststellen.
Vorliegend ist auch nicht davon auszugehen, dass die Berücksichtigung des Bescheids des ZBFS vom 23. Juli 2015 zu einer anderen Bewertung des Beklagten in Bezug auf die Kausalität zwischen der geltend gemachten PTBS und dem Dienstunfall vom 14. November 2011 geführt hätte. Zwar wird in diesem Bescheid eine PTBS als Gesundheitsstörung von Seiten des Versorgungsamtes anerkannt. Der Beklagte ist an die Feststellungen des Versorgungsamtes jedoch nicht gebunden, da bei der Ermittlung des Grades der Behinderung abweichende Feststellungskriterien zugrunde gelegt werden und auch nicht unfallbedingte Körperschäden miteinbezogen werden können (vgl. BVerwG, U. v. 21.9.2000, ZBR 2001,251).
3. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen – unabhängig von den in Art. 51 Abs. 1 bis 3 BayVwVfG normierten Voraussetzungen – gemäß Art. 51 Abs. 5 i. V. m. Art. 48 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG bzw. Art. 49 Abs. 1 BayVwVfG (sog. Wiederaufgreifen im weiteren Sinne).
3.1. Ein Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß Art. 51 Abs. 5 i. V. m. Art. 48 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG besteht nicht.
Nach Art. 48 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG kann ein rechtswidriger Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.
Der Kläger konnte vorliegend weder durch Vorlage der beiden Atteste von Herrn Dr. med. P. vom 22. Juni 2015 und vom 9. April 2016 noch durch Vorlage des Bescheides des ZBFS vom 23. Juli 2015 darlegen, dass der Bescheid vom 31. Januar 2011 rechtswidrig ist.
Nach ständiger Rechtsprechung (BVerwG, U. v. 20.4.1967, II C 118.64 – juris; U. v. 18.4.2002 – 2 C 22/01 – juris; BayVGH, U. v. 2.8.2011 – 3 B 09.196 – juris) sind als Ursache im Rechtssinne auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Dienstunfallversorgung nur solche für den eingetretenen Schaden ursächlichen Bedingungen im naturwissenschaftlich-philosophischen (natürlich-logischen) Sinne anzuerkennen, die wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg nach natürlicher Betrachtungsweise zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben. Der Ursachenzusammenhang ist nicht schon dann ausgeschlossen, wenn außer dem Unfall auch andere Umstände (namentlich eine anlage- oder schicksalsbedingte Krankheit oder ein anderes Unfallereignis) als Ursachen in Betracht kommen. In derartigen Fällen ist der Dienstunfall vielmehr dann als wesentliche Ursache im Rechtssinne anzuerkennen, wenn er bei natürlicher Betrachtungsweise entweder überragend zum Erfolg (Körperschaden) beigetragen hat oder zumindest annähernd die gleiche Bedeutung für den Eintritt des Schadens hatte wie die anderen Umstände insgesamt.
Löst ein Unfallereignis ein bereits vorhandenes Leiden aus oder beschleunigt oder verschlimmert es dieses, so ist das Unfallereignis dann nicht wesentliche Ursache für den Körperschaden, wenn das Ereignis von untergeordneter Bedeutung gewissermaßen „der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte“ bei einer Krankheit, „die ohnehin ausgebrochen wäre, wenn ihre Zeit gekommen war“. Das Unfallereignis tritt dann im Verhältnis zu der schon gegebenen Bedingung (dem vorhandenen Leiden oder der krankhaften Veranlagung) derartig zurück, dass die bereits gegebene Bedingung als allein maßgeblich anzusehen ist. Nicht Ursache im Rechtsinn sind demgemäß sogenannte Gelegenheitsursachen, d. h. Ursachen, bei denen zwischen dem eingetretenen Schaden und dem Dienst eine rein zufällige Beziehung besteht, d. h. wenn die krankhafte Veranlagung oder das anlagebedingte Leiden so leicht ansprechbar waren, dass es zur Auslösung akuter Erscheinungen nicht besonderer, in ihrer Eigenart unersetzlicher Einwirkungen bedurfte, sondern auch ein anderes alltäglich vorkommendes Ereignis denselben Erfolg herbeigeführt hätte (vgl. BVerwG, U. v. 29.10.2009 – 2 C 134.07 – juris Rn. 26; U. v. 18.4.2002 – 2 C 22.01 – juris Rn. 10; OVG NRW, U. v. 6.5.1999 – 12 A 2983/96 – juris Rn. 50; Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, BeamtVG, Anm. 1 a und 5 zu § 31).
Der Grundgedanke dieser aus der gesetzlichen Unfallversicherung und der Kriegsopferversorgung übernommenen Kausaltheorie liegt darin, dass der Dienstherr nicht für Folgen haften soll, die nicht seiner Risikosphäre zugerechnet werden können. Die beamtenrechtliche Unfallfürsorge darf nicht dazu führen, dass dem Beamten jedes denkbare Risiko abgenommen wird, auch wenn es sich in gar keiner Weise aus dem Dienst ableitet; vielmehr kann nur eine solche Risikoverteilung sinnvoll sein, die dem Dienstherrn die eigentümlichen und spezifischen Gefahren der Beamtentätigkeit auferlegt, dagegen dem Beamten mindestens die Risiken belässt, die sich aus seinen persönlichen Anlagen und etwa bereits bestehenden Beeinträchtigungen seines Gesundheitszustandes ergeben. Körperschäden sind dem individuellen Lebensschicksal des Beamten und damit seinem Risikobereich zuzurechnen, wenn der Körperschaden jederzeit auch außerhalb des Dienstes bei einer im Alltag vorkommenden Belastungssituation hätte eintreten können (vgl. BVerwG, U. v. 18.4.2002 – 2 C 22/01 – juris Rn. 11).
Für das Vorliegen eines Dienstunfalls, eines Körperschadens und der Ursächlichkeit des Dienstunfalls für den Körperschaden ist grundsätzlich der volle Beweis zu erbringen. Der Beamte trägt das Feststellungsrisiko bzw. die materielle Beweislast, sowohl für das Vorliegen des behaupteten Körperschadens als auch dafür, dass die Schädigungsfolge wesentlich auf den Dienstunfall und nicht etwa auf eine anlagebedingte Konstitution zurückzuführen ist. Bleibt nach Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten im Rahmen der Amtsermittlungspflicht offen, ob die anspruchsbegründenden Voraussetzungen erfüllt sind, geht dies damit zulasten des Beamten. Ein Anspruch ist nur dann zuzuerkennen, wenn sowohl das Vorliegen des behaupteten Körperschadens als auch der Kausalzusammenhang mit dem Dienstunfallgeschehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen sind (ständige Rechtsprechung; vgl. BVerwG, U. v. 25.2.2010 – 2 C 81.08 – NVwZ 2010, 708; BVerwG, B. v. 4.4.2011 – 2 B 7.10 – juris).
Gemessen an diesen Vorgaben konnte der Kläger hier nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass der Dienstunfall vom 14. November 2011 eine PTBS hervorgerufen hat.
Im vorliegenden Fall kann bereits nicht von der gesicherten Diagnose einer PTBS ausgegangen werden. Darüber hinaus genügen die vorgelegten Atteste auch nicht den Mindestanforderungen, die nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts an die substantiierten Geltendmachung einer psychischen Erkrankung wie insbesondere einer posttraumatischen Belastungsstörung zu stellen sind. Auf die obigen Ausführungen (vgl. Punkt 2.3.) wird Bezug genommen.
Auch der Umstand, dass das ZBFS mit Bescheid vom 23. Juli 2015 eine PTBS als Gesundheitsstörung des Klägers anerkannt hat, führt zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung, da der Beklagte an die Feststellungen des Versorgungsamtes nicht gebunden ist (s.o.)
3.2. Des Weiteren scheidet auch ein Wiederaufgreifen des Verfahrens gemäß Art. 51 Abs. 5 i. V. m. Art. 49 Abs. 1 BayVwVfG aus.
Nach § 49 Abs. 1 VwVfG kann ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden müsste oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist.
Vorliegend müsste im Fall des Widerrufs des bestandskräftigen Bescheides vom 31. Januar 2012 erneut eine ablehnende Entscheidung erlassen werden, da der Kläger keinen Anspruch auf die Anerkennung einer PTBS als weitere Unfallfolge des Dienstunfalls vom 14. November 2011 hat (s.o.).
3.3. Abgesehen vom Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen hat die Behörde, wenn die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 bis 3 BayVwVfG nicht vorliegen, nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, ob die bestandskräftige frühere Entscheidung zurückgenommen bzw. widerrufen wird. Insoweit besteht ein Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung (BVerwG, U. v. 21.3.2000 – 9 C 41/99 – juris; BVerwG, U. v. 22.10.2009 – 1 C 15/08 – juris). Der Beklagte war vorliegend nicht verpflichtet – nachdem er das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 51 BayVwVfG – zutreffend – verneint hat, gleichwohl eine Ermessensentscheidung nach den allgemeinen Grundsätzen des Art. 48, 49 BayVwVfG dahingehend zu treffen, den bestandskräftigen Bescheid vom 31. Januar 2012 aufzuheben und über die Sache neu zu entscheiden. Im Allgemeinen ist es nicht ermessensfehlerhaft, wenn die Behörde eine erneute Sachentscheidung deswegen ablehnt, weil der geltend gemachte Anspruch bereits bestandskräftig abgelehnt worden ist; es bedarf insoweit keiner weiteren ins Einzelne gehenden Ermessenserwägung seitens der Behörde. Vielmehr genügt ein Hinweis auf die bestehende Entscheidung sowie darauf, dass für eine andere Beurteilung des Falles kein Anlass besteht (BayVGH, U. v. 25.9.2002, 21 B 00.1358 – juris Rn.28). Dies hat die Behörde vorliegend getan. Umstände, die eine erneute Entscheidung im Einzelfall gebieten, müssen von einer den in Art. 51 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BayVwVfG geregelten Fällen vergleichbaren Bedeutung und Gewicht sein. Derartige Umstände, nach denen die Aufrechterhaltung des Erstbescheides schlechthin unerträglich wäre, etwa die offensichtliche Fehlerhaftigkeit des Bescheides oder ein Verstoß gegen die guten Sitten oder Treu und Glauben sind nicht ersichtlich (BVerwG, B. v. 16.8.1989, 7 B 57.89, Buchholz 421.0 Nr.268).
Nachdem der Kläger keinen Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens hat, hat er auch keinen Anspruch auf Anerkennung einer PTBS als zusätzliche Folge des Dienstunfalls vom 18. November 2011.
II.
Die Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.
III.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i. V. m. § 708 ff ZPO.
Rechtsmittelbelehrung:
Nach §§ 124, 124 a Abs. 4 VwGO können die Beteiligten die Zulassung der Berufung gegen dieses Urteil innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
beantragen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen. Dem Antrag sollen vier Abschriften beigefügt werden.
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof,
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder
Postanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach
einzureichen, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist.
Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Rechtslehrern mit Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4 und 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen.
Beschluss:
Der Streitwert wird auf EUR 5.000 festgesetzt (§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz -GKG-).