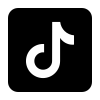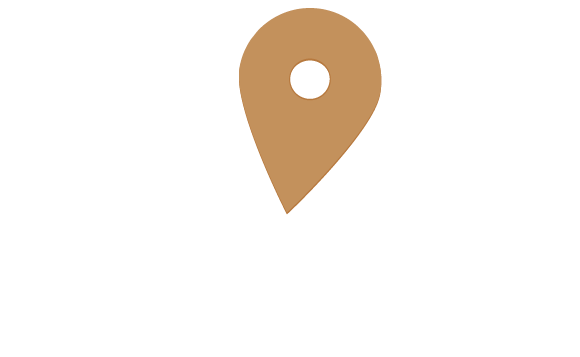Aktenzeichen 3 B 21.1614
Leitsatz
1. Der Dienstunfall ist dann als wesentliche Ursache im Rechtssinne anzuerkennen, wenn er bei natürlicher Betrachtungsweise entweder überragend zum Erfolg (Körperschaden) hingewirkt hat oder zumindest annähernd die gleiche Bedeutung für den Eintritt des Schadens hatte wie die anderen Umstände insgesamt. Nicht Ursachen im Rechtssinne sind dagegen sog. Gelegenheitsursachen, dh Ursachen, bei denen zwischen dem eingetretenen Schaden und dem Dienst eine rein zufällige Beziehung besteht, wenn also etwa die krankhafte Veranlagung oder das anlagebedingte Leiden so leicht ansprechbar war, dass es zur Auslösung akuter Erscheinungen keiner besonderen, in ihrer Eigenart unersetzlichen Einwirkungen bedurfte, sondern auch ein anderes, alltäglich vorkommendes Ereignis zum selben Erfolg geführt hätte. Die materielle Beweislast für den Nachweis des dienstunfallrechtlichen Kausalzusammenhangs trägt der (anspruchstellende) Beamte. Grundsätzlich bedarf es insoweit des vollen Beweises im Sinne einer „an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit“. (Rn. 25 – 26) (redaktioneller Leitsatz)
2. Eine Anpassungsstörung wird durch „eine besondere Veränderung im Leben“, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation geführt hat, hervorgerufen. Dabei spielt eine individuelle Disposition oder Vulnerabilität beim möglichen Auftreten und der Form von Anpassungsstörungen zwar eine größere Rolle, gleichwohl sind die andauernden, unangenehmen Umstände primäre und ausschlaggebende Kausalfaktoren. (Rn. 28) (redaktioneller Leitsatz)
3. Die ICD-10-Klassifikation (F 43.1) fordert bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Aufgeführt werden dabei durch Naturereignisse oder von Menschen verursachte Katastrophen, eine Kampfhandlung, ein schwerer Unfall oder Zeuge des gewaltsamen Todes anderer oder selbst Opfer von Folterung, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderen Verbrechen zu sein. (Rn. 35 – 36) (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
12 K 14.5597 2015-11-05 Urt VGMUENCHEN VG München
Tenor
I. Das Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 5. November 2015 wird aufgehoben.
II. Die Beklagte wird verpflichtet, bei dem Kläger eine bis zum Ablauf des Jahres 2017 als dienstunfallbedingt (Dienstunfall vom 25.9.2012) anzusehende „Anpassungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen (ICD-10: F43.23)“ anzuerkennen. Der Bescheid der Beklagten vom 31. März 2014 und der Widerspruchsbescheid vom 24. November 2014 werden aufgehoben, soweit sie dieser Verpflichtung entgegenstehen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III. Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen.
IV. Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen trägt der Kläger zu 2/3 und die Beklagte zu 1/3.
V. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
VI. Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
Die Berufung des Klägers ist zulässig und im tenorierten Umfang begründet. Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet.
1. In der Neufassung des Klageantrags mit Schriftsatz vom 19. Januar 2021 liegt keine Klageänderung im Sinne des § 91 Abs. 1 VwGO. Denn der Klagegrund hat sich dadurch nicht verändert; er ist im Laufe des gesamten Gerichtsverfahrens vielmehr unverändert geblieben. Ausweislich des in der Berufungsbegründung vom 29. Januar 2019 angekündigten Antrags, der den Klageantrag im Wesentlichen unverändert übernommen hat, war das (dem Sachbegehren im Verwaltungsverfahren entsprechende) Sachbegehren des Klägers darauf gerichtet, „als wesentliche Folge des Dienstunfalls vom 25. September 2012 die Körperschäden aus psychischen/psychiatrischen Fachgebiet (posttraumatische Belastungsstörung, mittelgradige depressive Episode) anzuerkennen“. Unter dem 19. Januar 2021 hat der Kläger sodann hilfsweise beantragt, „eine Anpassungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen (ICD-10: F 43.23)“ als Folge des Dienstunfalls anzuerkennen. Dieser Hilfsantrag hat nach wie vor die Anerkennung der beklagten psychischen Beschwerden als Dienstunfallfolgen zum Gegenstand. Die (weitere) Konkretisierung dieser psychischen/psychiatrischen Beschwerden ändert daran nichts. Sie ist allein dem Umstand geschuldet, dass der Kläger seine psychischen/psychiatrischen Beschwerden nach dem Vorliegen der Diagnose des gerichtlichen Sachverständigen nunmehr in einer weiteren Weise bezeichnen konnte.
2. Der Kläger hat Anspruch darauf, die Beklagte zu verpflichten, eine – allerdings nur bis zum Ablauf des Jahres 2017 als dienstunfallbedingt anzusehende – Anpassungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen (ICD-10: F43.23) als (weitere) Dienstunfallfolge festzustellen (Art. 46 Abs. 1 Satz 1 BayBeamtVG). Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens hat der Kläger Anspruch auf Unfallfürsorge (Art. 45 Abs. 2 BayBeamtVG).
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Dienstunfall dann als wesentliche Ursache im Rechtssinne anzuerkennen, wenn er bei natürlicher Betrachtungsweise entweder überragend zum Erfolg (Körperschaden) hingewirkt hat oder zumindest annähernd die gleiche Bedeutung für den Eintritt des Schadens hatte wie die anderen Umstände insgesamt. Nicht Ursachen im Rechtssinne sind dagegen sog. Gelegenheitsursachen, d.h. Ursachen, bei denen zwischen dem eingetretenen Schaden und dem Dienst eine rein zufällige Beziehung besteht, wenn also etwa die krankhafte Veranlagung oder das anlagebedingte Leiden so leicht ansprechbar war, dass es zur Auslösung akuter Erscheinungen keiner besonderen, in ihrer Eigenart unersetzlichen Einwirkungen bedurfte, sondern auch ein anderes, alltäglich vorkommendes Ereignis zum selben Erfolg geführt hätte (zuletzt BVerwG, U.v. 6.5.2021 – 2 C 10.20 – juris Rn. 15 m.w.N.)
Die materielle Beweislast für den Nachweis des dienstunfallrechtlichen Kausalzusammenhangs trägt der (anspruchstellende) Beamte. Grundsätzlich bedarf es insoweit des vollen Beweises im Sinne einer „an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit“ (BVerwG, U.v. 6.5.2021 a.a.O. Rn. 16).
Gemessen hieran liegt der dienstunfallrechtliche Kausalzusammenhang zwischen dem – als solchem bereits anerkannten – Dienstunfall vom 25. September 2012 und der Anpassungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen (ICD-10: F43.23) vor. Dieser Körperschaden beruht mit der erforderlichen an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit kausal auf dem Dienstunfall. Dies ergibt sich zur Überzeugung des Senats aus dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen vom 10. Juni 2020, der ergänzenden Stellungnahme vom 23. Dezember 2020 sowie dessen Erläuterungen hierzu im Rahmen der durchgeführten mündlichen Verhandlung am 28. Juli 2021, denen der Senat folgt. Das vorliegende Gutachten ist in sich stimmig und überzeugend. Es bietet keinen Anlass zu Zweifeln, welche die Einholung eines weiteren Gutachtens erforderlich machen könnten.
Eine Anpassungsstörung wird durch „eine besondere Veränderung im Leben“, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation geführt hat, hervorgerufen. Das ist hier der Wegeunfall vom 25. September 2012. Dabei spielt eine individuelle Disposition oder Vulnerabilität beim möglichen Auftreten und der Form von Anpassungsstörungen zwar eine größere Rolle, gleichwohl sind die andauernden, unangenehmen Umstände primäre und ausschlaggebende Kausalfaktoren. Die Störung wäre ohne ihre Einwirkung nicht entstanden (siehe hierzu ICD-10: F 43.-; Gutachten vom 10.6.2020, S. 72). Insoweit hat der Sachverständige zutreffend den Fokus auf den Dienstunfall als auslösendes Moment gelegt und ausgeführt, dass seine Überlegungen zur Primärpersönlichkeit des Klägers für die Beantwortung der dem Gutachten zugrundeliegenden Fragen keine Rolle spielen (a.a.O.).
Die hier in Rede stehende Anpassungsstörung ist von der Beklagten mit Bescheid vom 31. März 2014 als Folge des Dienstunfalls anerkannt worden. Da es sich bei der Anpassungsstörung in aller Regel um eine vorübergehende gesundheitliche Störung handelt, wurde eine Behandlung nur bis Dezember 2013 für erforderlich gehalten (vgl. Gesundheitszeugnis vom 5.7.213 unter 7. und Schr. vom 19.3.2014, jeweils in der Dienstunfallakte, Bl. 48 und 109) und die Übernahme der Behandlungskosten nach diesem Zeitpunkt ausdrücklich ausgeschlossen.
Der gerichtliche Sachverständige hat jedoch nachvollziehbar ausgeführt, dass sich das psychische Störungsbild bei dem Kläger auch nach diesem Zeitpunkt weiterentwickelt hat (Gutachten vom 10.6.2020, S. 74) und sich ein komplizierter Krankheitsverlauf (Gutachten vom 10.6.2020, S. 75) ergab. Dies insbesondere deshalb, weil der Kläger zum einen mit der Behandlung seiner Dienstunfallangelegenheit unzufrieden war (dies bereits ab 3/2013), zum anderen wegen privater Probleme (u.a. der Trennung von seiner Partnerin 2014). Diese hinzutretenden Faktoren seien jeweils „mittelbar unfallabhängig“ (Gutachten vom 10.6.2020 S. 75, 78) gewesen, hätten die bestehende Anpassungsstörung geprägt (Gutachten vom 10.6.2020, S. 76), aber nicht überlagert (Protokoll der m.V., S. 4). In der Folge sei die Anpassungsstörung nicht remittiert, sondern habe sich zu dem protrahierten Verlauf entwickelt. Die Unzufriedenheit des Klägers mit der Behandlung seines Dienstunfalls habe zu einer Verbitterung geführt und zur Chronifizierung der Anpassungsstörung beigetragen.
Spätestens ab Jahresbeginn 2018 jedoch sei davon auszugehen, dass die als mittelbar beschriebenen Dienstunfallfolgen keine bedeutsame Einschränkung der Funktionsfähigkeit des Klägers mehr bedingten. Bei der Frage nach der Kausalität dürfe man nicht verkennen, dass sich die Beschwerdesymptomatik in einem Kontinuum bewege. Ab 2018 sei die nach wie vor bestehende psychische Erkrankung des Klägers nicht mehr durch die mit dem Dienstunfall (mittel- oder unmittelbar) zusammenhängenden Probleme verursacht worden, sondern beruhe auf der Verarbeitung dienstlicher Konflikte, wobei der Persönlichkeitszug der leichten Kränkbarkeit des Klägers dies begünstigt habe (S. 5 des Protokolls über die mündliche Verhandlung).
Der Senat hält diese Einschätzung für plausibel und nachvollziehbar. Die Beschwerdesymptomatik des Klägers mit einem prolongierten Verlauf ließ es nicht zu, dass der gerichtliche Sachverständige präzise Daten zum Wegfall der Kausalität nennen konnte. In der Zeit zwischen 2014 und 2018 sind keine einschneidenden Ereignisse zu verzeichnen, die für die Anpassungsstörung des Klägers hätten führend werden oder die ursprüngliche Kausalität hätten überlagern können. Der Umstand, dass der Kläger bei dem Versuch einer Wiedereingliederung im Schuljahr 2016/2017 einen „Zusammenbruch“ (Gutachten vom 10.6.2020 S, 36) erlitt, spricht für den Fortbestand der Anpassungsstörung.
Zum Schuljahr 2017/2018 hat der Kläger eine weitere stufenweise Wiedereingliederung begonnen. Zum Schuljahresende (also Juli 2018) wurden die dienstlichen Probleme, die im Zusammenhang mit seiner Funktionsstelle „Mitarbeiter in der Schulleitung“ standen, für den Kläger fassbar, eskalierten in der Folgezeit und führten schließlich dazu, dass er seit dem 4. Oktober 2019 bis heute dienstunfähig erkrankt ist. Im Rahmen einer amtsärztlichen Untersuchung vom 11. Januar 2018 ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte mehr dafür, dass beim Kläger eine Anpassungsstörung besteht. Vielmehr ist lediglich von einem leichtgradigen depressiven Syndrom mit Antriebsmangel die Rede. Insoweit ist es ohne weiteres nachvollziehbar, wenn der gerichtliche Sachverständige davon ausgeht, dass spätestens ab Jahresbeginn 2018 die beschriebene (zunächst „unmittelbar“, dann „mittelbar“ als Folge des Dienstunfalls vom 25.9.2012 anzusehende) Anpassungsstörung keine bedeutsame Einschränkung der Funktionsfähigkeit des Klägers mehr bedingte. Eine bessere Annäherung an die Unterbrechung des Kausalverlaufs ist dem Senat auch unter Berücksichtigung der gutachterlichen Äußerungen und insbesondere der Aufklärungsversuche in der mündlichen Verhandlung nicht möglich. Da psychiatrische Diagnosen im Wesentlichen psychopathologische Zustands-Verlaufs-Beschreibungen sind, lassen sie sich in aller Regel – und so auch hier – nicht auf einen präzisen Zeitpunkt festmachen. Dieser Umstand kann weder zugunsten noch zulasten des Klägers Berücksichtigung finden.
3. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Anerkennung einer posttraumatischen Belastungsstörung und/oder einer mittelgradigen depressiven Episode als Dienstunfallfolgen.
3.1 Der gerichtliche Sachverständige, Prof. Dr. D …, hat im Einzelnen dargelegt, dass und warum die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung nach den anerkannten Diagnosesystemen nicht erfüllt sind. Es fehlt bereits an dem Eingangskriterium. Die ICD-10-Klassifikation (F 43.1) fordert ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Aufgeführt werden dabei durch Naturereignisse oder von Menschen verursachte Katastrophen, eine Kampfhandlung, ein schwerer Unfall oder Zeuge des gewaltsamen Todes anderer oder selbst Opfer von Folterung, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderen Verbrechen zu sein.
Bei der bereits verabschiedeten, aber noch nicht eingeführten ICD-11 ist davon die Rede, dass die sog. „komplexe posttraumatische Belastungsstörung“ eine starke psychologische Reaktion umfasse, hervorgerufen durch anhaltende, traumatische Erlebnisse, die in der Regel mehrere oder sich wiederholende traumatische Ereignisse einschließe. Das häufigste Beispiel einer solchen komplexen Traumatisierung, also dem Erleben von anhaltenden, sich wiederholenden traumatischen Ereignissen, sei sexueller oder physischer Missbrauch in der Kindheit. Andere Bespiele, die ebenfalls die Kriterien einer komplexen Traumatisierung erfüllten, seien Opfer von häuslicher Gewalt, Opfer von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung, Kindersoldaten, Flüchtlinge oder zivile Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen, die gefoltert wurden oder andere Formen politischer oder organisierte Gewalt selbst erlebt haben. Das Kriterium A1 in der DSM-IV- als auch der DSM-5-Klassifikation verlangt die Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt durch direktes Erleben.
Das hier maßgebliche Unfallgeschehen reicht nach der sehr gut nachvollziehbaren Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen nach keiner der genannten Klassifikationen an ein solches Ereignis heran. Auch wenn der Kläger im Verlauf mit der Auseinandersetzung um die Anerkennung des Dienstunfalls als Auslöser einer „posttraumatischen Belastungsstörung“ den Unfall vom 25. September 2012 immer drastischer dargestellt habe (wenn er z.B. bei der psychologischen Begutachtung vom 9.3.2016 davon gesprochen habe, die Unfallgegnerin sei „wie aus dem Nichts“ plötzlich auf ihn zugerast und er habe in diesem Moment „Todesangst“ gehabt), so sei dies den ursprünglichen Angaben des Klägers und den ersten Befundschilderungen nach dem Unfall in dieser Form nicht zu entnehmen. So habe er in seiner „Niederschrift zum Wegeunfall vom 25.9.2012“ angegeben, er sei durch Hupen auf den Wagen der Unfallverursacherin aufmerksam geworden, die (weil sie ein ausfahrwilliges Taxi an der Ausfahrt gehindert habe) ihren Wagen in der Folge stark beschleunigt habe und auf den Kläger zugefahren sei. Er habe Blickkontakt mit der Fahrerin gehabt und sich im letzten Moment durch einen Sprung zur Seite vor einem Frontalaufprall retten können, wobei er wohl mit dem linken Arm in der Höhe des Ellbogens mit dem Fahrzeug in Berührung gekommen sein müsse, was er aber in diesem Moment nicht bemerkt habe. Auch die Tatsache, dass der Kläger, wie in der genannten Niederschrift angegeben, sich das Kennzeichen des Fahrzeugs habe merken können, spreche dagegen, dass er sich zum Zeitpunkt des Unfalles in einem durch Todesangst geprägten Ausnahmezustand befunden haben solle. Auch der Bericht der Chirurgischen Klinik und Poliklinik der LMU M. lasse keine Hinweise auf eine besondere psychische Belastung des Klägers durch den Unfall erkennen. Eine erste Erwähnung hätten psychische Beeinträchtigungen durch den erlittenen Unfall in einem Anschreiben des Klägers an das Personal- und Organisationsreferat der Beklagten vom 7. März 2013 gefunden, wo vom Kläger „ganz nebenbei“ bemerkt werde, er leide seit dem Ereignis auch unter einer „schweren posttraumatischen Belastungsstörung“, während sich bis zu diesem Zeitpunkt die Auseinandersetzung auf die Anerkennung der vom Kläger geltend gemachten zusätzlichen Kniebeschwerden als Dienstunfallfolge konzentriert hätten. Auch wenn einzelne im Attest von Dr. C … vom 5. März 2013 genannten Symptome wie „Träume, Alpträume“ sowie „vegetative Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung“ oder das „Gefühl der emotionalen Stumpfheit“ durchaus den im ICD-10 genannten typischen Merkmalen einer posttraumatischen Belastungsstörung entsprechen mögen, so seien sie doch – wegen des fehlenden Eingangskriterium – nicht einer posttraumatischen Belastungsstörung zuzuordnen.
Diese sehr genauen und fundierten, durch Angabe von wissenschaftlichen Schriften belegten Ausführungen hält der Senat für überzeugend. Sie entsprechen der amtsärztlichen Einschätzung (Dr. K …). Auch der Sachverständige Prof. Dr. W … ist in seinem fachpsychiatrischen Gutachten zur Berufsunfähigkeit des Klägers davon ausgegangen, dass die Kriterien des Vollbilds einer posttraumatischen Belastungsstörung nicht erfüllt sind (vgl. S. 31 des Gutachtens). Nicht zu folgen ist demgegenüber der in mehreren ärztlichen Stellungnahmen vertretenen Einschätzung von Dr. D … Dieser nimmt zwar an, dass der Kläger an einer Traumafolgestörung bzw. Dienstunfallfolgestörung leidet, gesteht aber gleichzeitig ein, dass die Kriterien eines Traumas nach ICD-10 bzw. ICD-11 nicht erfüllt sind (vgl. Stellungnahme vom 13.1.2021). Die Anerkennung einer psychischen Störung als Unfallfolge erfordert jedoch eine exakte Diagnose der Krankheit nach einem der international anerkannten Diagnosesysteme (ICD-10/11 oder DSM IV/5) unter Verwendung der dortigen Schlüssel und Bezeichnungen, damit die Feststellung nachvollziehbar ist (grundlegend BSG, U.v. 9.5.2006 – B 2 U 1/05 R – juris Rn. 22 und U.v. 26.11.2019 – B 2 U 8/18 Rjuris Rn. 19).
3.2 Anhaltspunkte für eine mittelgradige depressive Episode (ICD-10: F 32.1) bestehen ebenso wenig. Der Senat folgt auch insoweit den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen. Der Kläger hat dessen Einschätzung insoweit auch nicht in Frage gestellt, sodass weitere Ausführungen hierzu entbehrlich sind.
4. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO.
Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen nicht vorliegen (§ 132 Abs. 2, § 191 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 127 BRRG).