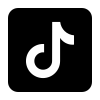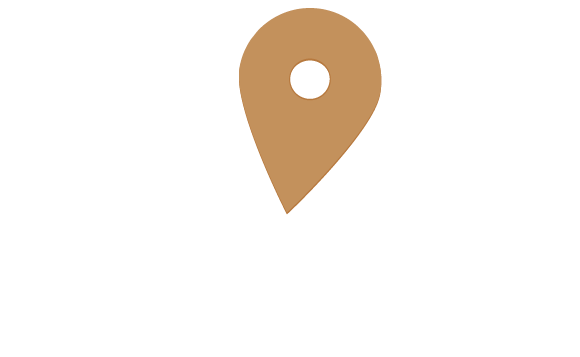Aktenzeichen M 17 K 18.3821
BayBG Art. 96 Abs. 5 S. 2 Nr. 2
Leitsatz
Tenor
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Gründe
Die zulässige Klage ist unbegründet und kann daher keinen Erfolg haben.
Der Bescheid des Beklagten vom 27. Februar 2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 12. Juli 2018 ist rechtmäßig (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Der Kläger hat gegen den Beklagten keinen Anspruch auf Zahlung einer weiteren Beihilfe in Höhe von 1.324,88 € (70% von 1.892,68 €) gem. § 7 Abs. 1 der Bayerischen Beihilfeverordnung (BayBhV) vom 2. Januar 2007 (GVBl. S. 15), in der für die streitgegenständliche Behandlung (datierend auf den Januar 2018) maßgeblichen Fassung vom 24. Juli 2017 (GVBl. S. 418), § 113 Abs. 5 VwGO.
1. Nach Art. 96 Abs. 5 Satz 1 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 1 BayBhV sind Aufwendungen beihilfefähig, wenn sie dem Grunde nach medizinisch notwendig (Nr. 1), der Höhe nach angemessen sind (Nr. 2) und die Beihilfefähigkeit nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist (Nr. 3). Nicht medizinisch notwendig i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBhV sind regelmäßig wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethoden (BayVGH, U.v. 13.12.2010 – 14 BV 08.1982 – BeckRS 2010, 36908, beck-online, Rn. 54, mit Verweis auf BVerwG, U.v. 29.6.1995 – 2 C 15/94 – NJW 1996, 801). Nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 BayBhV sind Aufwendungen für Untersuchungen oder Behandlungen nach wissenschaftlich nicht allgemein anerkannten Methoden einschließlich der hierbei verordneten Arznei- und Verbandmittel und Medizinprodukte, die in Anlage 2 Nr. 1 zur BayBhV aufgeführt sind, nicht beihilfefähig. Zu den nach Anlage 2 Nr. 1 zu § 7 Abs. 5 Nr. 1 BayBhV von der Beihilfefähigkeit vollständig ausgeschlossenen Behandlungsmethoden gehört auch die Epidurale Wirbelsäulenkathetertechnik (z.B. nach Racz).
1.1 Der Kläger begehrt hier die Gewährung einer Beihilfe für eine im Januar 2018 durchgeführte „minimal invasive epidurale Neurolyse und Neuroplastik der Lendenwirbelsäule L4/L5 links“ (vgl. Operationsbericht vom … … …, Bl. 7 der Behördenakte – BA).
Dass es sich bei der durchgeführten minimalinvasiven epiduralen Neurolyse und Neuroplastik der Lendenwirbelsäule um die nach der Anlage 2 Nr. 1 zu § 7 Abs. 5 Nr. 1 BayBhV von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossene epidurale Wirbelsäulenkathetertechnik handelt, steht zur Überzeugung des Gerichts unzweifelhaft fest, eine Beweisaufnahme zu dieser Frage war daher entbehrlich.
Zum einen ergibt dies sich bereits aus der Rechnung über die streitgegenständliche Behandlung vom … … …, hier ist unter der Abrechnungsziffer „…“ ausdrücklich die Rede von der „Kathetereinbringung“. Darüber hinaus werden die Begriffe „Epidurale Neurolyse“ und die „epidurale Wirbelsäulenkathetertechnik“ offenkundig synonym verwendet (vgl. z.B. http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Orthopaedische-Kli
nik-und-Poliklinik/de/labor/Experimentelle_Orthopaedie/Alternative_Verfahren/Epidur
ale_Neurolyse.html, zuletzt abgerufen am 15.10.2020), dies gilt auch für die von der Klagepartei zitierte Entscheidung des OLG … (U.v. 19.11.2009 – 7 U 60/09 – NJOZ 2010, 882). Schließlich wirbt der behandelnde Arzt … … auf seiner Homepage auch selbst für seine „epidurale Wirbelsäulenkathetertechnik nach … …“, die ausweislich ihrer Beschreibung als eine Weiterentwicklung der (nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Anlage 2 BayBhV von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossenen) Wirbelsäulenkathetertechnik nach Prof. Racz anzusehen ist (https://orthopaed
e. com/therapien/minimalinvasive-wirbelsaeuleneingriffe/kathetertechnik/, zuletzt abgerufen am 15.10.2020).
1.2 Dass es sich bei der Epiduralen Wirbelsäulenkathetertechnik (z.B. nach Racz) – und somit auch bei der hier streitgegenständlichen Behandlung (s.o. unter 1.1) – um eine wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Methode handelt, ergibt sich bereits direkt aus dem Gesetz (vgl. § 7 Abs. 5 Nr. 1 BayBhV, welcher nach dem Wortlaut indiziert, dass die in Anlage 2 genannten Methoden nicht allgemein wissenschaftlich anerkannt sind). Aus diesem Grund ist – auch nach der Rechtsprechung des BayVGH (B.v. 11.9.2008 – 14 ZB 07.1620 – BeckRS 2008, 28364, beck-online, Rn. 7) – die Notwendigkeit der in einem Ausschlusskatalog aufgeführten Methoden regelmäßig nicht zu prüfen, eine Beweiserhebung konnte daher auch zu dieser Frage schon deshalb unterbleiben.
Anhaltspunkte, dass die gesetzgeberische Einordnung der Methode als nicht allgemein wissenschaftlich anerkannt falsch wäre, sind nicht ersichtlich.
Wissenschaftlich anerkannt i. S. der Beihilferegelungen ist eine Behandlungsmethode dann, wenn sie von der herrschenden oder doch überwiegenden Meinung in der medizinischen Wissenschaft für die Behandlung der jeweiligen Krankheit – sei es als alleiniges Heilmittel oder als zusätzliche Therapie – als wirksam und geeignet erachtet wird (BVerwG, B.v. 15.03.1984 – 2 C 2/83 – NJW 1985, 1413). Die Gängigkeit bzw. Etabliertheit einer Behandlungsmethode in der Praxis für sich genommen ist nach dieser Definition für die wissenschaftliche Anerkennung einer Methode gerade nicht ausreichend. Folglich war auch der angeregten Beweiserhebung des Klägerbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung nicht Folge zu leisten.
Eine aus dem Jahr 2003 stammenden Stellungnahme der Bundesärztekammer und der kassenärztlichen Bundesvereinigung (Minimalinvasive Wirbelsäulen-Kathetertechnik nach Racz – Ein Assessment der Bundesärztekammer und der kassenärztlichen Bundesvereinigung, vom 28. März 2003, abrufbar unter https://www.bundesaerztekam
mer.de/fileadmin/user_upload/downloads/80b.pdf, zuletzt abgerufen am 15.10.2020, S. 48) kommt zu dem Ergebnis, dass mit den vorliegenden Studien ein valider Wirksamkeitsnachweis der minimalinvasiven Kathetertechnik nach Racz gerade nicht erbracht werden konnte. Eine belastbare Aussage im Vergleich zu anderen Therapien bei Rückenschmerzen jeglicher Genese sei aufgrund der unzureichenden Studienlage nicht möglich. Insgesamt müsse die minimalinvasive Kathetertechnik nach Racz daher als experimentelle Therapie angesehen werden. Valide Vergleichsstudien, die die Wirksamkeit der Behandlungsmethoden nachweisen, sind nach wie vor nicht ersichtlich. Auch das LMU Klinikum München (http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Ortho
paedische-Klinik-und-Poliklinik/de/labor/Experimentelle_Orthopaedie/Alternative_Ver
fahren/Epidurale_Neurolyse.html, zuletzt abgerufen am 15.10.2020) informiert auf seiner Homepage über die Epidurale Neurolyse wie folgt: „Die Racz-Epiduralkathetertherapie (auch “Epidurale Neurolyse”) war zeitweise äußerst populär und wurde zum Teil als „Allheilmittel“ für Wirbelsäulenschmerzen erklärt. Trotz nachgewiesener Wirksamkeit der Methode bei bestimmten Schmerzproblemen traten jedoch auch schwerwiegende, neurologische Komplikationen auf, welche nur zum Teil durch Anwendungsfehler erklärbar waren. Es stellte sich daher die Frage, ob die bei der Therapie epidural zur Anwendung kommenden Pharmaka möglicherweise eine zellschädigende Wirkung besitzen. Im Zellkulturmodell konnten wir zelltoxische Effekte für die neben anderen Pharmaka in der Epiduralen Neurolyse eingesetzte hypertone Kochsalzlösung und Bupivacain nachweisen. Aus unserer Sicht sollte die Epidurale Neurolyse daher nicht kritiklos angewendet werden. Die bei der Methode verwendeten Medikamente bedürfen zum Teil weiterer Untersuchungen bezüglich ihrer epiduralen und neuralen Verträglichkeit.“. All dies spricht entschieden gegen eine allgemein wissenschaftliche Anerkennung der Methode, die im Übrigen trotz langjährigen Bestehens in ihrer Anwendung nicht annähernd standardisiert ist (vgl. Mildenberger, Beihilferecht in Bund, Ländern und Kommunen, Bd. 1, A III, § 6 BBhV, Rn. 8, (4), 5.3). Darüber hinaus wurde die fehlende wissenschaftliche Anerkennung der Epiduralen Wirbelsäulenkathetertechnik auch in einer Reihe von Gerichtsentscheidungen bestätigt (z.B. OVG NRW, U. v. 24.11.2006 – 1 A 461/05 mit Verweis auf Hessisches Landessozialgericht, U.v. 19. 5. 2005 – L 8/14 KR 166/02 – juris; Landessozialgericht Baden-Württemberg, U.v. 20. 4. 2004 – L 11 KR 4487/03 – juris und OLG München, U.v. 19. 1. 2006 – 1 U 4453/05 – juris). Selbst die vom Kläger in Bezug genommene Entscheidung des OLG … (U.v. 19. 11.2009 – 7 U 60/09 – NJOZ 2010, 882) lässt die Frage der wissenschaftlichen Anerkennung der Methode offen und bejaht eine Erstattungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung nur deshalb, weil im konkreten Fall keine schulmedizinische Behandlungsmethode zur Verfügung stand und eine Vertragsklausel in einem solchen Fall eine Erstattungspflicht vorsah. Schließlich spricht auch der Umstand, dass für die Epidurale Wirbelsäulenkathetertechnik trotz ihrer jahrelangen Praktizierung keine Abrechnungsziffern nach der GOÄ geschaffen wurden, sondern die Abrechnung – wie auch in der streitgegenständlichen Rechnung – über Analogziffern erfolgt, gegen die allgemeine wissenschaftliche Anerkennung der Methode.
Nach alledem hat die Beihilfestelle die hier durchgeführte, streitgegenständliche Rückenoperation des Klägers zu Recht als nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 1 BayBhV von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossene Behandlungsmethode eingestuft.
2. Auch wenn der Kläger auf den Heilungserfolg verweist, den die epidurale Neurolyse aus seiner Sicht herbeigeführt haben soll, kann damit der Anspruch auf Beihilfe nicht begründet werden. Der Vorschriftengeber hat sich dafür entschieden, für die in Anlage 2 zu § 7 Abs. 5 BayBhV aufgenommenen Behandlungsmethoden, die wissenschaftlich nicht allgemein anerkannt sind, die Beihilfefähigkeit auszuschließen ohne eine Ausnahme für den Fall zu normieren, dass derartige Behandlungsmethoden nachweislich einen Heilungserfolg herbeigeführt haben. Dies ist rechtlich nicht bedenklich, sondern entspricht der Systematik des Beihilferechts. Die Beihilfevorschriften legen generalisierend und pauschalierend die Beihilfefähigkeit für bestimmte Aufwendungen fest, ohne die Beihilfe im Einzelfall daran zu knüpfen, ob eine beihilfefähige Methode tatsächlich zu einem Heilungserfolg geführt hat. Dies ist auch sachgerecht, denn ob ein Heilungserfolg eingetreten ist, lässt sich häufig erst einige Zeit nach der Behandlung und nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand und gegebenenfalls nur nach medizinischer Beratung feststellen. Dass ein solches Verfahren nicht nur in der Praxis der Beihilfegewährung unpraktikabel ist und erhebliche Erschwernisse für längerfristige, insbesondere unheilbar Erkrankte mit sich bringt, liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Erörterung. Aus dem gleichen Grund ist es daher sach- und systemgerecht, bei Behandlungsmethoden, die als wissenschaftlich nicht allgemein anerkannt eingestuft sind, nicht auf den (gleichwohl) behaupteten Heilungserfolg abzustellen. Dies vor allem auch im Hinblick darauf, dass es im Einzelfall äußerst schwierig sein dürfte zu differenzieren, ob der Heilungserfolg tatsächlich auf die Behandlungsmethode, auf andere Wirkprinzipien, z.B. auf suggestiver Ebene (Placeboeffekt) oder auf sonstige günstige Einflüsse (etwa Wegfall von Stress, Einfluss der Pubertät, seelische Veränderungen u.a.) zurückzuführen ist.
3. Die begehrte Beihilfe kann auch nicht unter unmittelbarem Rückgriff auf die zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG) zählende Fürsorgepflicht des Dienstherrn gewährt werden, deren Erfüllung der Beamte beanspruchen kann.
Der Ausschluss der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für – wie hier – wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden ist grundsätzlich – von Sonderfällen abgesehen – nicht fürsorgepflichtwidrig. Hinsichtlich der Beihilferegelungen im Einzelnen steht dem Normgeber bzw. dem Dienstherrn ein Gestaltungsspielraum zu, innerhalb dessen er die Voraussetzungen, den Umfang sowie die Art und Weise dieser speziellen Fürsorge bestimmen kann. Von Verfassungs wegen fordert die Fürsorgepflicht nicht den Ausgleich jeglicher aus Anlass von Krankheitsfällen entstandener Aufwendungen und auch nicht deren Erstattung in jeweils vollem Umfange. Insbesondere ist die Fürsorgepflicht nicht dadurch verletzt, dass der Normgeber nur die notwendigen Aufwendungen in angemessenem Umfang als beihilfefähig anerkennt. Zwar wird bei der Prüfung der Notwendigkeit regelmäßig der Beurteilung des Arztes zu folgen sein. Eine Ausnahme gilt jedoch für wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethoden. Die Gewährung von Beihilfen, die aus allgemeinen Steuergeldern finanziert werden, gründet nämlich auf der Erwartung, dass die Heilbehandlung zweckmäßig, effektiv und sicher ist und daher hinreichende Gewähr für einen raschen Behandlungserfolg bietet. Aus der Sicht des Dienstherrn ist es deshalb nicht ohne Belang, ob die von ihm (mit) finanzierte Behandlung Erfolg verspricht oder nicht. Dass das öffentliche Interesse an einer effektiven und sparsamen Verwendung von Steuergeldern eine Begrenzung der Beihilfe auf erfolgversprechende Heilbehandlungen zulässt, ist in der Rechtsprechung seit langem anerkannt. Diesen von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz gestalten die Normen, die Aufwendungen für eine nicht wissenschaftlich anerkannte Heilbehandlung von der Beihilfefähigkeit ausschließen (hier: § 7 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Anlage 2 BayBhV) normativ aus und präzisieren den Begriff notwendiger Aufwendungen (hier nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBhV), vgl. BVerwG, Urteil vom 29. Juni 1995 (2 C 15.94 -, juris, Rn. 18 f.)
Allerdings kann das von der Fürsorgepflicht getragene Gebot, zu notwendigen Aufwendungen eine Beihilfe zu leisten, den Dienstherrn in Ausnahmefällen auch dazu verpflichten, die Kosten einer wissenschaftlich nicht allgemein anerkannten Behandlungsmethode nach den jeweiligen Bemessungssätzen zu erstatten. Diese Verpflichtung besteht – insbesondere bei einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlich verlaufenden Erkrankung – u. a. dann, wenn – erstens – zur Behandlung gerade keine allgemein anerkannten, dem medizinischen Standard entsprechenden Therapien zur Verfügung stehen oder bei dem Beamten bereits ohne Erfolg angewendet worden sind und wenn – zweitens – mit der wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethode eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder zumindest auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf verbunden ist (OVG Münster U.v. 19.10.2017 – 1 A 1712/14 – BeckRS 2017, 133473 Rn. 109-111, mit Verweis auf BVerwG, B.v. 22.8.2007- 2 B 37.07 – juris Rn. 6, und U.v. 29.6.1995 – 2 C 15.94 – juris, Rn. 20).
Diese Voraussetzungen sind hier offensichtlich nicht erfüllt. Weder handelt es sich bei der Erkrankung des Klägers um eine lebensbedrohliche Erkrankung, noch wurde von der Klagepartei hinreichend substantiiert vorgetragen, dass es im Zeitpunkt der Vornahme des streitgegenständlichen Eingriffs keinerlei andere schulmedizinische Behandlungsmöglichkeit für die Behandlung des Rückenleidens des Klägers gegeben habe bzw. der Kläger sämtliche zur Verfügung stehenden schulmedizinischen Behandlungsmethoden erfolglos ausgeschöpft habe und somit schulmedizinisch austherapiert gewesen sei. Derartiges ergibt sich weder aus den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Rechnungen bzw. Verordnungen über die Krankengymnastikbehandlungen, der aus dem Jahr 2005 stammenden Bestätigung der ärztlichen Behandlung des Klägers in der Chirurgischen Praxis … …, aus dem Bescheid des Versorgungsamtes … … … … … über den Grad der Behinderung des Klägers, noch aus den im Verwaltungsverfahren vorgelegten ärztlichen Berichten und Stellungnahmen. Dem Befundbericht des behandelnden Arztes … … vom … … … … … … **) lässt sich insoweit lediglich entnehmen, dass der behandelnde Arzt mit dem Kläger die unterschiedlichen therapeutischen Möglichkeiten umfangreich erörtert habe, die konservativen Behandlungsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Vorstellung des Klägers aufgrund der Beschwerdesymptomatik aber auch aus Gründen der Anamnese „relativiert“ hätten werden müssen. Dass und welche bisherigen konservativen Behandlungsmaßnahmen vor dem Eingriff erfolglos ausgeschöpft worden seien, ergibt sich aus der Stellungnahme nicht. Dem Befundbericht des Arztes … …l vom … … … (Bl. … … **) ist zu entnehmen, dass sich der Kläger für eine Epikatheter-Behandlung bei … … „entschieden“ habe. Dies spricht ebenfalls dagegen, dass die streitgegenständliche Behandlung die einzig mögliche Behandlungsoption für den Kläger gewesen ist.
Die Fürsorgepflicht verlangt im Übrigen nicht, dass Aufwendungen in Krankheits- bzw. Pflegefällen durch ergänzende Beihilfen vollständig gedeckt werden (vgl. BVerwG, U.v. 30.4.2009 – 2 C 127/07 – juris Rn. 8,12; U.v. 10.6.1999 – 2 C 29/98 – juris Rn. 22f.). Der Beamte muss wegen des ergänzenden Charakters der Beihilfe auch Härten und Nachteile hinnehmen, die sich aus der am Alimentationsgrundsatz orientierten pauschalierenden und typisierenden Konkretisierung der Fürsorgepflicht ergeben und keine unzumutbare Belastung bedeuten (vg. BayVGH, B.v. 8.1.2007 – 14 ZB 06.2911 – juris Rn. 13 m.w.N.). Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. z.B. U.v. 24.1.2012 – 2 C 24/10 – juris) erstreckt sich die in Art. 33 Abs. 5 GG verankerte Pflicht des Dienstherrn zur Sicherstellung des amtsangemessenen Lebensunterhalts auf Lebenslagen, die einen erhöhten Bedarf begründen. Die verfassungsrechtliche Alimentations- bzw. Fürsorgepflicht gebietet dem Dienstherrn, Vorkehrungen zu treffen, dass die notwendigen und angemessenen Maßnahmen im Falle von Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Geburt und Tod nicht aus wirtschaftlichen Gründen unterbleiben, weil sie der Beamte mit der Regelalimentation so nicht bewältigen kann, und dass der amtsangemessene Lebensunterhalt wegen der finanziellen Belastungen in diesen Ausnahmesituationen nicht gefährdet wird. Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger durch den Umstand, dass er die Aufwendungen für die streitgegenständliche Behandlung selbst tragen muss, derart unzumutbar belastet wäre, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
4. Schließlich vermag der Kläger auch nicht mit dem Argument durchzudringen, ihm sei aus Gründen der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG bzw. Art. 118 Abs. 1 BV) eine Beihilfe für die streitgegenständliche Behandlung zu gewähren, da er sonst schlechter behandelt werde als jeder Kassenpatient.
Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet lediglich, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Im vorliegenden Fall bestehen zwischen dem für Beamte grundsätzlich geltenden Eigenvorsorgesystem und dem Leistungssystem der gesetzlichen Krankenversicherung derartig grundlegende Unterschiede, dass ein Vergleich beider Systeme und damit auch eine etwaige Verpflichtung des Gesetzgebers zur gleichartigen Regelung von Voraussetzungen, Art und Umfang ergänzender Fürsorgeleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Das System der gesetzlichen Krankenversicherung und das System privater Vorsorge einschließlich ergänzender Beihilfe sind insoweit nicht „gleich“, sondern allenfalls „gleichwertig“. Bei den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung handelt es sich um Leistungen aus öffentlichen Kassen, die der grundsätzlich umfassenden Sicherung des Betroffenen und seiner Familie in Krankheitsfällen dienen. Die gesetzliche Krankenversicherung steht im Gegensatz zu der privaten Eigenvorsorge des Beamten und der ergänzenden nachrangigen Unterstützung durch den Dienstherrn. Die Krankheitsvorsorge aufgrund von Beihilfe und Privatversicherung unterscheidet sich von der gesetzlichen Krankenversicherung im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Verankerung, die Finanzierung, die Leistungsvoraussetzungen, das Leistungsspektrum und die Leistungsformen. Prägende Grundsätze der gesetzlichen Krankenversicherung sind vor allem die solidarische Finanzierung, der soziale Ausgleich, die Sach- und Dienstleistung als Leistungsform sowie die Organisation ihrer Träger als Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts. Den unterschiedlichen Systemen der gesetzlichen Krankenversicherung und der beamtenrechtlichen Beihilfegewährung würde es widersprechen, wenn Aufwendungen, die nach dem Willen des Gesetzgebers in dem einen Leistungssystem aus Gründen der Kostendämpfung und Eigenbeteiligung in rechtlich zulässiger Weise von einem dem Grunde nach Berechtigten getragen werden sollen, schließlich doch aus allgemeinen Gleichheitserwägungen auf ein anderes Leistungssystem hier übergewälzt würden.
Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist daher nicht erkennbar.
5. Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.