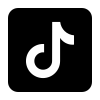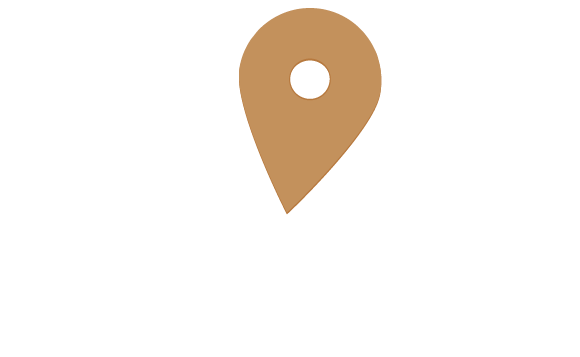Aktenzeichen 2 L 84/20
Leitsatz
1. Die gemeindliche Planungshoheit stellt zwar einen im Rahmen des § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA (juris: DSchG ST) zu berücksichtigenden Belang dar. Ein Vorrang der gemeindlichen Planungshoheit vor den Belangen des Denkmalschutzes kommt aber nur dann in Betracht, wenn eine hinreichend konkrete, verbindliche Planung – etwa in Gestalt eines Bebauungsplans – vorliegt, in deren Rahmen unter Beteiligung der Denkmalschutzbehörde und ggf. der Denkmalfachbehörde die Belange des Denkmalschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) mit den widerstreitenden Interessen, u.a. mit beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzepten (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB), abgewogen wurden.(Rn.35)
2. In Sachsen-Anhalt besteht für kommunale Gebietskörperschaften keine gegenüber privaten Eigentümern gesteigerte Pflicht zur Erhaltung von in ihrem Eigentum stehenden Kulturdenkmalen. Das Gleiche gilt für juristische Personen des Privatrechts, deren Alleingesellschafterin eine kommunale Gebietskörperschaft ist.(Rn.42)
Verfahrensgang
vorgehend VG Magdeburg 4. Kammer, 7. Juli 2020, 4 A 330/18 MD, Urteil
Tenor
Die Berufung des Beklagten wird zurückgewiesen.
Der Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. Die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig.
Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 vom Hundert der vollstreckungsfähigen Kosten vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die Klägerin begehrt eine denkmalrechtliche Genehmigung zum Abbruch von sechs Wohnhäusern.
Die Klägerin, deren alleinige Gesellschafterin die Welterbestadt A-Stadt ist, ist Eigentümerin der Grundstücke M-Straße 1 bis 12 in A-Stadt. Die Grundstücke sind mit sechs Wohnhäusern bebaut, die als Denkmalbereich in das Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt eingetragen sind. Im „Integrierten Stadtentwicklungskonzept A-Stadt“ (ISEK, Stand: September 2012), das von der Stadt A-Stadt als Teil des Managementplans für das UNESCO-Weltkulturerbe erarbeitet und am 18. April 2013 beschlossen wurde und die Entwicklungsziele bis zum Jahr 2025 beschreibt, heißt es (S. 83, 71), die Stadt strebe in der Wohnungsbestandsentwicklung ein ausgewogenes Verhältnis von Erhalt und Modernisierung zukunftsfähiger Lagen, Abriss und Umnutzung struktureller Überhänge und nachfragegerechten Wohnungsneubau an. Insgesamt stünden in A-Stadt etwa 1.870 Wohnungen leer (14 % des Bestands). Der Wohnungsleerstand konzentriere sich auf unsanierte Bestände (insbesondere im Altbau) und Bestände mit Lagenachteilen. In einigen Fällen sei der hohe Leerstand (auch) durch Abrissplanungen bestimmt. Dies gelte auch für den M-Straße (44 % Leerstand), der sich außerhalb des Stadtrings um die Altstadt in einer Splitterlage befinde. An diesem Standort sei trotz des Denkmalstatus ein Rückbau vertretbar. Die angrenzenden gewerblichen Nutzungen könnten sich erweitern.
Mit Schreiben vom 13. Oktober 2014 beantragte die Klägerin beim Beklagten die denkmalrechtliche Genehmigung für den Abbruch der sechs Mehrfamilienhäuser. Zur Begründung berief sie sich ausweislich der beigefügten Anlage A zum Antrag auf eine unzumutbare Belastung nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA. In der unter Punkt 4 der Anlage A zu findenden Kostenaufstellung, die einen Betrachtungszeitraum von 12 Jahren zugrunde legte, bezifferte die Klägerin das Gesamtinvestitionsvolumen im Fall einer Sanierung mit 6.225.000 €, die zur Finanzierung der Maßnahme vorgesehenen Eigenmittel einschließlich Eigenleistungen mit 1.245.000 €, die Fremdmittel mit 4.980.000 €, die jährlichen Erträge aus Miet- und Pachteinahmen mit 139.320,72 € und die laufende jährliche Belastung mit 209.388,78 €. Öffentliche Zuschüsse, Abschreibungen und Steuererleichterungen sowie die Kosten aufgrund unterlassener Bauunterhaltung wurden jeweils mit „0,00 €“ angegeben. Den veranschlagten Sanierungskosten lag eine Sanierungs- und Modernisierungskonzeption eines Planungsbüros zugrunde (Beiakte A, Bl. 16), das einen Neuzuschnitt der vorhandenen Wohnungen mit Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit Grundflächen zwischen 26,5 m2 und 82 m2 vorsah.
Die Stadt A-Stadt erklärte mit Schreiben vom 7. November 2014, dass sie den Abbruchantrag befürworte. Sie verwies hierbei u.a. auf das ISEK, eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung, Standortnachteile sowie darauf, dass der Erhalt städtebaulich wichtiger und architektonisch einmaliger Gebäude im Welterbegebiet eine wesentlich höhere Priorität habe als der Erhalt der Schlichtbauten im M-Straße. Der Einsatz von Fördermitteln für einen möglichen Erhalt der Gebäude sei nicht beabsichtigt.
Mit Bescheid vom 30. März 2015 lehnte der Beklagte die Erteilung der beantragten Genehmigung ab und gab zur Begründung an: Bei der Siedlung handele es sich um einen Denkmalbereich nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA. Aufgrund der geschichtlichen, kulturell-künstlerischen und städtebaulichen Bedeutung der Siedlung bestehe ein öffentliches Interesse an deren unveränderten Erhaltung. Der geplante Abbruch stelle einen Eingriff im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 1 DenkmSchG LSA dar, und die Voraussetzungen für eine Genehmigung dieses Eingriffs nach § 10 Abs. 1 Satz 2 DenkmSchG LSA lägen nicht vor. Ein überwiegendes öffentliches Interesse nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA aufgrund von Belangen des Städtebaus habe die Klägerin nicht glaubhaft gemacht. Der städtebauliche Planungsansatz im ISEK stelle zwar ein öffentliches Interesse anderer Art dar. Es überwögen jedoch Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege das Interesse an der bedarfsgerechten und flächenhaften Reduzierung des Wohnungsbestandes durch Abbruch der Siedlung. Auch eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung des Kulturdenkmals nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA habe die Klägerin nicht glaubhaft gemacht. Das Sanierungskonzept beruhe nicht auf einer aktuellen Bauzustandserfassung und sei mit dem Beigeladenen nicht abgestimmt. Mögliche Fördermittel seien zu berücksichtigen. Anträge könnten nicht mit der Begründung unterbleiben, dass die Erhaltung nicht beabsichtigt sei. Die Begründung für die fehlende Bezifferung von „Kosten aus unterlassener Bauunterhaltung“ sei nicht plausibel. Das Kulturdenkmal sei auch nicht unverkäuflich. Aktuell sei mindestens ein Kaufinteressent bekannt. Außerdem habe die Klägerin „andere Einkünfte“ aus der wirtschaftlichen Einheit des Unternehmens heranzuziehen.
Ihre hiergegen am 30. April 2015 erhobene Klage hat die Klägerin wie folgt begründet: Bei den Gebäuden handele es sich nicht um einen Denkmalbereich. Selbst wenn es sich „gerade noch“ um ein Kulturdenkmal handeln würde, sei es ein „Nur-noch-Denkmal“, denn das Objekt sei objektiv nicht nutzbar. Dies belegten auch das Gutachten des Bausachverständigen Bothe vom 18. Juni 2017, das den Gesamtsanierungsaufwand (zunächst) auf 6.319.000,00 € beziffert habe, und das Ergänzungsgutachten vom 19. August 2018, welches der Frage nachgegangen sei, ob und in welchem Umfang sie die entstandenen Sanierungskosten verursacht habe. Der Gutachter sei im Ergänzungsgutachten auf der Grundlage von im Jahr 1999 erstellten Bildaufnahmen zu der Einschätzung gelangt, dass sich die Folgekosten aus einer von ihr unterlassenen Bauunterhaltung seit dem Jahr 1999 je nach Objekt zwischen 43.821 € und 74.158 € bewegten. Damit sei aber nicht nachgewiesen, dass der schlechte Erhaltungszustand der Gebäude insgesamt durch sie verursacht worden sei. Es sei ihr deshalb nicht verwehrt, die kompletten Sanierungskosten geltend zu machen. Insgesamt habe sie bis Ende 2014 über einen Zeitraum von 15 Jahren ca. 308.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen ausgegeben. Am 1. März 2017 seien nur noch 4 Wohnungen vermietet, es bestehe eine Leerstandquote von über 90 %, Die Finanzierungskosten einer Sanierung und die Bewirtschaftungskosten seien um ein Vielfaches höher als die voraussichtlichen Mieteinnahmen oder der Gebrauchswert. Eine alternative Nutzung scheide wegen des Zuschnitts der Einheiten aus. Es gebe auch keinen Kaufinteressenten. Innerhalb von zwei Jahren habe es zwei Interessenbekundungen gegeben, die nach kürzester Zeit gescheitert seien. Es gebe keine Chance, den Grundbesitz zu veräußern oder in wirtschaftlich angemessener Weise zu nutzen oder zu verwerten. Was die Möglichkeit von Abschreibungen und Steuererleichterungen anbelange, so folge aus einem Schreiben der Steuerberatungsgesellschaft D. vom 9. Dezember 2019, dass sich die steuerliche Förderung von Aufwendungen für die Objekte im Ergebnis nicht steuermindernd auswirke. Auf ihren Antrag vom 5. Januar 2018 auf Gewährung von „Zuwendungen im Rahmen des Stadtumbaus Ost“ habe die Stadt A-Stadt mit Schreiben vom 31. Januar 2018 unter Hinweis auf das ISEK mitgeteilt, dass sie keine Zuwendungen für Rettungsmaßnahmen aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ beantragen werde. Der Beklagte habe mit Bescheid des vom 2. Juli 2020 Fördermittel lediglich in Höhe von insgesamt 216.703 € für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 bewilligt. Diese Zuwendungen genügten allerdings nicht, um den bestehenden Finanzbedarf zu decken. Nach einer aktuellen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, der ein Zeitraum von 12 Jahren zugrunde liege, beliefen sich die Investitionskosten auf nunmehr insgesamt 7.231.000 €. Auch nach einer Sanierung betrügen die Verluste, die sie innerhalb der nächsten 12 Jahre erwirtschaften würde, im ersten Jahr der Betrachtung ca. 63.000 € und in den weiteren Jahren zwischen 40.000 € und 70.000 €. Die D-Bank habe ihr auf entsprechende Nachfrage mit Schreiben vom 29. November 2019 mitgeteilt, dass Fremdmittel im angefragten Umfang von 5.561.000 € nicht zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Bank sehe sich angesichts der vergleichsweise sehr hohen Baukosten gegenüber den damit nicht im Einklang stehenden Mieteinnahmen lediglich in der Lage, ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Damit fehlten ihr zur Realisierung des Projektes ca. 3,5 Mio. €. Sie sei nicht in der Lage, diesen Betrag aus eigenen Mitteln zu schultern. Soweit in ihren Jahresabschlüssen für die Jahre 2014 bis 2019 Gewinne ausgewiesen worden seien, könne nicht geschlussfolgert werden, dass es ihr möglich sei, die für die Sanierung des Objektes erforderlichen finanziellen Mittel aus eigener Kraft zu erwirtschaften. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2020 werde deshalb kein relevanter Jahresüberschuss erwirtschaftet werden können. Eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt A-Stadt könne der Beklagte nicht verlangen, da andernfalls unverhältnismäßig in die Selbstverwaltungsgarantie der Stadt eingegriffen werde. Die Stadt genieße als fiskalischer Eigentümer der klagenden Gesellschaft auch im Hinblick auf das Eigentumsrecht einfachgesetzlichen Schutz. Es sei dem Eigentümer nicht zumutbar, irgendeinen Erhaltungsaufwand für ein nicht nutzbares Objekt zu leisten.
Die Klägerin hat beantragt,
den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 30. März 2015 zu verpflichten, ihr die Genehmigung für den Abriss der Mehrfamilienwohnhäuser M-Straße 1 – 12 in A-Stadt zu erteilen.
Der Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen
und u.a. erwidert: Die Wohnsiedlung besitze die für ihre Einstufung als Kulturdenkmal erforderliche Denkmalfähigkeit und -würdigkeit, wie sich aus der denkmalfachlichen Einschätzung des Beigeladenen ergebe. Der Eingriff in das Kulturdenkmal könne nicht genehmigt werden. Die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA lägen nicht vor. Das ISEK sei eine nicht rechtsverbindliche Planung, die angesichts der Geltungsdauer einer regelmäßigen Anpassung bedürfe. Denkmalrechtliche Belange seien bei den Planungen nicht abgewogen worden. Was die Frage der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung der Gebäude betreffe, seien von den Gesamtsanierungsaufwendungen trotz der im gerichtlichen Verfahren vorgelegten Gutachten Abzüge wegen unterbliebener Bauerhaltungsmaßnahmen vorzunehmen. Soweit die Stadt A-Stadt in Zusammenhang mit der Berücksichtigung öffentlicher Zuwendungen erklärt habe, Fördermittel nicht einsetzen zu wollen, seien die Äußerungen der Stadt nicht Ausfluss eines ordnungsgemäßen Zuwendungsverfahrens. Die Stadt A-Stadt hätte den Antrag an die zuständige Bewilligungsbehörde weiterleiten müssen. Es fehle weiter an der Anrechnung steuerlicher Vorteile. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass die Regelung in § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA ihren rechtlichen Grund allein in der verfassungsrechtlichen Bestimmung des Art. 14 Abs. 1 GG finde. Eine Gesellschaft, die zu 100 % von einer kommunalen Gebietskörperschaft beherrscht werde und bei der es sich um ein Unternehmen im Bereich der Daseinsvorsorge handele, könne sich nicht auf Art. 14 Abs. 1 GG berufen. Deshalb finde die Regelung in § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA hier von vornherein keine Anwendung. Die Stadt A-Stadt könne aufgrund ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin auf die Klägerin auch einwirken und diese steuern und kontrollieren. Zwar sei die Haftung der Gemeinde gemäß § 129 Abs. 1 Nr. 4 KVG LSA auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt. Allerdings bestehe bei Unternehmen der Daseinsvorsorge, selbst wenn sie dauerhaft Verluste erwirtschafteten, ein tatsächlicher Zwang zur Unternehmensfortführung. Habe sich die Stadt A-Stadt dafür entschieden, ihrer Verpflichtung zur Daseinsvorsorge mithilfe privatwirtschaftlicher Unternehmen nachzukommen, müsse sie auch die damit verbundenen Kosten tragen. Zwar treffe die Erhaltungspflicht die kommunalen Gebietskörperschaften nicht uneingeschränkt. Vielmehr seien die wohlverstandenen Belange dieser Körperschaften im Rahmen der Selbstverwaltungsgarantie, insbesondere die kommunale Finanzhoheit zu beachten. Eine Verletzung derselben sei allerdings erst dann anzunehmen, wenn die durch die Aufgabe des Denkmalschutzes verursachte Bindung von Haushaltsmitteln dazu führe, dass sie ihre eigenen Aufgaben nicht mehr erfüllen könne. Dies sei hier aber nicht der Fall. Die Stadt A-Stadt könne auf einen genehmigten Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 verweisen. Im Übrigen solle das Land Sachsen-Anhalt gemäß Art. 88 Abs. 1 der Landesverfassung dafür sorgen, dass die Kommunen über Finanzmittel verfügten, die zur angemessenen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich seien. Nach § 1 Abs. 2 FAG LSA würden den Gemeinden Finanzmittel in Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen zur Erfüllung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Unabhängig davon sehe § 17 FAG LSA die Möglichkeit von Leistungen aus dem Ausgleichsstock auf Antrag vor.
Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt
Mit dem angefochtenen Urteil vom 7. Juli 2020 hat das Verwaltungsgericht den Beklagten verpflichtet, der Klägerin die Genehmigung für den Abriss der Mehrfamilienwohnhäuser M-Straße 1 bis 12 in A-Stadt zu erteilen, und zur Begründung u.a. ausgeführt:
Die Klägerin habe einen Anspruch auf Erteilung der begehrten Abrissgenehmigung für die sechs Wohngebäude, die ein Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA darstellten. Nach der fachlichen Stellungnahme des Beigeladenen vom 24. November 2014 (ergänzt durch Stellungnahme vom 1. Februar 2017) besitze die Siedlung M-Straße Denkmalfähigkeit und Denkmalwürdigkeit. Ihr werde sowohl aus geschichtlichen Gründen als auch aus kulturell-künstlerischer sowie städtebaulicher Sicht eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Der Beigeladene, der als Denkmalfachamt im Sinne des § 5 Abs. 1 DenkmSchG LSA in besonderem Maße zur Beurteilung der Denkmaleigenschaft berufen sei, habe die historische Bedeutung nachvollziehbar dargelegt. Die Denkmaleigenschaft der Gebäude sei auch nicht nachträglich durch Substanzverlust entfallen.
Die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA lägen nicht vor. Ein überwiegendes öffentliches Interesse anderer Art im Sinne dieser Vorschrift sei nicht gegeben. Die Klägerin könne sich hierzu nicht auf das ISEK als Ausfluss ihrer Planungshoheit nach Art. 28 Abs. 2 GG berufen. Ein städtebauliches Entwicklungskonzept sei nicht von derartigem Gewicht, dass es ein überwiegendes öffentliches Interesse im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA zu begründen vermöge. Es sei zwar denkbar, dass die durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützte kommunale Planungshoheit der Gemeinde in Ausnahmefällen so eindeutig Vorrang haben könne, dass ein überwiegendes öffentliches Interesse angenommen werden könne und eine Abrisserlaubnis erteilt werden müsse. Dies setze aber eine hinreichend konkrete, verbindliche Planung wie z. B. einen verbindlichen Bebauungsplan voraus. Erforderlich sei, dass die Abwägung der widerstreitenden Interessen, die durch die Denkmalschutzbehörde bei der Erteilung der Abrisserlaubnis vorzunehmen sei, inhaltlich schon bei Erstellung der verbindlichen Planung – mit Beteiligung der Denkmalschutzbehörde – vorweggenommen worden sei. Ein städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB enthalte – anders als ein Bebauungsplan z.B. mit Festsetzungen auf der Grundlage von § 9 Abs. 2a BauGB – keine rechtsverbindlichen Festsetzungen. Nichts Anderes gelte für das ISEK, denn es sei jederzeit änderbar.
Es lägen allerdings die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA vor, wonach ein Eingriff in ein Kulturdenkmal zu genehmigen sei, wenn die unveränderte Erhaltung des Kulturdenkmals den Verpflichteten unzumutbar belaste. Bei der Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der Erhaltung eines Kulturdenkmals sei zunächst und in erster Linie von Bedeutung, ob dem Eigentümer – ungeachtet finanzieller Folgelasten – überhaupt angesonnen werden dürfe, das Kulturdenkmal in seiner Substanz zu erhalten. was zu verneinen sei, wenn er es nicht mehr sinnvoll nutzen könne, weil es „nur noch Denkmal“ sei und damit ausschließlich dem Wohl der Allgemeinheit diene. Im Übrigen sei die Zumutbarkeit anhand eines Vergleichs der voraussichtlichen Investitions- und Bewirtschaftungskosten sowie der möglichen Nutzungserträge zu beurteilen. Die Belastungen dürften nicht so weit gehen, dass das Denkmal bloßes Zuschussobjekt sei oder überhaupt keine Nutzungsmöglichkeit mehr bestehe, welche als – noch – wirtschaftlich sinnvoll angesehen werden könne. Entscheidend sei, ob sich das Objekt „selbst trage“. Wirtschaftliche Belastungen, die lediglich das Spiegelbild vorausgegangener Verletzungen denkmalrechtlicher Pflichten darstellten, seien in die Wirtschaftlichkeitsrechnung allerdings nicht einzustellen, weil der Denkmaleigentümer sonst bei hinreichend langer Vernachlässigung des Denkmals regelmäßig die Zurücknahme oder völlige Aufgabe des Denkmalschutzes erzwingen könnte. Dem trage § 10 Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA Rechnung, der bestimme, dass sich der Verpflichtete nicht auf die Belastung durch erhöhte Erhaltungsmaßnahmen berufen könne, die dadurch verursacht worden seien, dass Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht zuwider unterblieben seien. Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung seien vor allem die Finanzierungskosten einer Sanierung sowie die Bewirtschaftungskosten den voraussichtlichen Mieteinnahmen bzw. dem Gebrauchswert des Denkmals gegenüberzustellen. Da gemäß § 10 Abs. 5 Satz 2 DenkmSchG LSA Zuwendungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln oder steuerliche Vorteile anzurechnen seien, wenn der Verpflichtete diese in Anspruch nehmen könne, seien auch derartige „Zuschüsse“ zu berücksichtigen.
Bei der Bestimmung der Maßstäbe für die wirtschaftliche Zumutbarkeit der Erhaltungspflicht sei hier aber zu berücksichtigen, dass es sich bei der Klägerin um ein öffentliches Unternehmen handele, das sich nicht in einer grundrechtstypischen Gefährdungslage befinde, weil es von der Stadt A-Stadt zu 100 % getragen werde. In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sei geklärt, dass in privatrechtlichen Organisationsformen geführte Unternehmen, die – wie hier – vollständig im Eigentum des Staates stehen (öffentliche Unternehmen), unmittelbar an die Grundrechte gebunden (und daher nicht grundrechtsfähig) seien, und zwar unabhängig davon, ob die für den Staat oder andere Träger öffentlicher Gewalt handelnde Einheit „spezifische“ Verwaltungsaufgaben wahrnehme, ob sie erwerbswirtschaftlich oder zur reinen Bedarfsdeckung tätig werde („fiskalisches“ Handeln) und welchen sonstigen Zweck sie verfolge. Entgegen der Annahme des Beklagten bedeute dies allerdings nicht, dass sich die Klägerin als kommunales Unternehmen von vornherein nicht auf § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA berufen könne. Dass es sich bei der Klägerin um ein öffentliches Unternehmen handele, habe allerdings Einfluss auf die anzuwendenden Maßstäbe zum Vorliegen einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit. So könne die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt nicht zur Anwendung gelangen, wonach „andere Einkünfte“ des Denkmaleigentümers aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht herangezogen werden könnten. Denn diese Feststellung sei Ausfluss der sich aus Art. 14 GG ergebenden Direktiven. Da sich der Eigentümer eines Kulturdenkmals in Fallgestaltungen der vorliegenden Art nicht auf Art. 14 GG berufen könne, finde die Regelung in § 10 Abs. 4 Satz 2 DenkmSchG LSA uneingeschränkt Anwendung. Danach sei für die Unzumutbarkeit einer wirtschaftlichen Belastung von Relevanz, ob andere Einkünfte des Verpflichteten herangezogen werden könnten.
Von Relevanz sei weiter die Rechtsprechung zu kommunalen Gebietskörperschaften, die sich auf die Unzumutbarkeit der Erhaltung eines in ihrem Eigentum stehenden Kulturdenkmals berufen. Danach sei geklärt, dass sich diese als „Teil der staatlichen Verwaltung“ ebenfalls nicht auf das Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG berufen könnten. Die Denkmalschutzbehörde habe in diesen Fällen allerdings unter Berücksichtigung der Staatszielbestimmung des Art. 36 Abs. 4 Verf LSA die wohlverstandenen Belange dieser Körperschaft im Rahmen der Selbstverwaltungsgarantie, insbesondere die kommunale Finanzhoheit, zu beachten. Eine Verletzung derselben sei anzunehmen, wenn die durch die Aufgaben des Denkmalschutzes verursachte Bindung von Haushaltsmitteln bei einer kommunalen Gebietskörperschaft dazu führe, dass sie ihre eigenen Aufgaben nicht mehr erfüllen könne. Auch diese Rechtsprechung könne aber im vorliegenden Fall nicht unmittelbar zur Anwendung gelangen, weil Klägerin des vorliegenden Verfahrens keine kommunale Gebietskörperschaft, sondern ein öffentliches Unternehmen sei. Bei der Frage, ob einem öffentlichen Unternehmen die Erhaltung eines denkmalgeschützten Objektes zumutbar sei oder nicht, könnten die Maßstäbe, die für Gemeinden gelten, deshalb nur ein erster Anhaltspunkt sein. Solche Unternehmen könnten sich nicht – wie die Gemeinden – auf Rechtspositionen wie die Selbstverwaltungsgarantie und die Finanzhoheit berufen. An Gewicht gewönnen in diesem Zusammenhang die Fragen, welche Aufgaben das betroffene Unternehmen habe und welche Finanzierungsquellen vorhanden seien. Nicht zu folgen sei der Auffassung, dass die Erhaltung eines Kulturdenkmals einem öffentlichen Unternehmen bereits dann nicht mehr zumutbar sein solle, wenn die Prognose gerechtfertigt sei, dass das betroffene Unternehmen bei Annahme einer Erhaltungspflicht seine Aufgaben nicht mehr weiter wahrnehmen könnte. Denn diese lediglich auf die internen Verhältnisse der kommunalen Gesellschaft abstellende Sichtweise würde den landesverfassungsrechtlichen Vorgaben in Art. 36 Abs. 4 Verf LSA nicht gerecht. Nach dieser Staatszielbestimmung sorge das Land, unterstützt von den Kommunen, für den Schutz und die Pflege der Denkmale von Kultur und Natur. Hierbei handele es sich um eine Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang. Dem entsprechend bestimme § 1 Abs. 2 DenkmSchG LSA, dass bei der Wahrnehmung der Aufgaben von Denkmalschutz und Denkmalpflege das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften sowie Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen zusammenwirken. Ihnen obliege zugleich die besondere Pflicht, die ihnen gehörenden oder von ihnen genutzten Kulturdenkmale zu erhalten. Handele es sich um ein öffentliches Unternehmen, dessen Alleingesellschafter eine kommunale Gebietskörperschaft sei, müssten bei der Frage, ob dem Eigentümer des Kulturdenkmals der Erhalt des Objektes wirtschaftlich zumutbar sei, die finanziellen Möglichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaft jedenfalls dann berücksichtigt werden, wenn es sich – wie hier – um ein öffentliches Unternehmen der Daseinsvorsorge handele. Unabhängig davon, ob eine Nachschusspflicht der Gemeinde bestehe, habe die Gemeinde ihren Einfluss auf die Gesellschaft nicht verloren; auch sei eine Haftung der Kommune nicht ausgeschlossen, sondern lediglich auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt. Jedenfalls dürfe die Gemeinde mit Blick auf die Staatszielbestimmung in Art. 36 Abs. 4 Verf LSA dem Abriss eines Kulturdenkmals durch ihr Unternehmen, das die Sanierung und Unterhaltungskosten dieses Objektes nicht mehr zu tragen vermöge, nicht tatenlos zuschauen. Sie sei in diesem Fall vielmehr gehalten, der Gesellschaft das erforderliche finanzielle Kapital zur Verfügung zu stellen. Diese Auslegung lasse sich auch mit dem Wortlaut von § 10 Abs. 4 Satz 2 DenkmSchG LSA vereinbaren, soweit dort auf „andere Einkünfte des Verpflichteten“ Bezug genommen werde. Dass es sich bei diesen „Einkünften“ lediglich um Eigenmittel des Denkmaleigentümers handeln und ein finanzieller „Durchgriff‘ auf den Gesellschafter nicht möglich sein solle, lasse sich der Bestimmung nicht entnehmen. Da mit einem derartigen „Durchgriff“ auf die kommunale Gebietskörperschaft als Gesellschafterin des öffentlichen Unternehmens allerdings ein Eingriff in die Finanzhoheit nach Art. 28 Abs. 2 GG verbunden sei, unterliege dieser Eingriff aber verfassungsrechtlichen Beschränkungen. Der mit Blick auf den Denkmalschutz verfassungsrechtlich geforderte Zugriff auf Haushaltsmittel dürfe bei der kommunalen Gebietskörperschaft nicht dazu führen, dass sie ihre eigenen Aufgaben nicht mehr erfüllen könne. Führe die durch die Aufgabe des Denkmalschutzes verursachte Bindung von Haushaltsmitteln dazu, dass den Gemeinden die „freie Spitze“ bei der Erfüllung von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben nicht mehr zur Verfügung stehe oder sogar Pflichtaufgaben nicht mehr wahrgenommen werden könnten, erweise sich der Erhalt des Kulturdenkmals als unzumutbar.
Nach diesen Maßgaben habe die Klägerin dargelegt, dass ihr der Erhalt der in Rede stehenden Objekte nicht zumutbar sei. Bei einer Sanierung der Gebäude in der von ihr angestrebten Weise fehle ihr ein Betrag von ca. 3,2 Mio. €. Sie habe hinreichend glaubhaft gemacht, dass die mit der Erhaltung und Bewirtschaftung der in Rede stehenden Gebäude verbundenen Kosten die Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals deutlich überschreiten.
Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung seien auf der Einnahmenseite zunächst die jährlichen Mieteinnahmen zu berücksichtigen, die die Klägerin in ihrer Anfangsaufstellung mit jährlich 139.320,72 € und in ihrer mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2019 aktualisierten Übersicht für das erste Jahr der Berechnung (2022) mit 135.828 € beziffert habe. Zweifel an der Höhe dieser Angaben bestünden nicht. Auf der Einnahmenseite seien weiter die steuerlichen Vorteile zu berücksichtigen. Hierzu habe die Klägerin vorgetragen, dass Steuervorteile bei der Rechtsform der GmbH nicht erzielbar seien. Für die Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit komme es nicht auf theoretische Abschreibungsmöglichkeiten an, sondern darauf an, ob sich die Abschreibungsmöglichkeiten im Ergebnis auch steuermindernd auswirkten. Nach dem Schreiben der Steuerberatungsgesellschaft D. vom 9. Dezember 2019 sei dies hier nicht der Fall. Die Klägerin habe bei ihrer Berechnung auch öffentliche Zuschüsse in hinreichender Weise in ihrer aktualisierten Aufstellung berücksichtigt, namentlich die mit Bescheid des Beklagten vom 2. Juli 2020 bewilligten Fördermittel in Höhe von insgesamt 216.703 €. Was daneben die durch sie beantragten Zuwendungen im Rahmen des „Stadtumbaus Ost“ anbelange, müsse sich die Klägerin nicht entgegenhalten lassen, dass sie einen entsprechenden Antrag auf Bewilligung öffentlicher Zuwendungen nicht gestellt habe. Sie habe hierzu unwidersprochen vorgetragen, dass sie bei der Stadt A-Stadt zweimal die Gewährung einer Zuwendung zur Unterstützung des Gebäuderückbaus aus dem Förderprogramm „Zuwendungen im Rahmen des Stadtumbaus Ost“ beantragt habe, und zwar im Oktober 2014 sowie nochmals mit Antrag vom 5. Januar 2018. Dass diese Anträge mit Bescheid des Beklagten vom 31. Januar 2018 bzw. mit Schreiben der Stadt A-Stadt vom 31. Januar 2018 abgelehnt worden seien, sei in diesem Zusammenhang ohne Relevanz. Auch komme es nicht darauf an, ob die Stadt A-Stadt über den Antrag in dieser Form hätte entscheiden dürfen. Eine Anrechnung nach § 10 Abs. 5 Satz 2 DenkmSchG LSA setze grundsätzlich voraus, dass die möglichen Zuwendungen dem Erhaltungspflichtigen verbindlich zugesagt worden seien oder sonst ein Rechtsanspruch darauf bestehe. Dies sei hier hinsichtlich des Förderprogramms im Rahmen des Stadtumbaus Ost nicht der Fall. Rechtsgrundlage für diese Förderung sei die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Stadtumbaus-Ost zur Aufwertung von Stadtteilen/Stadtquartieren und zum Abriss/Rückbau dauerhaft leerstehender Wohnungen in nach Stadtentwicklungskonzepten umzustrukturierenden Stadtteilen/Stadtquartieren mit vorrangiger Priorität „Stadtumbau-Ost Stadtteil/Stadtquartier – Aufwertungs- und Abriss/Rückbaurichtlinien“ vom 13. Juni 2003. Nach Ziffer 1.3 dieser Richtlinie bestehe kein Rechtsanspruch der Antragsteller auf Gewährung von Zuwendungen, vielmehr entscheide die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
Auf der Ausgabenseite seien sodann die laufenden jährlichen Kosten zu berücksichtigen. Die Renovierungskosten beliefen sich aktuell auf insgesamt 7.231.000 €, von denen sich die Klägerin allerdings nach § 10 Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA einen Abzug in Höhe von 363.956,44 € gefallen lassen müsse. In seinem Gutachten vom 19. August 2018 habe der Gutachter die Kosten, die dadurch verursacht seien, dass Erhaltungsmaßnahmen nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlichen Recht zuwider unterblieben seien, auf insgesamt 336.500 € beziffert. Auf der Grundlage der von der Klägerin bereitgestellten Fotoaufnahmen habe er Bauschäden erkannt, die bereits im Jahr 1999 vorlegen hätten, in dem die Klägerin spätestens über die Denkmaleigenschaft des Objektes informiert gewesen sei. Die in Rede stehenden Gebäude hätten sich in diesem Zeitpunkt bereits in einem extrem renovierungsbedürftigen Zustand befunden, für den die Klägerin nicht verantwortlich gemacht werden könne. Verursacht habe sie ab dem Jahr 1999 lediglich die über den bereits vorliegenden Sanierungsstau hinausgehenden Kosten, also die Kosten, die entstanden seien, weil sie das Objekt seit 1999 nicht im erforderlichen Umfang saniert habe. Bei der angesichts der mittlerweile gestiegenen Baukosten gebotenen Anpassung sei ein Betrag von 363.956,44 € zugrunde zu legen, was der durch die Klägerin angegebenen Steigerungsrate der Investitionskosten entspreche. Auf der Ausgabenseite seien weiter die erforderlichen Bewirtschaftungskosten zu berücksichtigen, die in Anlehnung an § 24 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 i.V.m. §§ 25 ff. der Zweiten Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz vom 12. Oktober 1990 zu ermitteln seien. Dass diese von der Klägerin in der aktualisierten Übersicht aufgeführten Kosten unzutreffend ermittelt seien, habe der Beklagte nicht geltend gemacht und sei auch sonst nicht ersichtlich. Auch die dort in Ansatz gebrachten Zinsen (14.500 € Eigenkapitalzinsen für den Eigenmitteianteil in Höhe von 1.450.000 €, insgesamt 62.998,13 € Fremdkapitalzinsen für ein Bankdarlehen in Höhe von 3.541.000 € sowie ein KfW-Darlehen in Höhe von 2.020.000 €) hätten auf der Ausgabenseite berücksichtigt werden können. Als Finanzierungskosten seien sowohl die Eigenkapitalzinsen als auch die Zinsen für das als Kredit aufzunehmende Sanierungskapital anzusetzen, wobei – wie hier geschehen – ein marktüblicher Zinssatz zugrunde zu legen sei (vorliegend: 1 % Zins für das Eigenkapital, 1,8 % Zins für das Bankdarlehen und 0,75 % Zins für das KfW-Darlehen). Tilgungsleistungen blieben im Hinblick auf die durch den Sanierungsaufwand entstehende Substanzverbesserung und Vermögensvermehrung außer Ansatz. Zu berücksichtigen sei weiter, dass die von der Klägerin zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitsberechnung die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von insgesamt 5.561.000 € erfordere (Bankdarlehen in Höhe von 3.541.000 € sowie ein KfW-Darlehen in Höhe von 2.020.000 €). Auf entsprechende Nachfrage der Klägerin habe die D-Bank allerdings mit Schreiben vom 29. November 2019 unter Hinweis auf die vergleichsweise sehr hohen Baukosten gegenüber den damit nicht im Einklang stehenden Mieteinnahmen mitgeteilt, dass sie sich (mittlerweile) lediglich in der Lage sehe, ein Darlehen in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Verfügung zu stellen. Für die Klägerin ergebe sich danach ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.197.043.56 €.
Die Klägerin müsse sich nicht nach § 10 Abs. 6 DenkmSchG LSA entgegenhalten lassen, dass sie sich nicht hinreichend um die Veräußerung des Denkmals zu einem angemessenen Preis bemüht habe. Der Denkmaleigentümer sei im Rahmen der Prüfung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit nicht verpflichtet, den Nachweis zu erbringen, dass er das Baudenkmal nicht verkaufen oder verpachten könne; diese Pflicht treffe vielmehr die Genehmigungsbehörde. Zwar sei diese Rechtsprechung in Ansehung von Art. 14 GG für private Eigentümer entwickelt worden, und es sei fraglich, ob sich diese Rechtsprechung auf öffentliche Unternehmen ohne weiteres übertragen lasse. Mit Blick auf die Staatszielbestimmung des Art. 36 Abs. 4 Verf LSA könnte auch zu verlangen sein, dass ein öffentliches Unternehmen, das sich auf die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung eines Denkmals berufe, zusätzlich nachweise, dass es sich erfolglos um die Veräußerung des Denkmals zu einem angemessenen Preis bemüht habe. Letztlich könne diese Frage aber dahinstehen, da die Klägerin nachvollziehbar dargelegt habe, dass sie das Denkmal zu einem angemessenen Preis nicht verkaufen könne. Sie habe vorgetragen, dass es innerhalb von zwei Jahren lediglich zwei Interessenbekundungen gegeben habe, die allerdings nach kürzester Zeit gescheitert seien, und es auch aktuell keine Kaufinteressenten gebe. Dies erscheine mit Blick auf den hohen Investitionsaufwand und die mageren Renditen, die bei einer Vermietung des Objekts zu erwarten wären, auch nachvollziehbar.
Die Klägerin sei nicht in der Lage, diese Finanzierungslücke zu schließen. Insbesondere stünden andere finanzielle Mittel, auf die sie zugreifen könnte, nicht zur Verfügung. Der Klägerin wäre es im Sinne einer Quersubventionierung nicht möglich, Gewinne, die sie aus der Bewirtschaftung anderer Objekte erziele, für die Erhaltung des hier in Rede stehenden Objekts zu nutzen. Dies ergebe sich aus den von ihr vorgelegten Jahresabschlüssen für die Jahre 2014 bis 2019. Die Klägerin habe auch plausibel vorgetragen, dass für das laufende Geschäftsjahr 2020 kein relevanter Jahresüberschuss erwirtschaftet werden könne. Sie habe ferner nachgewiesen, dass die Stadt A-Stadt nicht über die erforderlichen Haushaltsmittel verfüge, um der Klägerin einen finanziellen Zuschuss zu gewähren. Der Stadt A-Stadt stünde eine „freie Spitze“ bei der Erfüllung von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben nicht mehr zur Verfügung, wenn sie der Klägerin die hier erforderlichen 3,2 Mio. € zur Verfügung stellen müsste. Zu berücksichtigen sei in diesem Zusammenhang auch, dass nach Art. 36 Abs. 1 Verf LSA Kunst, Kultur und Sport durch das Land und die Kommunen zu schützen und zu fördern seien. Darüber hinaus förderten nach Art. 36 Abs. 3 Verf LSA das Land und die Kommunen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die kulturelle Betätigung aller Bürger insbesondere dadurch, dass sie öffentlich zugängliche Museen, Büchereien, Gedenkstätten, Theater, Sportstätten und weitere Einrichtungen unterhalten. Müsste die Stadt A-Stadt Spielplätze und Jugendsporteinrichtungen schließen, beträfe dies den Bereich der nach Art. 36 Abs. 1 Verf LSA zu schützenden und zu fördernden sportlichen Betätigung von Kindern und Jugendlichen. Insoweit stünden mehrere landesverfassungsrechtlich geschützte Werte in Konkurrenz, nämlich einerseits der Denkmalschutz nach Art. 36 Abs. 4 Verf LSA und andererseits der Bereich „Kultur und Sport“ nach Art. 36 Abs. 1 Verf LSA. In einer solchen Situation stehe der Gemeinde eine gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbare Einschätzungsprärogative hinsichtlich der Frage zu, welchem Belang sie im konkreten Fall größeres Gewicht beimessen wolle.
Die vom Verwaltungsgericht zugelassene Berufung hat der Beklagte wie folgt begründet: Das Staatsschutzziel des Art. 36 Abs. 4 Verf LSA lege den Kommunen eine erhöhte Erhaltungspflicht für Denkmäler auf. Die gesteigerte Erhaltungspflicht durch die kommunalen Gebietskörperschaften sei auch im DenkmSchG LSA an zentraler Stelle in § 1 Abs. 2 Satz 2 geregelt, wonach die kommunalen Gebietskörperschaften die besondere Pflicht hätten, die ihnen gehörenden und von ihnen genutzten Kulturdenkmale zu erhalten. In der Begründung zum Dritten Investitionserleichterungsgesetz werde ausgeführt: „Da ohnehin das Land, die Landkreise, Gemeinden oder Gemeindeverbände sich regelmäßig stärker als Private für den Erhalt schützenswerter Kulturgüter einsetzen, wird von ihnen ohnehin nur in begrenzten Fällen auf Erhaltungsmaßnahmen verzichtet werden.“ Die aus Art. 36 Abs. 4 Verf LSA resultierende Beschränkung des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts sei durch das überörtliche Interesse am Denkmalschutz gerechtfertigt. Auch das Bundesverfassungsgericht habe in seiner Entscheidung vom 2. März 1999 den hohen Rang der Gemeinwohlaufgabe Denkmalschutz hervorgehoben. Es sei den Gemeinden und deren Unternehmen im alleinigen oder mehrheitlichen Besitz grundsätzlich auferlegt, für die Erhaltung der in ihrem Eigentum stehenden Kulturdenkmale zu sorgen. Eine Verletzung der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinde sei nur dann gegeben, wenn die Erhaltungspflicht dazu führe, dass sie ihre eigenen Aufgaben nicht mehr erfüllen könne. Die Klägerin, die den gesamten Bestand des kommunalen Wohnungseigentums verwalte, habe in den letzten Wirtschaftsjahren in geringem Umfang Jahresüberschüsse erwirtschaftet. Ihre Pflicht zur Erhaltung des Kulturdenkmals sei, da sie Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge für die Stadt A-Stadt wahrnehme, unmittelbar mit der Haushaltslage der Stadt verbunden. Sofern sie die Aufgabe nicht mehr ausübe, falle diese zur Erfüllung an die Stadt zurück. In den §§ 128 ff. KVG LSA seien Regelungen enthalten, die der Gemeinde ein umfassendes Kontroll- und Einwirkungsrecht auf das Unternehmen gäben. Dabei müsse die nachhaltige Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Vordergrund stehen. Die Aufgabenerfüllung müsse dauerhaft gesichert sein. Die Erhaltung der Kulturdenkmale von Gemeinden sei eine gemeindliche Pflichtaufgabe mit Verfassungsrang. Die Gemeinden seien mit ihren ohnehin umfassenden Aufgaben und Kompetenzen aufgrund anderer Gesetze in der Praxis tatsächlich die wichtigsten Träger von Denkmalpflege und Denkmalschutz. Nach der Kommentierung zu § 2 Abs. 2 Halbsatz 1 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Niedersachsen, der § 1 Abs. 2 Satz 2 DenkmSchG LSA entspreche, werde ausgeführt, dass die Erhaltungspflicht für die eigenen Kulturdenkmale in verschiedenen Landesdenkmalschutzgesetzen an den Vorbehalt der Leistungsfähigkeit der Gemeinden gebunden sei und insoweit das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden in zulässiger Weise beschränkt werde. Nach einer Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 16. Januar 2008 sei aufgrund dieser gesteigerten Erhaltungspflicht bei einem in kommunalem Eigentum stehenden Kulturdenkmal, dessen Erhalt unrentabel sei, die Erteilung der Abrisserlaubnis nicht – wie bei einem privaten Eigentümer – zwingend. Vielmehr habe die Denkmalschutzbehörde diesen Gesichtspunkt der Unrentabilität bei der zu treffenden Ermessensentscheidung als abwägungserheblichen Belang – neben anderen – einzubeziehen. Dabei sei z.B. zu prüfen, wie hoch ein eventuelles Defizit sei und ob es der Kommune wegen der gesteigerten Erhaltungspflicht zuzumuten sei, dieses zu tragen. Auch ein Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 24. September 2015 mache den Unterschied zwischen der Erhaltungspflicht eines Privateigentümers einerseits und der öffentlichen Hand andererseits deutlich. Da nach dem DenkmSchG LSA die grundsätzliche Erhaltungspflicht der Kommunen nicht an ihre Leistungsfähigkeit gebunden sei, könne sich die Gemeinde in zulässiger Weise (nur) auf die im GG verankerte Selbstverwaltungsgarantie, insbesondere die Finanzhoheit berufen. Diese sei aber nicht absolut. Die kommunale Finanzhoheit bestehe nicht darin, dass die Gemeinde nach Belieben frei schalten könne, sondern darin, dass sie verantwortlich disponiere und bei ihren Maßnahmen auch ihre Stellung innerhalb der Selbstverwaltung des modernen Verwaltungsstaates und die sich daraus ergebende Notwendigkeit des Finanzausgleichs in Betracht ziehe. Der verfassungsrechtlich zulässige Gesetzesvorbehalt erfasse auch landesrechtliche Regelungen zur Haushaltswirtschaft und gelte somit auch für die kommunale Finanzhoheit als Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. Die Stadt A-Stadt befinde sich seit 20 Jahren in der Haushaltskonsolidierung. Um Fehlbedarfe zu vermeiden, müsse eine Gemeinde sich auch um eine bessere Ausschöpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten und damit eine Erhöhung ihrer laufenden Einnahmen bemühen. Gerade in diesem Bereich seien Reserven etwa bei den Steuerhebesätzen noch vorhanden. Auch auf der Ausgabenseite bestehe noch Spielraum im Hinblick auf die Reduzierung freiwilliger Aufgaben. Die vom Verwaltungsgericht genannten Bereiche Kultur und Sport seien freiwillige Aufgaben. In der mündlichen Verhandlung habe der Oberbürgermeister der Stadt A-Stadt lediglich dargelegt, dass bei Erhaltung des Kulturdenkmals Spielplätze und Jugendsporteinrichtungen zu schließen wären, nicht aber, dass die Stadt insgesamt die ihr obliegenden Aufgaben – gegebenenfalls nach einem Überdenken der Prioritäten – nicht mehr angemessen oder im erforderlichen Mindestmaß erfüllen könne. Die Bestätigung des verwaltungsgerichtlichen Urteils könnte erhebliche Auswirkungen auf den Bestand der Kulturdenkmale in Sachsen-Anhalt haben. Es stehe zu befürchten, dass für Denkmale der Gemeinden oder deren Wohnungsunternehmen Abbrüche beantragt werden mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung geltend zu machen. Bei den dann möglichen Abbrüchen seien erhebliche Einschnitte in die Denkmallandschaft Sachsen-Anhalts zu befürchten. Eine große Zahl von kommunalen Wohnungen befänden sich im Eigentum der öffentlichen Hand.
Der Beklagte beantragt,
das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
und verteidigt das angegriffene Urteil.
Die Beigeladene stellt keinen Antrag.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten und die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
I. Die fristgerecht begründete und auch im Übrigen zulässige Berufung des Beklagten ist unbegründet. Das Verwaltungsgericht hat den Beklagten zu Recht verpflichtet, der Klägerin die begehrte denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Abbruch der sechs in Rede stehenden Wohnhäuser zu erteilen. Die zulässige Klage ist begründet, da die Klägerin einen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung hat (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).
1. Der von der Klägerin beabsichtigte Abriss der sechs Wohnhäuser ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 5 DenkmSchG LSA genehmigungsbedürftig. Das Verwaltungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Gebäude ein Kulturdenkmal in Gestalt eines Denkmalbereichs (§ 2 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA) bilden, die Denkmaleigenschaft nicht nachträglich durch Substanzverlust entfallen ist und die Denkmaleigenschaft auch nicht nach Durchführung einer Sanierung entfallen wird. Der Senat folgt insoweit der Auffassung der Vorinstanz, die sich insbesondere auf die fachliche Stellungnahme des Beigeladenen vom 24. November 2014 (Beiakte A, Bl. 120 f.) und die Ergänzung vom 1. Februar 2017 (VG-Akte, Bl. 106 ff.) stützt, und macht sich diese zu eigen. Die Klägerin hat die nach wie vor und auch nach einer Sanierung (fort-)bestehende Denkmaleigenschaft im Berufungsverfahren auch nicht (mehr) in Frage gestellt.
2. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Erteilung einer denkmalrechtlichen Genehmigung zum Abbruch der Wohngebäude liegen vor. Der Abbruch stellt einen „Eingriff“ in ein Kulturdenkmal im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 1 DenkmSchG LSA in Gestalt einer „Zerstörung“ des Kulturdenkmals dar, der nach § 10 Abs. 2 DenkmSchG zu genehmigen ist, wenn 1. der Eingriff aus nachgewiesenen wissenschaftlichen Gründen im öffentlichen Interesse liegt, 2. ein überwiegendes öffentliches Interesse anderer Art den Eingriff verlangt oder 3. die unveränderte Erhaltung des Kulturdenkmals den Verpflichteten unzumutbar belastet.
a) Dem Verwaltungsgericht ist darin beizupflichten, dass ein überwiegendes öffentliches Interesse anderer Art die Beseitigung der sechs Wohngebäude nicht verlangt. Insbesondere folgt der Senat der Vorinstanz darin, dass sich aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt A-Stadt kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Beseitigung des Denkmalbereichs ergibt. Zwar stellt die gemeindliche Planungshoheit einen im Rahmen des § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA zu berücksichtigenden Belang dar (vgl. Urteil des Senats vom 18. August 2016 – 2 L 65/14 – juris Rn. 65). Auch kommt dem Interesse des Denkmalschutzes gegenüber dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde ebenso wie gegenüber anderen rechtlich geschützten Belangen kein prinzipieller oder genereller Vorrang zu (VGH BW, Urteil vom 10. Oktober 1989 – 1 S 736/88 – NVwZ 1990, 586). Ebenso wenig besteht aber andererseits ein prinzipieller oder genereller Vorrang der gemeindlichen Planung vor den Belangen des Denkmalschutzes; vielmehr sind im Konfliktfall die öffentlichen Denkmalschutzinteressen und die schutzwürdigen Belange der Kommune in einen gerechten Ausgleich zu bringen. Ein Vorrang der gemeindlichen Planungshoheit vor den Belangen des Denkmalschutzes kommt nur dann in Betracht, wenn eine hinreichend konkrete, verbindliche Planung – etwa in Gestalt eines Bebauungsplans – vorliegt, in deren Rahmen unter Beteiligung der Denkmalschutzbehörde und ggf. der Denkmalfachbehörde die Belange des Denkmalschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) mit den widerstreitenden Interessen, u.a. mit beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzepten (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB), abgewogen wurden (vgl. ThürOVG, Urteil vom 16. Januar 2008 – 1 KO 717/06 – juris Rn. 38). Zutreffend hat das Verwaltungsgericht im Übrigen darauf verwiesen, dass in der Teilfortschreibung des ISEK vom 21. Juli 2016 lediglich noch davon die Rede ist, dass der Umgang mit dem Denkmalstatus noch zu klären sei.
b) Zu Recht hat das Verwaltungsgericht auch angenommen, dass die unveränderte Erhaltung des Kulturdenkmals die Klägerin in unzumutbar Weise belastet. Nach § 10 Abs. 4 DenkmSchG LSA können Erhaltungsmaßnahmen nicht verlangt werden, wenn die Erhaltung den Verpflichteten unzumutbar belastet. Unzumutbar ist eine wirtschaftliche Belastung insbesondere dann, wenn die Kosten der Erhaltung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen und andere Einkünfte des Verpflichteten nicht herangezogen werden können.
aa) In Übereinstimmung mit dem Verwaltungsgericht geht der Senat davon aus, dass die Kosten der Erhaltung der sechs Gebäude nicht durch die aus der Vermietung der Wohnungen zu erzielenden Erträge aufgewogen werden können.
Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung nach § 10 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 1 DenkmSchG LSA sind die Kosten der Finanzierung einer die Erhaltung des Denkmals sichernden und zugleich eine zeitgemäße Nutzung ermöglichenden Sanierung sowie die Bewirtschaftungskosten den voraussichtlichen Mieteinnahmen gegenüberzustellen. Da gemäß § 10 Abs. 5 Satz 2 DenkmSchG LSA Zuwendungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln oder steuerliche Vorteile anzurechnen sind, sind solche „Zuschüsse“ von den Sanierungskosten abzuziehen. Da sich der Verpflichtete gemäß § 10 Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA nicht auf die Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten berufen kann, die dadurch verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigen öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind, sind auch diese Kosten von den Sanierungsaufwendungen in Abzug zu bringen. Die Bewirtschaftungskosten sind in Anlehnung an § 24 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 i.V.m. §§ 25 ff. der Zweiten Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz vom 12. Oktober 1990 (BGBl I 2178) – II. BV – zu ermitteln. Gemäß § 24 Abs. 1 II. BV sind Bewirtschaftungskosten die Kosten, die zur Bewirtschaftung des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit laufend erforderlich sind, nämlich Abschreibung, Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und Mietausfallwagnis. Anstelle der dort vorgesehenen Abschreibungen für Gebäude werden allerdings regelmäßig Rückstellungen für größere Reparaturen in Höhe von 1 % des Gebäudewerts und der Sanierungskosten in die Berechnung eingestellt (zum Ganzen: Urteil des Senats vom 15. Dezember 2011 – 2 L 152/06 – juris – Rn. 94 ff., juris, m.w.N.; für die Berücksichtigung der Abschreibung allerdings: BayVGH, Urteil vom 12. August 2015 – 1 B 12.79 – juris Rn. 23).
Nach diesen Grundsätzen erweist sich die Erhaltung der sechs Wohngebäude, ausgehend von den in der letzten Wirtschaftlichkeitsberechnung der Klägerin angegebenen Zahlen, bereits bei überschlägiger Prüfung als unrentabel. Die Aufwendungen für eine erforderliche Sanierung hat die Klägerin dort mit 7.231.000 € beziffert. Hiergegen hat der Beklagte auch im Berufungsverfahren keine Einwände erhoben. Davon sind die vom Beklagten gewährten Zuwendungen in Höhe von ca. 216.703 € sowie die vom Verwaltungsgericht auf der Grundlage des Gutachtens vom 19. August 2018 ermittelten Kosten wegen unterlassener Bauunterhaltung von ca. 364.000 € in Abzug zu bringen. Der sich danach ergebende Betrag in Höhe von – gerundet – 6.650.000 € ist für die Berechnung der Finanzierung zugrunde zu legen. Tilgungsleistungen bleiben im Hinblick auf die durch den Sanierungsaufwand entstehende Substanzverbesserung und Vermögensvermehrung außer Ansatz; denn sie entsprechen dem Wertzuwachs des Objekts infolge der Investition (Urteil des Senats vom 15. Dezember 2011, a.a.O., Rn. 149, m.w.N.). Bei Annahme der von der Klägerin angegebenen Zinssätze von 1 % für Eigenkapital in Höhe von 1.450.000 €, von 0,75 % für ein KfW-Darlehen in Höhe von 2.020.000 € und von 1,8 % für ein Bankdarlehen in Höhe des Restbetrages von 3.180.000 € (der Senat unterstellt hier eine vollständige Finanzierung dieses Betrages durch eine Bank) ergeben sich Finanzierungskosten in Höhe von anfänglich insgesamt ca. 86.890 € (14.500 € + 15.150 € + 57.240 €) im Jahr. Die Instandhaltungskosten hat die Klägerin in ihrer Wirtschaftlichkeitsberechnung mit jährlich 9,21 €/m² Wohnfläche angesetzt und auf insgesamt 19.341,00 € im ersten Jahr und – bezogen auf einen 12-Jahres-Zeitraum – auf durchschnittlich 21.080,25 € beziffert. Die Verwaltungskosten hat sie mit jährlich 298,41 € je Wohnung angesetzt auf insgesamt 16.710,96 € im ersten Jahr und – wiederum bezogen auf einen 12-Jahres-Zeitraum – auf durchschnittlich 18.213,71 € beziffert. Diese Angaben erscheinen dem Senat plausibel. Hinzuzurechnen ist ein Betrag von 1 % der – anrechenbaren – Sanierungsaufwendungen in Höhe von 6.650.000 € für Rückstellungen bzw. Abschreibung, mithin ein Betrag von 66.500 €. Zusammengerechnet fällt damit auf der Ausgabenseite im ersten Jahr ein Betrag von ca. 190.000 € an. Dem stehen zu erwartende Mieteinnahmen nach einer Sanierung in Höhe von jährlich nur ca. 135.000 € bis 140.000 € gegenüber. Bei dieser Gegenüberstellung ist noch nicht berücksichtigt, dass sich die Sanierungskosten aufgrund der allgemein gestiegenen Baupreise und die Zinsen für Immobiliendarlehen in der Zwischenzeit deutlich erhöht haben. Der Umstand, dass eine kontinuierliche Tilgung der Darlehen zu einer Verringerung der jährlichen Zinsbelastung führt, stellt die Unrentabilität von Erhaltungsmaßnahmen – jedenfalls in den ersten Jahren – nicht in Frage. Auch der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung die Unrentabilität der Erhaltung der Gebäude nicht (mehr) in Zweifel gezogen.
bb) Es können auch nicht eventuelle Gewinne oder Vermögensbestandteile des Unternehmens der Klägerin oder von der Alleingesellschafterin (Stadt A-Stadt) zu leistende Zahlungen als „andere Einkünfte“ der Klägerin im Sinne von § 10 Abs. 4 Satz 2 Alt. 2 DenkmSchG LSA herangezogen werden.
(1) Nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. Urteil vom 15. Dezember 2011, a.a.O. Rn. 93) können „andere Einkünfte“ des – privaten – Denkmaleigentümers aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht herangezogen werden, auch wenn der Wortlaut des § 10 Abs. 4 Satz 2 DenkmSchG LSA diese Möglichkeit offen lässt. Insoweit ist diese Vorschrift verfassungskonform auszulegen. Die Sozialbindung des Eigentums rechtfertigt Einschränkungen des Eigentümers immer nur in Ansehung des konkreten Eigentumsobjekts und dessen Nutzung. Dem entsprechend ist die Rechtsstellung des Eigentümers eines Denkmals nicht danach ausgestaltet oder auszugestalten, ob er reich oder arm ist. Die objektive Grenze der Verhältnismäßigkeit ist vielmehr nach dem Inhalt des Eigentums unter Beachtung der Direktiven des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GG zu bestimmen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Beschluss vom 2. März 1999 – 1 BvL 7/91 – juris Rn. 84 f.) muss der Eigentümer angesichts des hohen Ranges des Denkmalschutzes und im Blick auf Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG es zwar grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Nutzung des Grundstücks verwehrt wird; Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste Nutzung des Eigentums. Anders liegt es aber, wenn für ein geschütztes Baudenkmal keinerlei sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr besteht. Die Einschränkung der Gewinnerwartung darf nicht so weit gehen, dass das Denkmal bloßes Zuschussobjekt ist oder überhaupt keine Nutzungsmöglichkeit mehr besteht, welche als – noch – wirtschaftlich sinnvoll angesehen werden kann; entscheidend ist, ob sich das Objekt „selbst trägt“ (Urteil des Senats vom 15. Dezember 2011, a.a.O., m.w.N.).
(2) Eine gegenüber privaten Eigentümern gesteigerte Erhaltungspflicht der kommunalen Gebietskörperschaften besteht in Sachsen-Anhalt nicht.
(2.1.) Eine solche gesteigerte Erhaltungspflicht lässt sich insbesondere nicht auf Art. 36 Abs. 4 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (Verf LSA) stützen. Danach sorgt das Land, unterstützt von den Kommunen, für den Schutz und die Pflege der Denkmale von Kultur und Natur. Gemäß Art. 36 Abs. 5 Verf LSA regeln das Nähere die Gesetze. Art. 36 Abs. 4 Verf LSA stellt eine Staatszielbestimmung dar (vgl. zu Art. 141 Abs. 3 Satz 1 BayVerf: BayVerfGH, Entscheidung vom 17. Juli 2020 – Vf. 23-VII-19 – juris Rn. 33, m.w.N.; zu § 11 Abs. 3 SächsVerf: SächsOVG, Beschluss vom 14. April 2020 – 1 A 1041/19 – juris Rn. 13). Staatszielbestimmungen sind Verfassungsnormen mit rechtlich bindender Wirkung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben (sachlich umschriebener Ziele) vorschreiben; sie begründen eine objektiv-rechtliche Verpflichtung des Staates, sein Handeln (auch) an dem betreffenden Staatsziel auszurichten (VerfG Bbg, Urteil vom 23. Oktober 2020 – 9/19 – juris Rn. 155). Normadressat des Art. 36 Abs. 4 Verf LSA ist indes allein das Land, insbesondere ist der Landesgesetzgeber angesprochen, wie sich aus dem Gesetzesvorbehalt des Art. 36 Abs. 5 Verf LSA ergibt. Den Kommunen kommt nach dem ausdrücklichen Willen des Verfassungsgebers lediglich eine unterstützende Funktion zu. Soweit der Senat in seinem Urteil vom 18. August 2016 – 2 L 65/14 – juris, Rn. 56) die Auffassung vertreten hat, aus der Verpflichtung der kommunalen Gebietskörperschaften zur Unterstützung des Landes bei der Aufgabe des Denkmalschutzes ergebe sich eine gegenüber privaten Eigentümern gesteigerte Erhaltungspflicht, hält er daran nicht mehr fest.
(2.2.) Eine gesteigerte Erhaltungspflicht der Kommunen lässt sich auch nicht den Vorschriften des DenkmSchG LSA entnehmen, vielmehr verlangen sie insoweit eine gleiche Behandlung mit privaten Eigentümern.
Die vom Beklagten für richtig gehaltene Differenzierung lässt sich insbesondere nicht aus § 1 Abs. 2 DenkmSchG LSA ableiten. Danach wirken bei der Wahrnehmung der Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften sowie Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen zusammen; ihnen obliegt zugleich die besondere Pflicht, die ihnen gehörenden oder von ihnen genutzten Kulturdenkmale zu erhalten. Die Gemeinden (und das Land) werden in dieser Vorschrift neben den (privaten) Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmalen gleichrangig genannt; anders als etwa in § 1 Abs. 2 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes, wonach die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege vom Freistaat Sachsen und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit von den Gemeinden und den Landkreisen erfüllt werden, die dabei mit den Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmalen zusammenwirken.
Auch die Vorschriften des § 9 DenkmSchG LSA über die Erhaltungspflicht von Kulturdenkmalen geben für eine solche Unterscheidung nichts her. Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 DenkmSchG LSA sollen das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften die Eigentümer, Besitzer und sonstigen Verfügungsberechtigten von Kulturdenkmalen bei der Erhaltung der Kulturdenkmale unterstützen. Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 DenkmSchG LSA sind die Eigentümer, Besitzer und anderen Verfügungsberechtigten von Kulturdenkmalen verpflichtet, diese im Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit nach denkmalpflegerischen Grundsätzen zu erhalten, zu pflegen, instandzusetzen, vor Gefahren zu schützen und, soweit möglich und zumutbar, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 DenkmSchG LSA ist bei der Zugänglichmachung der im Eigentum von Land oder Kommunen stehenden Kulturdenkmale den Belangen von behinderten Menschen Rechnung zu tragen. Nach § 9 Abs. 4 DenkmSchG LSA tragen das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften zur Erhaltung der Kulturdenkmale nach Absatz 2 unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel durch Zuwendungen bei.
Eine gesteigerte Erhaltungspflicht der kommunalen Gebietskörperschaften lässt sich auch nicht aus dem Vorbehalt in § 10 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 DenkmSchG LSA, dass „andere Einkünfte des Verpflichteten nicht herangezogen werden können“, herleiten. Mit dieser bereits seit Inkrafttreten des DenkmSchG LSA am 29. Oktober 1991 geltenden Regelung wollte der Gesetzgeber keine Pflicht zum Einsatz von sonstigen, über die Erträge oder den Gebrauchswert des Denkmals übersteigenden Mitteln des Eigentümers begründen. In der Begründung zum Gesetzentwurf vom 16. Mai 1991 (LT-Drs. 1/446, S. 18) heißt es zu § 9 Abs. 3 des Entwurfs, der die heute geltenden Regelungen in § 10 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 und 3 DenkmSchG umfasste:
„Wirtschaftliche Unzumutbarkeit tritt ein, wenn die bereits in der Begründung zu Absatz 1 erwähnte Belastung über die zulässige Eigentumsbeschränkung erfolgt und von anderer Stelle kein Ersatz zu verlangen ist. Sie entfällt in jedem Falle, wenn sich Ersatz bietet, auch wenn von privater Seite ein Zuschuss in Höhe des unzumutbaren Teils der Aufwendungen angeboten wird.“
§ 9 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs enthielt die Regelung, dass Erhaltungsmaßnahmen nicht verlangt werden können, wenn die Erhaltung den Verpflichteten unzumutbar belastet. Zu dieser Bestimmung wurde in der Begründung des Gesetzentwurfs (a.a.O., S. 17) ausgeführt:
„Aufwendungen, die sich aus der Spezifik des Besitzes oder der Nutzung eines Kulturdenkmals ergeben, können vom Verpflichteten abgelehnt werden, wenn sie die zulässige Eigentumsbeschränkung (Artikel 14 Abs. 2 Nr. 2 des Grundgesetzes überschreiten.“
Dies deutet darauf hin, dass nach dem bereits damals zu Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers die wirtschaftliche Unzumutbarkeit nicht schon dann entfallen soll, wenn der Verpflichtete wirtschaftlich in der Lage ist, eine Unrentabilität der Erhaltung des Denkmals mit sonstigen (eigenen) Einkünften oder (eigenem) Vermögen auszugleichen. Eine Unterscheidung zwischen privaten Eigentümern einerseits und Körperschaften des öffentlichen Rechts andererseits wurde an dieser Stelle nicht getroffen.
Eine gesteigerte Erhaltungspflicht des Landes, der Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen Kommunalverbände ergab sich vielmehr aus § 10 Abs. 7 DenkmSchG LSA. Danach galten die Absätze 4 und 5 nicht für das Land, die Gemeinden, die Landkreise und die sonstigen Kommunalverbände. In der Begründung des Gesetzentwurfs vom 16. Mai 1991 (a.a.O., S. 18) wurde zu der – im Entwurf in § 9 Abs. 4 formulierten Regelung, wonach „für den Bund, das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften die oberste Denkmalbehörde im Benehmen mit der für die Verwaltung des Kulturdenkmals zuständigen Behörde die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 bis 3 in sinngemäßer Anwendung dieser Vorschriften feststellt“, u.a. ausgeführt:
„Eine Unzumutbarkeit kann nicht für die in diesem Absatz genannten Eigentümer von Kulturdenkmalen akzeptiert werden. Da es ihre Aufgabe ist, gegenüber Anderen, die Interessen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes durchzusetzen, ist es ihre oberste Pflicht, die ihnen gehörenden Objekte im Sinne dieses Gesetzes angemessen zu erhalten.“
In der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien vom 4. September 1991 (LT-Drs. 1/734) wurde dieses gesetzgeberische Anliegen mit der Formulierung in § 10 Abs. 7 DenkmSchG LSA präzisiert.
Mit Art. 2 des Dritten Investitionserleichterungsgesetzes vom 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 769 [801]) hat der Gesetzgeber jedoch § 10 Abs. 7 DenkmSchG LSA aufgehoben. Dadurch wollte er eine Gleichstellung der in dieser Vorschrift genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit privaten Eigentümern erreichen. In der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 4/2252 S. 273) heißt es hierzu:
„Eine Vielzahl von Kulturdenkmalen, dazu zählen insbesondere denkmalgeschützte Gebäude, befinden sich im Eigentum der Öffentlichen Hand. Dem Land, den Landkreisen, Gemeinden oder Gemeindeverbänden fällt es angesichts knapper öffentlicher Kassen zunehmend schwerer, die bestehenden Erhaltungspflichten an denkmalgeschützten Gebäuden im bisherigen Umfang aufrecht zu erhalten. Der hohe Leerstand auch in Gebäuden im öffentlichen Eigentum führt zu erheblichen Zusatzkosten und zur Notwendigkeit, ggf. in Konkurrenz zu Privaten sinnvolle Folgenutzungen zu finden. Die Pflicht aus § 10 Abs. 7, Erhaltungsmaßnahmen für denkmalgeschützte Gebäude auch bei unzumutbarer Belastung im Sinne des § 10 Abs. 4 vorzunehmen, bewirkt eine immer stärkere, nicht mehr vertretbare finanzielle Beeinträchtigung des öffentlichen Eigentümers. Der besonderen Bedeutung des Denkmalschutzes Rechnung tragend soll durch die vorgesehene Änderung die Öffentliche Hand als Eigentümerin den privaten Eigentümern gleichgestellt werden, nicht aber bevorzugt werden. Da ohnehin das Land, die Landkreise, Gemeinden oder Gemeindeverbände sich regelmäßig stärker als Private für den Erhalt schützenswerter Kulturgüter einsetzen, wird von ihnen ohnehin nur in begrenzten Fällen auf Erhaltungsmaßnahmen verzichtet werden.“
Damit hat der Gesetzgeber eine gegenüber privaten Denkmaleigentümern gesteigerte Pflicht zur Erhaltung von Kulturdenkmalen u.a. von Gemeinden ausgeschlossen und sich darauf verlassen, dass sie Denkmale im Regelfall – freiwillig – auch dann erhalten, wenn dies unrentabel ist. Die vom Gesetzgeber gewollte Gleichstellung bedeutet, dass für juristischen Personen des öffentlichen Rechts – unabhängig davon, ob sie sich auf den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG berufen können – für die wirtschaftliche Zumutbarkeit von Erhaltungsmaßnahmen die gleichen Maßstäbe gelten wie für private Eigentümer, sie also keine besondere, über die privaten Eigentümerpflichten hinausgehende Pflicht zur Erhaltung von Baudenkmalen haben (so bereits: Beschluss des Senats vom 29. Januar 2008 – 2 M 358/07 – juris Rn. 20).
(3) Besteht aber für kommunale Gebietskörperschaften gegenüber privaten Eigentümern keine gesteigerte Erhaltungspflicht, lässt sich eine solche Pflicht auch nicht für juristischen Personen des Privatrechts rechtfertigen, deren Alleingesellschafterin eine kommunale Gebietskörperschaft ist. Auch für eine Ungleichbehandlung solcher Unternehmen enthalten die Regelungen des DenkmSchG keine Grundlage.
(4) Der Einwand des Beklagten, bei Anlegung des vom Verwaltungsgericht angelegten Maßstabs – und erst recht im Falle einer Gleichbehandlung der Gemeinden mit privaten Denkmaleigentümern – sei zu befürchten, dass Gemeinden oder deren Wohnungsunternehmen vermehrt Anträge auf Erteilung einer Abbruchgenehmigung stellen mit der Folge, dass erhebliche Einschnitte in der Denkmallandschaft des Landes Sachsen-Anhalt zu befürchten seien, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Es ist Sache des Gesetzgebers, die mit dem Dritten Investitionserleichterungsgesetz ausdrücklich gewollte Gleichstellung u.a. von Gemeinden mit privaten Denkmaleigentümern zu überprüfen und ggf. wieder rückgängig zu machen, insbesondere wenn sich die in der Gesetzesbegründung zugrunde gelegte Annahme, dass u.a. die Gemeinden ohnehin nur in begrenzten Fällen auf Erhaltungsmaßnahmen verzichten, nicht mehr als tragfähig erweisen sollte. Im Übrigen gewährleistet § 10 Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG, wonach der Verpflichtete sich nicht auf die Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten berufen kann, die dadurch verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigen öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind, dass auch Gemeinden und ihre kommunalen Unternehmen nicht ohne weiteres von einer erforderlichen Instandhaltung und Sanierung der in ihrem Eigentum stehenden Denkmale absehen und sich später auf die wirtschaftliche Unzumutbarkeit berufen können. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. Beschluss vom 5. Januar 2022 – 2 M 131/21 – juris Rn. 34) die Voraussetzungen des § 10 Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA nicht nur dann gegeben sind, wenn der Verpflichtete im Laufe der Lebenszeit eines Denkmals als Eigentümer dieser Sache Unterhaltungsmaßnahmen unterlassen hat, sondern auch dann, wenn der Verpflichtete „sehenden Auges“ ein sanierungsbedürftiges Denkmal erwirbt, die Denkmaleigenschaft kennt und die Sanierungsbedürftigkeit offensichtlich ist. Vor diesem Hintergrund könnten sich kommunale Wohnungsunternehmen nicht auf wirtschaftliche Unzumutbarkeit berufen, wenn sie von der Gemeinde offensichtlich sanierungsbedürftige Denkmale erwerben.
II. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 2, 162 Abs. 3 VwGO. Es entspricht der Billigkeit im Sinne von § 162 Abs. 3 VwGO, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen nicht für erstattungsfähig zu erklären, weil er keinen Sachantrag gestellt und sich so auch nicht dem Kostenrisiko des § 154 Abs. 3 VwGO ausgesetzt hat.
III. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. § 709 Satz 1 und 2 und § 708 Nr. 11 ZPO.
IV. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keiner der in § 132 Abs. 2 VwGO genannten Zulassungsgründe vorliegt.