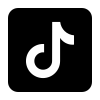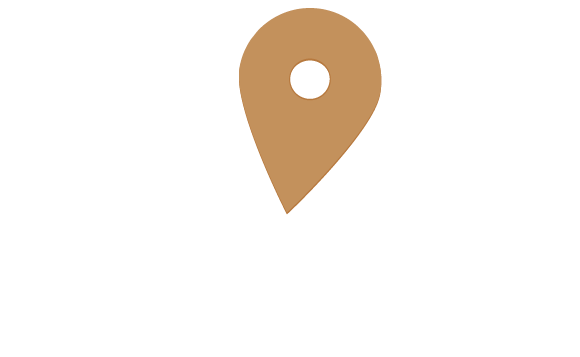Aktenzeichen L 20 P 35/18
GG Art. 3 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1
Leitsatz
Beitragszuschlag in der sozialen Pflegeversicherung bei ungewollter Kinderlosigkeit
Die Erhebung eines Beitragszuschlags für Versicherte ist sowohl bei gewollter wie bei ungewollter Kinderlosigkeit verfassungsgemäß. Ungewollt Kinderlose leisten in gleicher Weise wie gewollt Kinderlose keinen generativen Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung. (Rn. 25) (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
S 15 P 108/16 2018-02-07 SGBAYREUTH SG Bayreuth
Tenor
I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 07.02.2018 wird zurückgewiesen.
II. Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Klägerin hat Missbrauchskosten in Höhe von 750,- € an die Staatskasse zu zahlen.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
Der Senat kann durch Beschluss gemäß § 153 Abs. 4 SGG entscheiden, da er die Berufung einstimmig für unbegründet hält. Eine mündliche Verhandlung ist nicht erforderlich, da alle relevanten Gesichtspunkte aufgezeigt und erläutert worden sind. Zur Entscheidung durch Beschluss sind die Beteiligten mit Schreiben vom 12.09.2018 angehört worden; der Wunsch nach einer mündlichen Verhandlung ist nicht geäußert worden.
Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.
In der gleichgelagerten Situation des Ehemanns und Bevollmächtigten der Klägerin hat der Senat mit Urteil vom 12.04.2018, L 20 P 15/17, die Berufung als unbegründet zurückgewiesen und dies wie folgt begründet:
„Der Senat weist die Berufung aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen Urteils vom 23.02.2017.“
– diese lauten wie folgt:
„Die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage ist zulässig, insbesondere ist sie zum sachlich und örtlich zuständigen Sozialgericht Bayreuth fristgerecht erhoben worden. Sie ist jedoch unbegründet. Der Bescheid der Beklagten vom 11.10.16 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 28.11.16 ist nicht rechtswidrig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, weil die Beklagte im Rahmen der Pflegepflichtversicherung des Klägers zu Recht den Beitragszuschlag von 0,25 Prozent für Kinderlose erhebt.
Gemäß § 55 Abs. 3 S. 1 SGB XI erhöht sich ab 1.1.2005 der nach § 55 Abs. 1 SGB XI geltende Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung um einen Beitragszuschlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten (Beitragszuschlag für Kinderlose) mit dem Ablauf des Monats, in dem das Mitglied das 23. Lebensjahr vollendet hat. Den Beitragszuschlag für Kinderlose tragen grundsätzlich die Versicherten (§ 58 Abs. 1 S. 3, § 59 Abs. 5 SGB XI). Kein Beitragszuschlag ist von versicherten Eltern i.S.d. des § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 SGB I (§ 55 Abs. 3 S. 2 SGB XI) zu entrichten.
Der Kläger hat dementsprechend gemäß § 60 Abs. 5 i.V.m. § 59 Abs. 4 SGB XI aus seinen beitragspflichtigen Einnahmen Pflegeversicherungsbeiträge unter Berücksichtigung des zusätzlichen Beitragszuschlags für Kinderlose zu zahlen. Er gehört nicht zu den Personen, die von dieser Verpflichtung ausgenommen sind. Weder hat er ein Kind noch ein Pflege- bzw. Stiefkind. Die gesetzlichen Vorschriften setzen jedoch bereits nach ihrem Wortlaut für die Elterneigenschaft nur voraus, dass ein Kind vorhanden ist. Die Regelungen stellen nicht darauf ab, ob die Kinderlosigkeit ungewollt ist. Den Gesetzesmaterialien ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Verpflichtung zur Zahlung des Beitragszuschlages unabhängig von den Gründen für die Kinderlosigkeit bestehen soll (vgl. BT-Drucks 15/3671 S. 5). Der Kläger gehört auch nicht zu einer der genannten Gruppen von kinderlosen Versicherten, die von der Zahlungspflicht ausgenommen sind.
Gemäß § 136 Abs. 3 SGG wird im Übrigen auf die zutreffenden Ausführungen in der Begründung des Widerspruchsbescheids Bezug genommen.
Darüber hinaus vermochte die Kammer keine Grundrechtsverletzung zu erkennen, die eine Aussetzung und Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG an das BVerfG erforderte.
Die Problematik einer Grundrechtsverletzung nach Art. 3 Abs. 1 und 6 Abs. 1 GG wird in der Entscheidung des BSG vom 27.02.08, Az. B 12 P 2/07 R hinreichend diskutiert und abgelehnt. So führt das BSG in dieser Entscheidung zutreffend aus:
„Danach verstoßen die mit dem KiBG zur Umsetzung dieses Urteils geschaffenen, den Kläger belastenden Regelungen nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. § 55 Abs. 3 SGB XI führt zu unterschiedlichen Beitragsbelastungen von Versicherten. Während durch die Neuregelung für Versicherte mit Kindern sowie für weitere Gruppen von Versicherten die Beitragsbelastung bei ansonsten unveränderten Umständen ab 1.1.2005 gleich bleibt, erhöht sich bei den übrigen Versicherten – wie auch dem Kläger – ab Vollendung des 23. Lebensjahres der Beitragssatz von 1,7% um 0,25% auf 1,95% der beitragspflichtigen Einnahmen. Der Gesetzgeber hat damit allein an das Vorhandensein von Kindern angeknüpft, nicht dagegen an den jeweils entstehenden Aufwand für Kinder oder die Gründe für die Kinderlosigkeit. Diese Differenzierung ist nicht zu beanstanden.
a) Nicht zu beanstanden ist die Entscheidung des Gesetzgebers, zur Umsetzung des Urteils des BVerfG Kinderlose wie den Kläger mit einem erhöhten Beitrag zu belasten, während Versicherte mit Kindern weiter Beiträge nach dem bisherigen Beitragssatz zahlen. Entgegen der Auffassung des Klägers wird hierdurch die verfassungsrechtlich geforderte relative Beitragsentlastung bewirkt. Es ist nicht ersichtlich, dass der Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers dahin eingeschränkt war, dass nur eine Beitragsreduktion verfassungsrechtlich zulässig gewesen wäre. Eine solche Regelung hätte zu Beitragsausfällen geführt, die mit Beitragssatzerhöhungen hätten kompensiert werden müssen. Der Ausgleich einer relativen Beitragsentlastung im Beitragssystem der sozialen Pflegeversicherung setzte bei angestrebter Beibehaltung des Beitragsaufkommens voraus, dass Kinderlose höhere Beiträge als bisher zu zahlen haben.
b) Soweit der Kläger die Gleichbehandlung von ungewollt kinderlosen Versicherten mit Versicherten mit Kindern begehrt, findet eine solche Forderung im Verfassungsrecht keine Stütze. Das BVerfG hat gerade im Vergleich mit kinderlosen Versicherten eine Entlastung der Gruppe der Versicherten mit Kindern gefordert, mit der der Kläger die Gleichbehandlung begehrt, ohne dabei auf die Gründe der Kinderlosigkeit abzustellen. Sollte im Übrigen auch die unfreiwillige Kinderlosigkeit aus medizinischen Gründen zu einem niedrigeren Beitragssatz führen, wie vom Kläger gefordert, wäre nicht zu erkennen, weshalb nicht auch aus anderen Gründen kinderlose Versicherte, z.B. Versicherte ohne Partner, von der Beitragsbelastung ausgenommen werden müssten.
c) Die Ungleichbehandlung des Klägers ist auch dann gerechtfertigt, wenn Versicherte allein aufgrund der Elterneigenschaft dauerhaft keinen Beitragszuschlag tragen müssen, selbst wenn sie keine Aufwendungen für Kinder haben oder von ihnen keine Erziehungs- und Betreuungsleistungen erbracht werden. Der Gesetzgeber durfte in Ausübung seines ihm eingeräumten Spielraums bei der Ausgestaltung eines Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG entsprechenden Beitragsrechts in der sozialen Pflegeversicherung vom Regelfall ausgehen und die vom BVerfG geforderte Entlastung an das (bloße) Vorhandensein eines Kindes knüpfen sowie ab dessen Geburt eine dauerhafte Beitragsentlastung vorsehen. Das GG verpflichtet den Gesetzgeber entsprechend dem Urteil des BVerfG lediglich dazu, bei der gebotenen Differenzierung der Beitragshöhe den sog. generativen Beitrag zu berücksichtigen und die beitragspflichtigen Mitglieder mit einem oder mehreren Kindern gegenüber kinderlosen Mitgliedern der sozialen Pflegeversicherung bei der Bemessung der Beiträge relativ zu entlasten. Dies kann durch die Berücksichtigung allein der Tatsache, dass ein Kind vorhanden ist, bei der Beitragsbemessung geschehen. Die geforderte Berücksichtigung des sog. generativen Beitrags rechtfertigt es, an die Stellung als Eltern anzuknüpfen, ohne danach zu differenzieren, ob und inwieweit Eltern in der Erziehungsphase tatsächlich im Einzelfall Nachteile entstehen und inwieweit Kinder tatsächlich später zur sozialen Pflegeversicherung Beiträge leisten. Die Feststellung tatsächlicher Nachteile durch die Pflegekassen wäre darüber hinaus mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Schon im Hinblick auf die relativ geringe Differenz von 0,25% Beitragssatzpunkten zwischen kinderlosen Versicherten und solchen mit Kindern steht die Beitragsentlastung letzterer über das Ende der Betreuungsphase und auch der Erwerbsphase der Versicherten hinaus nicht außer Verhältnis. Nach Umfang oder der Dauer der Kindererziehung und -betreuung musste deshalb nicht differenziert werden.“
Einen Verstoß gegen Art. § 3 Abs. 3 S. 2 GG kann die Kammer nicht erblicken, da der Kläger selbst nicht behindert ist.“ –
„zurück und sieht deshalb gemäß § 153 Abs. 2 SGG insofern von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe ab.
Zum Vortrag des Klägers im Berufungsverfahren wird ergänzend auf Folgendes hingewiesen:
* …
* Das SG hat zutreffend darauf hingewiesen, dass der Grund für die Kinderlosigkeit – gewollt oder ungewollt – für die Erhebung des Beitragszuschlags ohne Bedeutung ist. Ungewollt Kinderlose, wie dies früher beim Kläger der Fall war, leisten in gleicher Weise wie gewollt Kinderlose keinen generativen Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung. Unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrundsatzes hat der Gesetzgeber daher zu Recht keinen Befreiungstatbestand vom Beitragszuschlag für ungewollt Kinderlose vorgesehen.
* Der Kläger scheint den Wegfall des Beitragszuschlags für Kinderlose als familienpolitisches Instrument zur Schaffung von Anreizen zur Erhöhung der Geburtenquote zu betrachten. Diese Sichtweise ist falsch; der Beitragszuschlag für Kinderlose ist allein ein Mittel zur Herstellung von Beitragsgerechtigkeit zwischen Kinderlosen, die keinen generativen Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung leisten, und Eltern mit Kindern, die einen solchen Beitrag erbringen. Angesichts der im Vergleich zu den mit Kindern verbundenen finanziellen Aufwendungen verschwindend geringen finanziellen Auswirkung eines Beitragszuschlags von 0,25 Beitragssatzpunkten erscheint dem Senat die Vermutung des Klägers abwegig, der Gesetzgeber hätte mit einem Beitragszuschlag von 0,25 Beitragssatzpunkten einen Anreiz setzen wollen, Kinder zu zeugen.
* Sofern der Kläger offenbar das Institut der Ehe als ein Mittel zur Erlangung des Wegfalls des Beitragszuschlags für Kinderlose betrachtet, kann der Senat dieses Verständnis der Ehe unter dem Gesichtspunkt des Art. 6 GG nicht nachvollziehen.
* Hinsichtlich der vom Kläger behaupteten „groben Verfassungswidrigkeit“ der Erhebung des Beitragszuschlags bei ungewollt Kinderlosen kann der Senat den Kläger nur nochmals auf das Urteil des BSG vom 27.02.2008, B 12 P 2/07 R, verweisen, das zu einer identischen Konstellation wie der des Klägers ergangen ist und in dem Folgendes ausgeführt worden ist:
„Soweit der Kläger die Gleichbehandlung von ungewollt kinderlosen Versicherten mit Versicherten mit Kindern begehrt, findet eine solche Forderung im Verfassungsrecht keine Stütze. Das BVerfG hat gerade im Vergleich mit kinderlosen Versicherten eine Entlastung der Gruppe der Versicherten mit Kindern gefordert, mit der der Kläger die Gleichbehandlung begehrt (dazu s bereits oben), ohne dabei auf die Gründe der Kinderlosigkeit abzustellen. Sollte im übrigen auch die unfreiwillige Kinderlosigkeit aus medizinischen Gründen zu einem niedrigeren Beitragssatz führen, wie vom Kläger gefordert, wäre nicht zu erkennen, weshalb nicht auch aus anderen Gründen kinderlose Versicherte, zB Versicherte ohne Partner, von der Beitragsbelastung ausgenommen werden müssten.“
Die gegen dieses Urteil des BSG erhobene Verfassungsbeschwerde ist im Übrigen wegen fehlender Zulässigkeit nicht zur Entscheidung angenommen worden. Das BVerfG hat sich dabei auch zum Argument des Klägers geäußert, dass ihm die Befreiung vom Beitragszuschlag wegen der Sterilität seine Ehefrau und dem daraus für sie resultierenden GdB von 50 zustehe, wobei dieser Vortrag – ohne dass es darauf für die jetzt zu treffende Entscheidung ankäme – so nicht nachvollziehbar ist, da eine Sterilität in jüngerem Lebensalter bei noch bestehendem Kinderwunsch allein nur einen GdB von 20, nicht aber von 50 begründet (vgl. Ziff. 14.2 der Versorgungsmedizinischen Grundsätzen, Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung). Das BVerfG hat im Nichtannahmebeschluss vom 02.09.2009, 1 BvR 1997/08, Folgendes erläutert:
„Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen. Annahmegründe im Sinne von § 93a Abs. 2 BVerfGG liegen nicht vor. Die Verfassungsbeschwerde hat keine Aussicht auf Erfolg, denn sie ist unzulässig.
Die Verfassungsbeschwerde genügt nicht den Begründungsanforderungen von § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG. Hierzu gehört, dass der Beschwerdeführer darlegt, mit welchen verfassungsrechtlichen Anforderungen die angegriffene Maßnahme kollidiert (vgl. BVerfGE 108, 370 ). Soweit das Bundesverfassungsgericht für bestimmte Fragen bereits verfassungsrechtliche Maßstäbe entwickelt hat, muss anhand dieser Maßstäbe dargelegt werden, inwieweit Grundrechte durch die angegriffenen Maßnahmen verletzt werden (vgl. BVerfGE 99, 84 m.w.N.).
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 3. April 2001 (vgl. BVerfGE 103, 242 ff.) festgestellt, dass es mit Art. 3 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 GG nicht zu vereinbaren ist, dass Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die Kinder betreuen und erziehen und damit neben dem Geldbeitrag einen generativen Beitrag zur Funktionsfähigkeit eines umlagefinanzierten Sozialversicherungssystems leisten, mit einem gleich hohen Pflegeversicherungsbeitrag wie Mitglieder ohne Kinder belastet werden. Es hat dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 31. Dezember 2004 eine Regelung zu treffen, welche die Kindererziehungsleistung in der umlagefinanzierten sozialen Pflegeversicherung bei der Beitragsbemessung berücksichtigt und beitragspflichtige Versicherte mit einem oder mehreren Kindern bei der Bemessung der Beiträge relativ entlastet. Diesem Auftrag ist der Gesetzgeber durch das KiBG nachgekommen. Vor diesem Hintergrund hätte für den Beschwerdeführer Anlass bestanden, ausgehend von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darzulegen, weshalb der Gesetzgeber mit der von ihm vorgenommenen Neuregelung das verfassungsrechtlich Gebotene verfehlt hat. Dem wird die Verfassungsbeschwerde nicht gerecht.
Die Rüge einer Verletzung des Verbots der Benachteiligung behinderter Menschen (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) entbehrt einer nachvollziehbaren Begründung. Der Anwendungsbereich der Norm ist bei einer Ungleichbehandlung in Abhängigkeit von der Behinderung des Grundrechtsinhabers eröffnet, die zu einem Nachteil für den Behinderten führt (Jarass/Pieroth, GG, 10. Aufl. 2009, Art. 3 Rn. 144 f m.w.N.). Ein solcher Nachteil liegt in Regelungen und Maßnahmen, die die Situation des behinderten Menschen wegen seiner Behinderung verschlechtern, indem ihnen Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten vorenthalten werden, welche anderen offen stehen (BVerfGE 96, 288 ; 99, 341 ). Angesichts dieses personalen Schutzbereichs ist eine Grundrechtsbetroffenheit des selbst nicht behinderten Beschwerdeführers fernliegend. Auch knüpft der Tatbestand des § 55 Abs. 3 SGB XI nicht an eine Behinderung, sondern an das Merkmal der Kinderlosigkeit ohne Rücksicht auf deren Gründe an. Soweit der Beschwerdeführer hinsichtlich des Gleichheitssatzes auf seine Ehefrau Bezug nimmt, wäre er nicht in eigenen Grundrechten betroffen; seine Ehefrau ist überdies in der sozialen Pflegeversicherung beitragsfrei mitversichert und damit von § 55 Abs. 3 SGB XI gar nicht betroffen.
Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes des Art. 3 Abs. 1 GG rügt, fehlt es in weiten Teilen bereits an der Darlegung der Selbstbetroffenheit. Die Verfassungsbeschwerde ist ein Rechtsbehelf zur Verteidigung eigener subjektiver Rechte. Sie ist unzulässig, wenn sie auch im Fall des Obsiegens nur zu einer Veränderung der Rechtslage zum Nachteil anderer führen kann (vgl. BVerfGE 49, 1 ). Hieran scheitert die Rüge des kinderlosen Beschwerdeführers, es sei verfassungswidrig, wenn Versicherte mit einem Kind und solche mit mehreren Kindern gleich behandelt würden. Gleiches gilt für den Vortrag, es sei willkürlich, die vor dem 1. Januar 1940 geborenen Personen von der Beitragspflicht auszunehmen (§ 55 Abs. 3 Satz 7 SGB XI), ohne dass der 1968 geborene Beschwerdeführer darlegt, welche für ihn günstigere Rechtsfolge sich hieraus ergeben würde. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass der Gesetzgeber die Benachteiligung der beitragspflichtigen Versicherten mit Kindern gegenüber kinderlosen Versicherten solange vernachlässigen konnte, wie eine deutliche Mehrheit der Versicherten Erziehungsleistungen erbracht hat (vgl. BVerfGE 103, 242 ). In der Gesetzesbegründung zum KiBG wird hieran anknüpfend der Stichtag 1. Januar 1940 damit begründet, dass die davor geborenen Versicherten noch überwiegend Kinder geboren und erzogen hätten und das Ausgleichserfordernis erst durch die – von der älteren Generation nicht mehr zu verantwortende – Entwicklung der Kinderzahlen ab Mitte der sechziger Jahre entstanden sei (vgl. BTDrucks 15/3671, S. 6). Mit dieser Erwägung setzt sich der Beschwerdeführer mit keinem Wort auseinander.
Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, § 55 Abs. 3 SGB XI sei verfassungswidrig, weil es danach ausschließlich auf die Elterneigenschaft und nicht auf tatsächlich erbrachte Erziehungsleistungen ankomme, die Beitragsbegünstigung also etwa auch im Fall des Todes des Kindes kurz nach der Geburt erhalten bleibe, fehlt jede Auseinandersetzung mit der Frage, weshalb der Gesetzgeber trotz des vom Bundesverfassungsgerichts betonten großen Spielraums bei der Ausgestaltung eines Art. 3 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 GG entsprechenden Beitragsrechts in der sozialen Pflegeversicherung (vgl. BVerfGE 103, 242 ) mit der angegriffenen Regelung die Grenzen zulässiger Typisierung überschritten haben soll.“
Diesen Ausführungen kann sich der Senat nur anschließen.
Die Berufung bleibt daher ohne Erfolg.“
Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise für das vorliegende Verfahren, das sich von den zugrunde zu legenden Tatsachen nicht entscheidend von dem damals vom Senat entschiedenen Verfahren unterscheidet. Insofern macht sich der Senat die zitierten Ausführungen auch für dieses Verfahren in vollem Umfang zu eigen.
Sofern der Bevollmächtigte der Klägerin im vorliegenden Verfahren verstärkt auf die Behinderteneigenschaft der Klägerin abstellt und daraus eine Befreiung vom Beitragszuschlag für Kinderlose ableiten möchte, weist der Senat nochmals auf den Nichtannahmebeschluss des BVerfG vom 02.09.2009, 1 BvR 1997/08, hin, in dem das BVerfG zu diesem Gesichtspunkt Folgendes ausgeführt hat:
„Auch knüpft der Tatbestand des § 55 Abs. 3 SGB XI nicht an eine Behinderung, sondern an das Merkmal der Kinderlosigkeit ohne Rücksicht auf deren Gründe an.“
An der Richtigkeit der vorstehend zitierten Entscheidung des Senats bestehen nicht die geringsten Zweifel. Die dagegen zum BSG erhobene Nichtzulassungsbeschwerde des Bevollmächtigten ist erfolglos geblieben, wobei das BSG im Rahmen der Gründe zu erkennen gegeben hat, dass es in der dort vom Bevollmächtigten aufgeworfenen Frage, „ob § 55 Absatz 3 SGB Xl, indem die Kinderlosigkeit auf einer Behinderung beruht, gegen Verfassungsrecht nach Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 iVm. 3 Absatz 1, 8 Absatz 1, 20 Absatz 1 und 3 GG verstößt“, keinen Anlass für einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und 3 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 3 GG gesehen hat. Dieser Bewertung kann sich der Senat nur anschließen. Die Zielsetzung des Bevollmächtigten der Klägerin, nämlich eine Befreiung aufgrund biologischer Gründe ungewollt Kinderloser vom Beitragszuschlag, wäre unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht zu rechtfertigen:
* Eine – mit Blick auf den Beitragszuschlag erfolgte – Gleichstellung behinderungsbedingt ungewollt Kinderloser mit Eltern, wie dies der Bevollmächtigte der Klägerin anstrebt, würde vielmehr eine Ungleichbehandlung darstellen, da damit erstere, die keinen generativen Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung leisten, mit Eltern, gegebenenfalls sogar mit Behinderung, gleichgestellt würden, die einen solchen Beitrag leisten. Warum das Vorliegen einer Behinderung der Erbringung des für die soziale Pflegeversicherung relevanten und durch die Elterneigenschaft begründeten generativen Beitrags, der vom Beitragszuschlag für Kinderlose befreit, gleichgestellt werden sollte, lässt sich nicht begründen; mit der Behinderung wird keine Beitragsleistung in irgendeiner Weise zur sozialen Pflegeversicherung erbracht.
* Konsequenz der klägerischen Forderung wäre, dass Kinderlose mit Behinderung mit Eltern mit Behinderung gleichgestellt würden, obwohl letztere, anders als erstere, einen generativen Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung leisten. Auch dies würde eine nicht zu begründende Ungleichbehandlung darstellen, zumal die Befreiung vom Beitragszuschlag ohne jeden Zweifel kein Instrument zum Ausgleich behinderungsbedingte Nachteile ist und der Beitragszuschlag kein behinderungsbedingter Nachteil ist.
* Schließlich ist auch für eine Gleichstellung ungewollt Kinderloser mit Behinderung mit Beziehern von Arbeitslosengeld II, die gemäß § 55 Abs. 3 Satz 7 SGB XI vom Beitragszuschlag befreit sind, kein Raum. Grund für die Befreiung der Bezieher von Arbeitslosengeld II vom Beitragszuschlag ist für den Gesetzgeber die Schonung des Existenzminimums gewesen (vgl. Bundestags-Drs. 15/3837, S. 7: „Es wird klargestellt, dass keine Zuschlagspflicht für kinderlose Bezieher von Alg II besteht (Schonung des Existenzminimums).“), worauf der Bevollmächtigte selbst hingewiesen hat. Dieser Grund ist bei ungewollter Kinderlosigkeit nicht einschlägig, sodass eine Befreiung ungewollt Kinderloser vom Beitragszuschlag unter diesem Gesichtspunkt eine Ungleichbehandlung darstellen würde.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.
Der Senat hat der Klägerin gemäß § 192 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG im Weg der Ausübung seines Ermessens Missbrauchskosten in Höhe von 750,- € auferlegt.
Nach § 192 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG kann das Gericht im Urteil bzw. Beschluss einem Beteiligten die Kosten auferlegen, die dadurch verursacht werden, dass der Beteiligte den Rechtsstreit fortführt, obwohl ihm vom Gericht die Missbräuchlichkeit der Rechtsverfolgung dargelegt und er auf die Möglichkeit der Kostenauferlegung bei Fortführung des Rechtsstreits hingewiesen worden ist.
Eine missbräuchliche Rechtsverfolgung ist dann anzunehmen, wenn die Weiterführung des Rechtsstreits von jedem Einsichtigen als völlig aussichtslos angesehen werden muss (vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 23.02.2016, 2 BvR 63/16, 2 BvR 60/16) und der Beteiligte entgegen seiner besseren Einsicht von der weiteren Rechtsverfolgung nicht Abstand nimmt (vgl. BSG, Urteil vom 19.06.1961, 3 RK 67/60). Es ist also ein ungewöhnlich hohes Maß an Uneinsichtigkeit (vgl. BSG, Urteil vom 12.03.1981, 11 RA 30/80) zu verlangen, wobei sich ein Beteiligter die Uneinsichtigkeit seines Anwalts zurechnen lassen muss (vgl. BSG, Urteil vom 20.10.1967, 10 RV 102/67).
Die Darlegung der Missbräuchlichkeit und der Hinweis auf die Möglichkeit der Kostenauferlegung kann in einem Gerichtstermin (mündliche Verhandlung oder Erörterungstermin) oder „auch in einer gerichtlichen Verfügung“ (vgl. Bundestags-Drucksache 16/7761, S. 23), also – wie hier am 12.09.2018, 15.01.2019 und 05.02.2019 – in einem gerichtlichen Schreiben an den Beteiligten erfolgen (ständige Rspr., vgl. z.B. Bayer. LSG, Urteile vom 27.03.2014, L 15 VK 17/13, und vom 05.07.2016, L 15 VG 33/14).
Die aufgezeigten Voraussetzungen für die Verhängung von Missbrauchskosten sind vorliegend erfüllt. Der Ehemann der Klägerin, der gleichzeitig ihr Prozessbevollmächtigter ist, hat mit genau derselben Zielsetzung und der gleichen Begründung bereits erfolglos ein Klageverfahren bis hin zum BSG betrieben, wobei ihm zuletzt mit der Verwerfung der Nichtzulassungsbeschwerde die Unerreichbarkeit seines Begehrens aufgezeigt worden ist. Gleichwohl hat der (Ehemann und) Bevollmächtigte der Klägerin auch in diesem Verfahren wieder auf dem klägerischen Begehren beharrt. Dass er trotz der negativen Erfahrungen in seinem eigenen Verfahren, die ihm im aktuellen Verfahren vom Senat wiederholt aufgezeigt worden sind, in jetzigen Verfahren weiter auf seinem Begehren beharrt, belegt ein ungewöhnlich hohes Maß an Uneinsichtigkeit des Bevollmächtigten, das sich die Klägerin zurechnen lassen muss.
Die Höhe der zu verhängenden Kosten hat der Senat durch Schätzung des ansonsten vom Steuerzahler zu tragenden Kostenaufwands für die Fortführung des Berufungsverfahrens ermittelt. Dabei ist berücksichtigt, dass § 192 SGG eine Schadensersatzregelung darstellt (vgl. Schmidt, in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/ders., SGG, 12. Aufl. 2017, § 192 Rdnrn. 1 a und 12 – m.w.N.), die unter den in § 192 SGG genannten Voraussetzungen das Privileg der Kostenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens teilweise entfallen lässt. Als verursachter Kostenbetrag gilt dabei mindestens der Betrag nach § 184 Abs. 2 SGG für die jeweilige Instanz, also für das Verfahren vor dem LSG 225,- €. Im Übrigen können die anfallenden Gerichtskosten gemäß § 202 Satz 1 SGG i.V.m. § 287 Zivilprozessordnung geschätzt werden. Dabei sind neben den bei der Abfassung des Urteils bzw. Beschlusses entstehenden Kosten sämtlicher Richter und Gerichtsbediensteten auch die allgemeinen Gerichtshaltungskosten zu berücksichtigen (vgl. Schmidt, a.a.O., § 192, Rdnr. 14).
Gemäß § 192 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG können die Kosten auferlegt werden, die durch die Fortführung des Rechtsstreits verursacht sind. Davon umfasst sind die Kosten, die ab dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem dem Beteiligten die Missbräuchlichkeit der Rechtsverfolgung dargelegt und er auf die Möglichkeit der Kostenauferlegung bei Fortführung des Rechtsstreits hingewiesen worden ist. Unter Berücksichtigung zum einen der Tatsache, dass bereits im Jahr 1973 die Kosten einer Richterstunde auf etwa 194,- DM geschätzt worden sind (vgl. Franzen, Was kostet eine Richterstunde, NJW 1974, S. 784) bzw. im Jahr 1986 von Kosten von 350,- bis 450,- DM ausgegangen worden ist (vgl. Goedelt, Mutwillen und Mutwillenskosten, SGb 1986, S. 493, 500), und zum anderen der seitdem bis heute stattgefundenen allgemeinen Kostensteigerung liegen im vorliegenden Verfahren Missbrauchskosten in Höhe von 750,- € auch bei Berücksichtigung des Umstands, dass der Bevollmächtigte bereits im eigenen Namen ein weitgehend identisches Verfahren vor dem Senat betrieben hat, jedenfalls unter dem, was tatsächlich an weiteren Kosten durch die Abfassung dieses Beschlusses entstanden ist. So sind in den letzten Jahren andere Landessozialgerichte regelmäßig von Missbrauchskosten in Höhe von 1.000,- € ausgegangen und haben dabei darauf hingewiesen, dass die auferlegten Kosten deutlich unter den Kosten, die durch die Weiterführung des Rechtsstreits tatsächlich entstanden seien, lägen (vgl. z.B. LSG Nordrhein-Westfalen, Urteile vom 07.11.2011, L 3 R 254/11, und vom 21.01.2014, L 2 AS 975/13; LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 10.10.2011, L 13 R 2150/10).
Mit den hier auferlegten Kosten in Höhe von 750,- € hat der Senat berücksichtigt, dass die Beendigung dieses Verfahrens durch einen Beschluss erfolgt ist und daher der Bearbeitungsaufwand im vorliegenden Verfahren möglicherweise geringer war, als er in den oben angeführten Verfahren, sofern diese durch Urteil entschieden worden sind, war. Ebenso hat der Senat dem Umstand Rechnung getragen, dass der Bevollmächtigte vor dem Senat bereits ein in weiten Teilen identisches Verfahren geführt hat, was den Arbeitsaufwand des Senats bei der Abfassung des Beschlusses verringert hat. Im Rahmen des Ermessens und angesichts der eklatanten Missbräuchlichkeit des klägerischen Vorgehens sieht der Senat aber keine Möglichkeit, im Rahmen seines Ermessens niedrigere Kosten als 750,- € aufzuerlegen oder gar auf den gesetzlichen Mindestbetrag für die Missbrauchskosten zurückzugreifen. Denn es ist auch zu berücksichtigen, dass durch solche Verfahren wie hier, denen offenkundig jegliche Erfolgsaussichten fehlen, und durch den mit der Abfassung der Entscheidung entstandenen Zeitaufwand Verfahren verzögert werden, in denen die Beteiligten – anders als die Klägerin hier – ein berechtigtes Interesse an einer möglichst bald zu ergehenden Entscheidung des Gerichts haben.
Ein Grund für die Zulassung der Revision liegt nicht vor (§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGG).