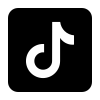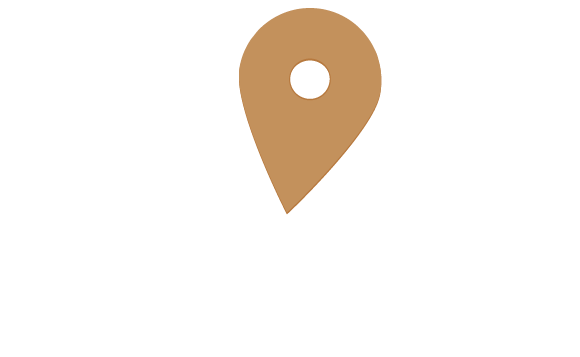Aktenzeichen 19 ZB 20.65
Leitsatz
Verfahrensgang
AN 5 K 19.1841 2019-11-27 Urt VGANSBACH VG Ansbach
Tenor
I. Das Verfahren betreffend das Begehren nach einer Verkürzung der Ausweisungswirkungen von sieben Jahren auf fünf Jahre wird abgetrennt und unter dem Az. 19 ZB 21.1377 fortgeführt.
II. Der Antrag auf Zulassung der Berufung hinsichtlich des verbleibenden Verfahrensteils wird abgelehnt.
III. Die Kostenentscheidung und die Streitwertfestsetzung bleiben der abschließenden Entscheidung im Verfahren 19 ZB 21.1377 vorbehalten.
Gründe
Der am … April 1989 geborene, am 5. September 1999 in das Bundesgebiet als jüdischer Zuwanderer eingereiste Kläger, russischer Staatsangehöriger, begehrt die Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 27. November 2019, durch das seine Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 21. Oktober 2016 abgewiesen worden ist. Durch diesen Bescheid ist er aus dem Bundesgebiet ausgewiesen (Ziff. I), ist das mit der Ausweisung verbundene Verbot zur Einreise und zum Aufenthalt im Bundesgebiet auf sieben Jahre befristet (Ziff. III), die Abschiebung aus der Haft heraus in die Russische Föderation oder einen anderen aufnahmebereiten Staat angeordnet (Ziff. IV) und er für den Fall, dass eine Abschiebung aus der Haft heraus nicht möglich sein sollte, unter Androhung der Abschiebung aufgefordert worden, das Bundesgebiet unter Fristsetzung zu verlassen, andernfalls er in die Russische Konföderation oder in einen anderen aufnahmebereiten Staat abgeschoben werde (Ziff. V).
Gegenstand des Verfahrens ist hinsichtlich der (für den Fall der Aufrechterhaltung der Ausweisung bedeutsamen) Befristung der Wirkungen des § 11 Abs. 1 AufenthG nur noch das sinngemäß vorgetragene Begehren nach einer Verkürzung der Befristung von fünf Jahren auf den „Jetzt-Zeitpunkt“, denn die Beklagte hat auf Anregung des Senats mit Schriftsatz vom 12. Mai 2021 den streitgegenständlichen Bescheid dahingehend abgeändert (zudem ihre Ermessensausübung erneuert), dass die Ausweisungswirkungen auf die Dauer von fünf Jahren ab Ausreise/Abschiebung befristet werden, weshalb der Senat den durch die Teilabhilfe betroffenen Verfahrensteil durch Nr. I dieses Beschlusses abtrennt.
Der auf die Zulassungsgründe des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO (ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils), des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO (besondere tatsächliche und rechtliche Schwierigkeiten der Rechtssache), des § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO (grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache), des § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO (auf einer Abweichung von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts beruhendes Urteil) und des § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO (Geltendmachung und Vorliegen eines Verfahrensmangels, auf dem die Entscheidung beruhen kann) gestützte Antrag bleibt ohne Erfolg.
Das der rechtlichen Überprüfung durch den Senat ausschließlich unterliegende Vorbringen in der Begründung des Zulassungsantrags (§ 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO) rechtfertigt keine Zulassung der Berufung. Die geltend gemachten Zulassungsgründe, deren Beurteilung sich grundsätzlich nach dem Zeitpunkt der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts richtet (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 15.1.2013 – 1 C 10.12 – juris Rn. 12), sodass eine nachträgliche Änderung der Sach- und Rechtslage bis zum Zeitpunkt der Entscheidung in dem durch die Darlegung des Rechtsmittelführers vorgegebenen Prüfungsrahmen zu berücksichtigen ist (BayVGH, B.v. 20.2.2017 – 10 ZB 15.1804 – juris Rn. 7), liegen nicht vor.
1. Die Berufung ist nicht aufgrund ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des erstinstanzlichen Urteils zuzulassen (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO).
Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestünden nur dann, wenn die Klägerseite im Zulassungsverfahren einen einzelnen tragenden Rechtssatz oder eine einzelne erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt hätte (BVerfG, B.v. 10.9.2009 – 1 BvR 814/09 – juris Rn. 11; B.v. 9.6.2016 – 1 BvR 2453/12 – juris Rn. 16). Solche schlüssigen Gegenargumente liegen bereits dann vor, wenn im Zulassungsverfahren substantiiert rechtliche oder tatsächliche Umstände aufgezeigt werden, aus denen sich die gesicherte Möglichkeit ergibt, dass die erstinstanzliche Entscheidung unrichtig ist (BVerfG, B.v. 20.12.2010 – 1 BvR 2011/10 – juris Rn. 19). Es reicht nicht aus, wenn Zweifel lediglich an der Richtigkeit einzelner Rechtssätze oder tatsächlicher Feststellungen bestehen, auf welche das Urteil gestützt ist. Diese müssen vielmehr sogleich Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses begründen. Das wird zwar regelmäßig der Fall sein. Jedoch schlagen Zweifel an der Richtigkeit einzelner Begründungselemente nicht auf das Ergebnis durch, wenn das angefochtene Urteil sich aus anderen Gründen als richtig darstellt (BVerwG, B.v. 10.3.2004 – 7 AV 4/03 – juris Rn. 9).
Der Kläger rügt, dass es bereits an dem Tatbestandsmerkmal der Wiederholungsgefahr fehle. Es sei insoweit schon nicht klar, ob das Verwaltungsgericht überhaupt die Tatbestandsvoraussetzungen der Wiederholungsgefahr als Prüfungsmaßstab annehme. Voraussetzung für eine Ausweisung sei die Abwehr einer konkreten Polizeigefahr im Sinne einer Wiederholungsgefahr. Diese liege beim Kläger nicht vor. Ein Schadenseintritt für ein geschütztes Rechtsgut sei nicht hinreichend wahrscheinlich. Der Kläger sei bislang nicht zweimal verurteilt worden. Das ersterwähnte Strafverfahren habe nämlich nicht mit einem Urteil, sondern mit einem Strafbefehl ohne vorausgegangene Hauptverhandlung geendet. Der Kläger habe sich zum Zeitpunkt der Verurteilung durch das Amtsgericht erstmals vor Gericht im Alter von ca. 27 Jahren befunden. Die Darstellung, der Kläger habe die Ausbildung ohne Abschluss verlassen sei irreführend. Richtig sei vielmehr, dass er an der Abschlussprüfung teilgenommen, diese aber nicht bestanden habe. Der Kläger sei überwiegend arbeitstätig gewesen, wirtschaftlich sei er integriert. Er übe mittlerweile eine unbefristete Vollzeitstelle aus. Das Verwaltungsgericht habe nicht berücksichtigt, dass der Kläger bereits während des Maßregelvollzugs Arbeit gefunden habe. Das Urteil sei unvollständig, wenn nur auf die aktuelle Beschäftigung abgestellt werde. Der Kläger sei seit dem 1. August 2017 in Außenarbeit gewesen, seit dem 23. Juli 2018 bei der Firma F. beschäftigt gewesen. Aus dem Lebenslauf (mit Beschäftigungszeiten) abzuleiten, der Kläger sei nicht wirtschaftlich integriert, sei eine unzulässige Wertung. Der Kläger habe einen Schulabschluss erworben und zudem im Anschluss eine Ausbildung – wenn auch ohne Abschluss – bis zur Prüfung besucht. Das Urteil des Verwaltungsgerichts sei durch den vollständigen Verweis auf die vorangegangene Entscheidung (Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 16.6.2017) auch in sich widersprüchlich. Daher sei die Gefahrenprognose nicht haltbar, die Abwägungsentscheidung unvollständig. Für die Gefahrenprognose wäre nämlich wesentlich zu berücksichtigen gewesen, dass sich der Kläger ganz überwiegend in Beschäftigung befunden habe und kein Zweifel daran bestehe, dass er auch weiterhin erwerbstätig sein werde. Das Verwaltungsgericht habe auch nicht berücksichtigt, dass das dem Strafurteil vom 24. April 2016 zugrundeliegende Verhalten nicht etwa einer dauerhaft negativen Einstellung gegenüber der deutschen Rechtsordnung entspringe, sondern offenkundig auf einer erst seit kurzer Zeit vor der Tat bestehenden Episode in seinem Verhalten, von der nach Auffassung des Sachverständigen alles dafürgesprochen habe, dass diese im Zusammenhang mit dem behandlungsbedürftigen, aber eben auch -fähigen Betäubungsmittelkonsum gestanden sei. Das Verwaltungsgericht habe keinerlei eigenständige Aufklärung vorgenommen, die die Feststellung erlauben würde, dass der Kläger eine hiervon unabhängige Persönlichkeitsentwicklung genommen hätte, die eine regelmäßige Strafbarkeit erwarten lassen würde. Fehlerhaft bewertet sei es auch, wenn ausgeführt werde, der Kläger habe seinen Betäubungsmittelkonsum bagatellisiert. Die Einsicht in die eigene Abhängigkeit als wesentlicher Erkenntnisprozess zum Überwinden der Abhängigkeit sei dem Kläger gelungen. Auch sei die pauschale Verallgemeinerung (von der Beklagten behauptet, vom Verwaltungsgericht übernommen), der Kläger werde künftig Straftaten begehen, weil er in der Vergangenheit Straftaten begangen habe, unzulässig. Es handle sich hierbei um keine Prognose, da derartige Pauschalierungen keine zulässige Prognosemethode darstellen würden. Anders als das Verwaltungsgericht behaupte, obliege es den Strafvollstreckungsorganen des Weiteren sehr wohl, die Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit zu berücksichtigen. Die Prognose der Strafvollstreckungskammer sei nicht zeitlich befristet und selbstredend nicht auf den Zeitraum der Bewährungszeit beschränkt. Sowohl die Beklagte als auch das Verwaltungsgericht würden die Rechtslage hinsichtlich der Voraussetzung für eine Reststrafenaussetzung verkennen. Die Aussetzungsentscheidung verlange nämlich im Fall des Klägers die Einholung eines Gutachtens gemäß § 454 Abs. 2 Nr. 2 StPO. Die Darstellung, dass die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer auf spekulativen Resozialisierungsgedanken beruhen würde, sei grundlegend falsch. Der Gesetzgeber habe vielmehr durch § 454 StPO dem Sicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit Vorrang eingeräumt. Nicht nachvollziehbar seien die Ausführungen des Verwaltungsgerichts hinsichtlich des Grades der Anforderung an die Wiederholungsgefahr bei Gewaltdelikten. Es werde auch betreffend den Kläger hier verkannt, dass der Grad der Anforderung aufgrund der beabsichtigten Ausweisung besonders hoch sei. Der Kläger sei mit seiner ganzen Familie in das Bundesgebiet eingereist, habe in Deutschland die Schule besucht, habe eine Lebensgefährtin, habe eine Ausbildung in Deutschland bis zur Prüfung besucht, verfüge über keinerlei Bindung in das Land der Staatsangehörigkeit. Es liege ein besonders schwerwiegender Eingriff in Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 8 EMRK vor. Rechtsfehlerhaft sei auch, wenn das Verwaltungsgericht darauf abstelle, dass die Strafvollstreckungskammer die „Maximal“-Dauer der Führungsaufsicht festgesetzt habe. Die Anordnung der Führungsaufsicht sei gesetzlich vorgeschrieben, § 67d Abs. 5 StGB. Sie setze keine individuelle Prognoseentscheidung voraus. Dies gelte auch für die Dauer. Dass die Strafvollstreckungskammer die Zeit der Führungsaufsicht nicht abgekürzt habe, stelle weder eine Fristsetzung dar noch beinhalte es ein Ausschöpfen einer maximalen Dauer. Es handle sich um eine Entscheidung dahingehend, dass die Regeldauer des § 68c StGB gelte und keine unbefristete Führungsaufsicht angeordnet werde. Sie beinhalte insoweit keine Prognoseentscheidung. Eine Abkürzung komme nur dann in Betracht, wenn sich die maximale Dauer von vorneherein als unbillig darstellen würde. Der Kläger habe im Strafvollstreckungsverfahren aber gar nicht beantragt, eine kürzere Dauer bereits in der Aussetzungsentscheidung festzusetzen. Das Verwaltungsgericht könne daher die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer nicht etwa in eine negative Prognoseentscheidung umdeuten. Entgegen der Auslegung des Verwaltungsgerichts gehe die Strafvollstreckungskammer gerade von keiner „Gefahr“ der Begehung von Straftaten aus. In dem Beschluss heiße es vielmehr, es sei nun zu erwarten, dass der Kläger keine rechtswidrigen Taten mehr begehen werde. Es sei unzulässig, wenn sich das Verwaltungsgericht mit seiner Beschlussinterpretation der ausdrücklichen Begründung des Landgerichts widersetze, um hieraus eine ungünstige Prognoseentscheidung ableiten zu können. Dieses Vorgehen führe zur Rechtsfehlerhaftigkeit der Prognoseentscheidung insgesamt. Auch habe sich die Erwartung der Strafvollstreckungskammer bestätigt. Es sei im Übrigen ständige Übung der Strafvollstreckungskammern, über eine etwaige Abkürzung der Dauer der Führungsaufsicht erst im weiteren Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu entscheiden. Es handle sich um eine Selbstverständlichkeit, dass die Bewährungsdauer nicht kürzer bestimmt werde, da ein Auseinanderlaufen zwischen Bewährungszeit und der gesetzlich bestimmten Dauer der Führungsaufsicht nicht sachgerecht wäre. Das Landgericht habe eine positive Prognose gestellt und keine Gefahr bejaht. Auch könne eine Reststrafenaussetzung ausschließlich zur Bewährung erfolgen. Die im Falle des Klägers erfolgte Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung sei keine gesetzliche Regelung und setze eine positive Prognose voraus, die die Strafvollstreckungskammer auch getroffen habe. Die Tatsache, dass die Strafvollstreckungskammern Bewährungsentscheidungen mit geeigneten Auflagen versehen, erlaube nicht, die Bewährungsentscheidung der Strafvollstreckungskammer zu relativieren. Die Weisungen stellten im Gegenteil zusätzlich Umstände dar, die gegen eine Wiederholungsgefahr sprächen. Die Bewährungsaussetzung durch das Landgericht setze eine hier auch erfolgte besondere Gefahrenprognose voraus. Das Ende des Maßregelvollzugs führe nicht etwa automatisch zu einer Reststrafenaussetzung, vielmehr ergehe die Reststrafenaussetzung trotz Erledigung des Maßregelvollzugs nur dann, wenn die besondere Prognoseentscheidung hinsichtlich § 57 StGB günstig sei. Diese liege im Form des Beschlusses der Strafvollstreckungskammer vor. Es sei auch unzutreffend, wenn das Verwaltungsgericht andeute, dass im Verwaltungsverfahren ein anderer Prognosehorizont gelte, da dieser nicht auf die Bewährungszeit beschränkt sei. Auch im Strafvollstreckungsverfahren gelte kein Prognosehorizont, der auf die Dauer der Bewährungszeit beschränkt wäre. Das Gesetz sehe (vielmehr) vor, dass nach Verbüßung der gesetzlich vorgegebenen Mindestdauer der noch zu vollstreckende Teil der Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden könne, wenn dies unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit verantwortet werden könne, § 57 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Zusätzlich sei das „Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts“ als Prognosekriterium eingefügt worden, § 57 Abs. 1 Satz 2 StGB. Die Rechtslage beruhe auf einer Gesetzesänderung 1998. Eingeführt worden sei zudem eine erhebliche Ausweitung der Fälle, in denen gemäß § 454 Abs. 2 StPO Sachverständigengutachten zur Aufklärung der Prognosetatsachen eingeführt worden seien. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in § 454 Abs. 2 StPO sei die Aufklärungsintensität, die das Gericht vor einer Aussetzungsentscheidung vornehmen müsse, deutlich erhöht worden. Die prozeduralen Anforderungen an die Prognoseentscheidung gemäß § 57 Abs. 1 StGB seien nicht etwa niedriger als im Rahmen des § 56 StGB. Eine dem § 454 Abs. 2 StPO vergleichbare Vorschrift gebe es zu § 56 StGB nicht. Das Bundesverfassungsgericht (B.v. 11.1.2016 – 2 BvR 2961/12, 2 BvR 2484/13 – juris Rn. 34) habe eine Auslegung des § 57 Abs. 1 StGB dahingehend, dass „eine Entlassung (…) aufgrund des bei einem möglichen Rückfall bedrohten Rechtsguts nur in Betracht kommt, wenn eine künftige Straffreiheit aufgrund eindeutiger positiver Umstände erwartet werden kann“ und es hierfür einer „tragfähigen Grundlage für die Erwartung künftiger Straffreiheit“ bedürfe, ausdrücklich gebilligt. Eine solche Auslegung sei dem Wortlaut des § 56 Abs. 1 StGB vergleichbar. Es liege in der Natur der Sache, dass insoweit die Prognose im Rahmen von § 57 StGB von § 56 StGB abweiche. Die Prognose des § 57 StGB sei kein „weniger“ gegenüber der Prognose nach § 56 StGB. Während die Prognose nach § 56 StGB die Erwartung künftiger Straffreiheit aufgrund der Verurteilung verlange, setze die Prognose nach § 57 StGB mit der Verantwortbarkeitsklausel eine Bewertung in Bezug auf das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit voraus. Es treffe nicht zu, wenn teilweise generalisierend behauptet werde (so BayVGH, B.v. 2.5.2017 – 19 CS 16.2466 Rn. 10), die Prognose weiche von § 56 StGB insoweit ab, als eine Erwartung künftiger Straffreiheit nicht verlangt werde. Der Maßstab sei (vielmehr) variabel. Je höherwertige Rechtsgüter in Gefahr seien, desto geringer müsse das Rückfallrisiko sein. Es gebe keinen Maßstab, wonach jede Chance ausreiche, um die Bewährungsaussetzung zu verantworten. Vielmehr müsse stets der Bezug zu den Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit im Auge behalten werden. Hinzu trete, dass der Aufklärungsumfang der Strafvollstreckungskammer in der Regel wesentlich breiter sei als der des Strafrichters im Rahmen der Entscheidung nach § 56 StGB. Richtig sei, dass eine Unterschiedlichkeit der Zwecksetzung der Bewährung nach § 56 und nach § 57 StGB nicht bestehe, maßgeblich sei jeweils eine günstige Kriminalprognose. Dass der Entscheidung nach § 57 StGB per se weniger Gewicht zukomme als einer Entscheidung nach § 56 StGB sei weder aus dem Gesetzeswortlaut, (noch aus) der Gesetzesbegründung, (noch aus) der Gesetzesanwendung herzuleiten. Ein stattgebender Beschluss gemäß § 57 StGB unterliege auch keinem Automatismus. Die Entlassungsquote nach § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB sei bezogen auf das Jahr 2014 bei etwa 20% gelegen. Die Strafvollstreckungskammer habe hier zwei positive Prognoseentscheidungen getroffen. Der Gesamtverlauf der Therapie sei positiv gewesen, die Annahme des Verwaltungsgerichts, der Therapieverlauf sei nicht uneingeschränkt positiv gewesen, treffe nicht zu. Das Landgericht habe eine kritische Prüfung aller Umstände vorgenommen. Verkannt werde vom Verwaltungsgericht zudem, dass nicht eine positive Sicherheitsprognose zu stellen sei, sondern der Beweis einer negativen Prognose erbracht werden müsse. Das Bestehen einer hinreichenden Gefahr müsse positiv festgestellt werden. Im Hinblick darauf, dass das Landgericht nach Beratung durch einen Gerichtssachverständigen und unter Berücksichtigung des Therapieberichts von einer „hohen Wahrscheinlichkeit der Straffreiheit“ ausgehe und erwarte, dass der Kläger keine rechtswidrigen Taten mehr begehen werde, sei für das Bejahen einer Wiederholungsgefahr kein Raum. Das Bundesverfassungsgericht habe im Anschluss an seinen Beschluss vom 19. Oktober 2016 (2 BvR 1943/16) mit Beschluss vom 8. Mai 2019 (2 BvR 657/19) deutlich gemacht, dass es sich der in der Verwaltungsgerichtsbarkeit vorgebrachten einschränkenden Berücksichtigung strafrechtlicher bzw. strafvollstreckungsrechtlicher Prognoseentscheidungen im Hinblick auf die Eingriffstiefe in Art. 2 Abs. 1 GG nicht anschließt. Gegenstand des Verfassungsbeschwerdeverfahrens sei eine nach der erstinstanzlichen Ausweisungsentscheidung des Verwaltungsgerichts ergangene strafvollstreckungsrechtliche Entscheidung gemäß § 36 BtMG, die sich substanziell nicht von der Entscheidung des § 57 StGB unterscheide. Das Bundesverfassungsgericht habe zum wiederholten Male betont, dass Strafvollstreckungsentscheidungen eine erhebliche indizielle Bedeutung zukomme und jedenfalls dann, wenn die Prognose der Wiederholungsgefahr Bedeutung im Rahmen einer grundrechtlich erforderlichen Abwägung habe, es einer substantiierten Begründung, wenn von der strafgerichtlichen Einschätzung abgewichen werden solle, bedürfe. Eine solche substantiierte Begründung könne das Verwaltungsgericht im Falle des Klägers nicht vorbringen. Die erfahrene Strafvollstreckungskammer habe auf der breitest möglichen Entscheidungsgrundlage entschieden, ein Abweichen von dieser Entscheidung komme nicht in Betracht. Das Landgericht habe zudem auf das Gutachten des Sachverständigen Dr. S. und die Stellungnahme des Chefarztes Dr. N. (Bezirksklinikum A.) ausdrücklich Bezug genommen. Das Landgericht habe ausdrücklich auch die Schwere der Anlasstaten gewürdigt und gewichtet und den Vollzug der weiteren Vollstreckung ausgesetzt. Der Kläger verfüge über eine Niederlassungserlaubnis, lebe seit 20 Jahren im Bundesgebiet, habe eine Lebensgefährtin und sei in Vollzeit beschäftigt. Es sei die Kernaussage des Bundesverfassungsgerichts, dass durch die (hier hohe) Intensität des Grundrechtseingriffs die Anforderungen an die Feststellung der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts steigen würden. Diese Anforderungen seien im Falle des Klägers in einem Maße erhöht, dass die von der Beklagten angenommene Umkehr in Richtung einer Indizierung der Gefahr bei vormaligen Straftaten im Kontext mit einer Suchtmittelabhängigkeit die Ausweisungsverfügung nicht trage. Dies folge aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 GG sowie Art. 8 EMRK. Dem Verwaltungsgericht gelinge es nicht darzulegen, wie es von der Prognose des Landgerichts abweichen könne. Das Verwaltungsgericht habe es abgelehnt, den sachverständigen Zeugen S. (Freund des Klägers) zu vernehmen. Es habe es auch abgelehnt ein Gefährlichkeitsgutachten einzuholen. Das Verwaltungsgericht stütze sich lediglich darauf, dass trotz des Strafaussetzungsbeschlusses des Landgerichts „aufgrund des erheblichen Legalbewährungsdrucks, nämlich, dass ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen den Widerruf der Bewährung zur Folge hätte, und der kurzen Zeit nach Beendigung des Maßregelvollzugs auch gegenwärtig von einer erheblichen Wiederholungsgefahr auszugehen“ sei. Gerade eine derartige Begründung, dass die Beendigung des Maßregelvollzugs erst „kurze Zeit“ zurückliege, habe das Bundesverfassungsgericht nicht als relevantes Abweichungskriterium betrachtet. Es sei auch schon gar nicht erkennbar, was das Verwaltungsgericht unter „kurz“ überhaupt verstehe. Der Kläger habe sich nicht erst seit dem Beschluss der Strafvollstreckungskammer bewährt und erprobt, sondern seit über vier Jahren keine Straftat begangen und sich klar und deutlich von jeglichem Suchtmittelkonsum distanziert. Die fachliche Beurteilung des Bezirksklinikums vom 26. Juni 2018 habe das Verwaltungsgericht auch nicht berücksichtigt. Es sei auch in sich widersprüchlich, dass ein Legalbewährungsdruck und der drohende Widerruf der Bewährung eine gegenwärtige Gefahr begründen könnten. Das Gegenteil sei der Fall. Es sei nichts dafür ersichtlich, dass nach Wegfall eines Legalbewährungsdrucks eine Gefahr bestehen sollte (wenn das Verwaltungsgericht dies möglicherweise so gemeint haben sollte). Dafür bestünden keine konkreten Anhaltspunkte. Derartige Erwägungen wären bloße Mutmaßungen. Voraussetzung für das Bestehen einer Wiederholungsgefahr sei aber eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die Begehung von Straftaten zu erwarten sei. Dies sei bei dem Kläger gerade nicht der Fall, da die den Ausweisungsanlass bildende strafrechtliche Verurteilung im kausalen Zusammenhang mit der Betäubungsmittelabhängigkeit gestanden sei und die Begehung neuer Straftaten im Hinblick auf die Abstinenzzeit und die klare Abstinenzentscheidung und die zusätzliche Kontrolle im Rahmen der Bewährungs- und Führungsaufsicht nicht zu erwarten sei. Es könne dem Kläger nicht gleichzeitig zum Nachteil im Ausweisungsverfahren gereichen, dass er das von ihm erwartete Verhalten im Strafvollstreckungsverfahren erfülle. Die Prognoseentscheidung sei zudem rechtsfehlerhaft, da das Verwaltungsgericht wie die Beklagte kein eigenes Gefährlichkeitsgutachten eingeholt habe. Dass dieses einzuholen gewesen wäre, folgt (wenn man eine Wiederholungsgefahr überhaupt in Betracht ziehen wollte) schon daraus, dass eine psychiatrische Krankheit diagnostiziert worden sei, das Strafgericht die Voraussetzungen des § 21 StGB angenommen habe und die Krankheit zu einer vorübergehenden Veränderung im Wesen des Klägers geführt habe, was gegen eine grundlegende Gewaltgeneigtheit spreche. Eine solche ergebe sich auch nicht aus dem Vorleben des Klägers. Es lägen keinerlei Anhaltspunkte für eine grundlegende Gewaltbereitschaft vor. Eine dissoziale Persönlichkeitsstörung liege ausweislich des Sachverständigengutachtens Dr. S. nicht vor. Auch andere Persönlichkeitsstörungen lägen nicht vor. Die Ausführungen der Beklagten, wonach der Kläger eine „defizitäre Persönlichkeitsstruktur“ aufweise, stünden im diametralen Widerspruch zu den Feststellungen des Sachverständigen. Weder das Verwaltungsgericht noch die Beklagte hätten auch nur im Ansatz dargelegt, worauf sich ihre Einschätzung, die von den Feststellungen des Gutachters abweiche, stütze. Vielmehr habe der Sachverständige ausgeführt, dass die dissozialen Verhaltensweisen sich primär im Zusammenhang mit dem intensiven Metamphetamin-Konsum eingestellt hätten. Es liege auch keine antisoziale Lebenseinstellung oder fortgesetzte Impulsivität vor, wie die Beklagte meine. Unzutreffend sei auch die Darstellung, der Behandlungsverlauf sei teilweise ungünstig verlaufen. Der Therapieverlauf sei im Ergebnis in jeder Hinsicht erfolgreich. Es bestünden keine Anhaltspunkte für einen zu erwartenden Rückfall in den Betäubungsmittelkonsum. Gemäß Gutachten Dr. S. hätten bereits bei der Begutachtung am 13. November 2018 die positiven prognostischen Aspekte „deutlich“ überwogen. Aus dem Gutachten folge weiterhin, dass der Kläger sich intensiv mit seiner teils komplizierten und dramatischen Vorgeschichte, einschließlich seiner familiären Situation sowie seiner Sucht- und Delinquenzbiografie auseinandergesetzt habe. Den Zusammenhang der Persönlichkeitsentwicklung mit dem Suchtmittelkonsum habe der Kläger gemäß Gutachten „intensiv und durchaus differenziert und reflektierend“ bearbeitet. Es liege eine „glaubhafte und kritische Distanz zu früherem Handeln, Denken und Verhalten“ vor. Hinzu trete gemäß Gutachten eine Distanzierung von dem früheren Drogenumfeld. Auch „potentiell“ rückfallgefährdende Situationen und Konstellationen seien im Rahmen der Therapie und der Lockerungsstufen gemäß Gutachten erfolgreich bearbeitet worden. Die Darstellung des Verwaltungsgerichts, es würde aus der von dieser als „nicht durchweg beanstandungsfreien und positiv verlaufenen“ Behandlung ein Anknüpfungspunkt für eine bestehende Wiederholungsgefahr folgen, sei mit dem Sachverständigengutachten und der Aktenlage nicht in Einklang zu bringen. Der Sachverständige habe ausdrücklich ausgeführt, dass es sowohl im Verlauf der Therapie, aber auch „insbesondere im Rahmen der Dauerbeurlaubung … zu keinen nennenswerten Regelverstößen, keinen Lockerungsmissbräuchen und keinen Suchtmittelrückfällen“ gekommen sei und der Kläger die Therapie „erfolgreich genutzt“ habe. Der Widerspruch gegen diese klaren und eindeutigen Feststellungen des Sachverständigen durch das Verwaltungsgericht erfolge auf keiner besseren Erkenntnis als sie dem Sachverständigen bzw. der Strafvollstreckungskammer vorgelegen habe, obwohl es sich um ein medizinisches Sachverständigengutachten handle und unzweifelhaft eine Erkrankung der den Ausweisungsanlass bildenden Verurteilung zugrunde gelegen sei. Das Verwaltungsgericht habe sich selbst nicht sachverständig beraten lassen, habe Fehler in dem Gutachten nicht aufgezeigt und auch nicht erläutert. Es führe auch nicht aus, dass das Gutachten unzutreffend wäre, sondern man wolle es nur anders werten. Soweit der Sachverständige Nachsorgemaßnahmen für erforderlich gehalten habe, handle es sich nicht um eine negative Anknüpfungstatsache, die eine Wiederholungsgefahr begründen könnte. Hierzu hätte das Verwaltungsgericht Feststellungen erheben müssen, dass sich der Kläger voraussichtlich der Nachsorge entziehen würde oder diese Regeln voraussichtlich nicht befolgen würde. Hierfür sei aber keinerlei Anhaltspunkt ersichtlich, geschweige denn vorgetragen. Vielmehr liege die Begutachtung selbst bereits ca. 15 Monate zurück und die Lebensumstände des Klägers hätten sich prognostisch nicht etwa verschlechtert. Der Kläger sei wirtschaftlich und sozial integriert. Der Kläger habe insoweit auch die Einvernahme des sachverständigen Zeugen S. (Assistenzarzt in einem psychiatrischen Krankenhaus, langjähriger Freund des Klägers) beantragt zum Beweis der Tatsache, dass bei ihm keine Gefahr der Begehung von Straftaten bestehe, er keine psychische Labilität vorweise und sich ernsthaft von jeglichem Drogenkonsum und Kontakt zur Betäubungsmittelszene dauerhaft distanziert habe. Der Zeuge habe die Entwicklung des Klägers während der Therapie im Bezirkskrankenhaus fortlaufend verfolgt und miterlebt. Er habe – auch aus kritischer fachlicher Sicht – festgestellt, dass der Kläger die Entlassung aus der forensischen Abteilung in gut vorbereiteter Verfassung verbunden mit einem stabilen sozialen Umfeld habe verlassen können. Er habe weiter festgestellt, dass die Integration in das gesellschaftliche Leben dem Kläger problemlos gelungen sei. Aus seiner fachlichen Sicht bestünden gesunde Problembewältigungsstrategien, der Kläger entscheide sich bewusst, durchdacht und eindeutig. Seine Überlegungen seien dabei nach Wahrnehmung des Zeugens zukunftsorientiert und sein Denken vorausschauend. Unbeschadet der Fehlerhaftigkeit, den sachverständigen Zeugen nicht zu vernehmen, stelle die freundschaftliche Begleitung durch den sachverständigen Zeugen einen zusätzlichen günstigen Prognosefaktor dar. „Auch die zusätzliche Anregung des Klägerbevollmächtigten“ (gemeint: den Zeugen S. zu der Einstellung und Lebensgestaltung des Klägers zu vernehmen) habe das Verwaltungsgericht rechtsfehlerhaft abgelehnt. Es habe auch kein eigenes Gutachten – obwohl beantragt – eingeholt und so gegen das Gebot der Sachverhaltsaufklärung verstoßen, da es dennoch von einer bestehenden Wiederholungsgefahr und eigener Sachkunde ausgegangen sei. Die Einholung eines Gutachtens wäre aus Rechtsgründen erforderlich gewesen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts komme ein Abweichen von Bewährungsentscheidungen grundsätzlich nicht in Betracht, ohne ein eigenes Gutachten einzuholen. Der Kläger habe weiter ausgeführt, dass zudem ausschließlich günstige prognostische Umstände – bezogen auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung – vorgelegen hätten, u.a. Lebensgefährtin, die ein geordnetes Leben führe, beanstandungsfrei verlaufende Bewährung, kein Konsumieren von Betäubungsmitteln, klare und glaubhafte Distanzierung zu Betäubungsmittelkonsum und -umfeld. Er habe ergänzend auf den Therapiebericht vom 18. Oktober 2019 des Bezirksklinikums verwiesen, der den positiven Verlauf der Resozialisierungsphase und der anschließenden Erprobungsphase bestätigt habe. Das Bezirksklinikum habe die günstige Prognose hinsichtlich einer Rückfallgefahr bezüglich Betäubungsmittelkonsums befundet und bestätigt, „dass aufgrund des direkten Zusammenhangs der die Unterbringung begründenden Straftaten erwartet werden“ könne, dass außerhalb des Maßregelvollzugs keine erneuten Straftaten von dem Kläger begangen würden sowie die Drogen- und Alkoholkontrollen negativ gewesen seien. Der Kläger habe weiter vorgetragen, dass das Gericht nicht über ausreichende Sachkunde verfüge, das Fortbestehen eines manifesten Abhängigkeitssyndroms positiv festzustellen. Überdies seien die prognostischen Merkmale alle günstig. Die Untersuchung durch den Sachverständigen werde deshalb ergeben, dass aus wissenschaftlicher, kriminalprognostischer Sicht von dem Kläger keine Rückfallgefahr und auch keine sonstige Gefahr zur Begehung von Straftaten vorliege. Aufgrund der durchgeführten Therapie und im Hinblick auf die bewusste Abkehr von jeglichem Betäubungsmittelumgang sei die Begehung von Straftaten daher nicht zu erwarten. Das Verwaltungsgericht habe den Beweisantrag (Einholung eines Sachverständigengutachtens) mit der Begründung abgelehnt, dass es über eigene Sachkunde verfüge. Es habe nicht dargelegt, woher die eigene Sachkunde rühren könnte, von der Einschätzung des Sachverständigen, des Bezirkskrankenhauses oder der Strafvollstreckungskammer abzuweichen und eine „gegenwärtig“ bestehende „erhebliche“ Wiederholungsgefahr bejahen zu können. Das Verwaltungsgericht habe zudem nicht berücksichtigt, dass gegenüber dem Begutachtungszeitpunkt weitere positive Prognosefaktoren hinzugetreten seien, namentlich stabile Lebensverhältnisse, dauerhafte Abstinenz und der Bericht der Bewährungshelferin Z. vom 20. November 2019, dem nicht nur ein positiver Bewährungsverlauf zu entnehmen sei, sondern ein „selbständiger Einblick in die Lebensführung sowie Reflektion, sortiertes Handeln, Affekttoleranz und Impulskontrolle“. Eine Einschätzung als Risikoproband erfolge nicht, da die fachliche Testung der Bewährungshelferin „durchwegs positiv“ ausgefallen sei. Das Urteil enthalte keine Auseinandersetzung mit diesen Aussagen der Bewährungshelferin. Das Verwaltungsgericht sei verpflichtet gewesen, wenn es anders als das Landgericht eine ungünstige Prognose habe stellen wollen, sich einer wissenschaftlich abgesicherten Prognosemethode zu bedienen und ein Gefährlichkeitsgutachten einzuholen. Bei der Prüfung des Bestehens von Dispositionen und insbesondere des Fortbestehens von Dispositionen ende nämlich die Fachkunde der Behörde und auch die Fachkunde des Verwaltungsgerichts, obwohl entsprechende Fachkunde hinzugezogen werden könne durch kriminalprognostische Gutachten. Die Beklagte habe nicht dargelegt, woher ihre Sachkunde rühren solle, Dispositionen zu bestimmen und zu prüfen, das Verwaltungsgericht habe dies in keiner Weise geprüft und lasse jede Ausführung insoweit vermissen. Soweit es sich bei seiner Prognose darauf beschränke, aus den vorhandenen Unterlagen eine hohe Wiederholungsgefahr zu folgern, beruhe diese Feststellung ebenfalls nicht auf einer anerkannten Prognosemethode im Hinblick auf die in der Vergangenheit aus pathologischen Defiziten herrührenden Defizite. Deren Fortbestehen sei nicht ausreichend geprüft worden. Es fehle auch jegliche Graduierung, wenn ohne weiteres von einer „erheblichen“ Wiederholungsgefahr ausgegangen werde, obwohl diese von allen anderen Stellen verneint worden sei. Insgesamt sei daher festzustellen, dass die nicht eigenständig sachverständig beratene Kammer trotz des medizinischen Kausalzusammenhangs bezüglich der Anlasstaten rechtsfehlerhaft von bestehender Wiederholungsgefahr ausgegangen sei. Des Weiteren sei die Abwägungsentscheidung der Beklagten, der sich das Verwaltungsgericht vollumfänglich angeschlossen habe, nicht tragfähig. In der Abwägung sei der erfolgreiche Abschluss der Therapie, die Beendigung des Maßregelvollzugs, die lange Zeit seit der Tat, die Aufnahme von Arbeit und die Wiederherstellung der Bindungen an die Familie überhaupt nicht berücksichtigt worden. Es sei nicht einmal in Erwägung gezogen worden, dass die Maßnahmen nach der Tat – auch die Inhaftierung – Auswirkungen auf den Grad der Wahrscheinlichkeit der Begehung von Straftaten gehabt hätten. Selbst wenn man von einer Wiederholungsgefahr ausgehen würde, was – wie dargestellt – unzutreffend sei, könne nicht ernsthaft vertreten werden, dass der Grad der Wahrscheinlichkeit sich gegenüber dem Zeitpunkt bei Bescheiderlass nicht reduziert habe. Es müsse aber, das sei das Wesen einer Abwägung, die Reduzierung des Wahrscheinlichkeitsgrades in das Verhältnis zu allen anderen Umständen, insbesondere den Interessen des Klägers am Verbleib in der Bundesrepublik gesetzt werden. Dies sei nicht geschehen. Deshalb sei die Abwägungsentscheidung insgesamt rechtswidrig. Ohnehin wäre das Verwaltungsgericht verpflichtet gewesen, eine eigenständige Abwägungsentscheidung vorzunehmen und nicht nur die Abwägungsentscheidung der Verwaltung zu überprüfen. Das nachtatliche Verhalten sei überhaupt nicht berücksichtigt worden. Insbesondere der Therapieabschluss, dem eine gesetzgeberische Erwartung (§ 64 StGB) zu Grunde gelegen sei, sei in die Abwägung nicht eingestellt worden. Soweit die Beklagte wiederholt auf „unzweifelhaft“ bestehende charakterliche Mängel und eine „defizitäre Persönlichkeitsstruktur“ Bezug nehme, liege bereits ein Aufklärungsmangel vor. Es gehöre nicht zur Profession der Beklagten, ohne jede sachverständige Beratung Persönlichkeitsstrukturen und Mängel zu beurteilen. Vielmehr hätte sie ein Gutachten einholen müssen, wenn sie meinte, aus vermeintlichen Dispositionen Rückschlüsse für die Zukunft ziehen zu können. Aus dem Sachverständigengutachten Dr. S. ergäben sich gerade keine Anhaltspunkte für eine Persönlichkeitsstörung und dissoziale Tendenzen, die die Phase des Betäubungsmittelkonsums überlagern würden. Die Annahmen der Beklagten hätten sich somit als falsch erwiesen. Auch seien seitens der Antragsgegnerin, aber durch Inbezugnahmen auch seitens des Verwaltungsgerichts generalpräventive Erwägungen in die Abwägung eingestellt worden. Es bleibe zunächst unklar, ob es sich dabei um Abwägungskriterien handeln solle oder die Gefahr generalpräventiv begründet werden solle. Das Verwaltungsgericht habe jedenfalls verkannt, dass unbeschadet der grundsätzlichen Frage die Berücksichtigungsfähigkeit schon nach bisheriger Rechtsprechung nur in engen Grenzen verhältnismäßig gewesen sei. Diese Grenze werde hier nicht beachtet. Soweit die Beklagte meine, generalpräventive Gründe in die Abwägungsentscheidung einstellen zu dürfen und das Verwaltungsgericht dies für rechtmäßig erachte, werde schon nicht erläutert, welche Ausländer durch die Entscheidung abgeschreckt werden könnten. Die Besonderheiten des Einzelfalls würden eine Übertragung auf andere Ausländer keinesfalls zulassen. Es werde nicht im Ansatz dargelegt – geschweige denn belegt – wie andere (suchtmittelabhängige?) Ausländer durch eine solche Entscheidung abgeschreckt werden könnten. Diese Annahme sei kriminologisch widerlegt. Es sei gerade bei abhängigkeitsbedingten Straftaten eine Abschreckungswirkung im Sinne der negativen Generalprävention auszuschließen. Die Wirksamkeit sei auch für Ausweisungen nicht belegt. Die Ausweisungsverfügung wäre aber selbstredend auch nicht verhältnismäßig, da der Kläger gerade durch seine Therapiebereitschaft und den Therapieerfolg selbst an der Beseitigung einer etwaigen Gefahr mitgewirkt habe. Es sei fragwürdig, generalpräventive Gründe zuzulassen. Das Einstellen generalpräventiver Gesichtspunkte in die Ausweisungsentscheidung erweise sich insgesamt als rechtswidrig. Sie stehe gerade im Widerspruch zum Gebot einer ergebnisoffenen Abwägung. Die Beklagte wolle die Ausweisung neben spezialpräventiven „Zwecken“ auch auf Generalprävention stützen. Auch wenn das Urteil hierzu keine expliziten Ausführungen enthalte, sei aufgrund der Globalverweisungen offenbar davon auszugehen, dass es sich der Auffassung angeschlossen habe. Das Urteil sei auch insoweit rechtsfehlerhaft. Offenbar meine die Beklagte, dass eine generalpräventive Wirkung immer dann zu erzielen sei, wenn ein Ausweisungsinteresse gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG erfüllt sei. Dies sei bereits systematisch falsch, weil hier das Ausweisungsinteresse, das nur für die Abwägung Relevanz habe, mit der Polizeigefahr verwechselt werde, die als eigenständiges Tatbestandsmerkmal erfüllt sein müsse. Auch offenbare sich insoweit die unzutreffende Annahme, dass zwischen dem Ausweisungsinteresse und dem Tatbestandsmerkmal der „Gefährdung“ eine Indizverknüpfung bestehen würde. Eine Ausweisung dürfe nur verfügt werden, wenn eine konkrete Polizeigefahr bestehe. Ausschließlich generalpräventiv verfügte Ausweisungen würden auf keiner Polizeigefahr beruhen, sondern auf einer – vermeintlichen – abstrakten Gefahr von den „anderen Ausländern“. Von den anderen Ausländern gehe aber überhaupt keine konkrete Gefahr aus. Die Ausweisung sei zur Abschreckung nicht näher konkretisierter Ausländer nicht geeignet. Es sei mit keinem Wort dargelegt, wer durch die Ausweisung des Klägers abgeschreckt werden könnte. Die Beklagte gehe auf die Besonderheiten des Einzelfalls nicht ein. Sie prüfe auch nicht, ob eine generalpräventive Ausweisung noch verhältnismäßig sein könne, wenn eine Therapie erfolgreich abgeschlossen worden sei. In dem Fall würde sich die Ausweisung als unverhältnismäßig im Hinblick auf die weitere Persönlichkeitsentwicklung des Klägers und den langjährigen Inlandsaufenthalt sowie im Hinblick auf sämtliche im Rahmen von Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 8 EMRK zu berücksichtigenden Umstände erweisen. Würde man die Ausweisungsvorschriften so verstehen, dass sie zur Ausweisung aus generalpräventiven Gründen ermächtigen würden, wäre die Vorschrift verfassungswidrig. Verfassungsrechtlich bedürfe es eines positiven Nachweises, dass das Gemeinschaftsinteresse höher zu bewerten sei als das grundgesetzlich geschützte Individualinteresse. Eine gesetzliche oder sonstige Maßnahme sei dann verfassungswidrig, wenn ihre Erforderlichkeit und Proportionalität nicht dargetan werden könne. So sei es hier. Denn für die Wirksamkeit der Abschreckung mittels Ausweisung werde trotz jahrzehntelanger Diskussion nichts Konkretes vorgebracht. Würde man aus dem Gesetz ableiten, dass eine generalpräventiv abzuwehrende „Gefahr“ unter das Tatbestandsmerkmal der Gefährdung subsumiert werden könnte, wäre ein solches Gesetz verfassungswidrig, da es seine Wirksamkeit verfehle. Von einem erbrachten Nachweis der Abschreckungswirkung könne nämlich gerade nicht ausgegangen werden. Wollte man also die Ausweisung auf die Abwendung einer generalpräventiv abwendbaren „Gefahr“ stützen, müsste gemäß § 100 Abs. 1 GG ein Vorlagebeschluss erfolgen. Eine andere Auslegung verstoße gegen Art. 3 GG. Es könne nicht ernsthaft behauptet werden, dass Drittstaatsangehörige ohne EG-Daueraufenthaltserlaubnis per se ein höheres Gefährdungspotential in sich trügen als Unionsbürger, ARB-Berechtigte oder Drittstaatsangehörige mit EG-Daueraufenthaltserlaubnis. Es bestehe kein Verantwortungszusammenhang zwischen der vorgetragenen Anlasstat und der Abschreckungswirkung, vielmehr führe die generalpräventiv begründete Ausweisung zu einer Verletzung der Menschenwürde und des Übermaßverbotes aus Art. 2 Abs. 1 GG. Der Kläger sei nicht dafür verantwortlich, ob andere Personen sich strafbar machen oder nicht, sodass ein Verantwortungszusammenhang nicht bestehe. Zur Verhältnismäßigkeit: Die schutzwürdigen Interessen des Klägers seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Insbesondere werde die Bedeutung des Art. 8 EMRK verkannt. Der Kläger sei faktischer Inländer und habe keinerlei Bindungen in das Land seiner Staatsangehörigkeit. Die Familie sei gemeinsam aufgrund einer Aufnahmezusage als jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion eingereist. Sie habe ihre Verbindungen in das Land der Staatsangehörigkeit mit der Einreise abgebrochen. Die Kernfamilie sei gemeinsam zugewandert. Die Ausweisungsverfügung treffe den Kläger daher wesentlich intensiver als einen Betroffenen, der über derartig starke Bindungen in die Bundesrepublik Deutschland nicht verfüge. Es wäre auch zu sehen gewesen, was nicht geschehen sei, dass der Mutter und den Großeltern schon aufgrund des Alters nicht zumutbar sei, den Kläger regelmäßig in Russland zu besuchen. Die Unverhältnismäßigkeit erfolge auch aus der Tatsache, dass das Verwaltungsgericht von einer bestehenden Wiederholungsgefahr ausgehe, obwohl die sachverständig beratene Strafvollstreckungskammer eine günstige Sozialprognose für den Kläger ausgestellt habe. Das Verhältnismäßigkeitsgebot verlange nämlich aufgrund des besonderen Ausweisungsschutzes des Klägers und der Intensität des Grundrechtseingriffs eine grundrechtliche Abwägung der sich gegenüberstehenden Prinzipien und Gewährleistungen. Es sei unverhältnismäßig, wenn eine Strafvollstreckungskammer nach umfangreicher Prüfung eine günstige Prognose ausstelle, ohne Heranziehung anderer Erkenntnisse und anderen Wissens im Verwaltungsstreitverfahren zu einem anderen Ergebnis hinsichtlich dieser Prognose zu gelangen und damit eine Ausweisung zu begründen. Das Verwaltungsgericht habe nicht beachtet, dass die Frage der Wiederholungsgefahr im Falle des Klägers verfassungsrechtliches Abwägungsgebot sei, resultierend aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Es habe deshalb auch nicht von einer günstigen Prognose abweichen dürfen, ohne selbst auf eine bessere Tatsachengrundlage zurückzugreifen und die Fehlerhaftigkeit der Prognose aufzeigen zu können. Die Bejahung der Wiederholungsgefahr stehe unter dem Vorbehalt eines erhöhten Begründungserfordernisses, wenn ein anderes Gericht bereits eine günstige Prognose gestellt habe und die Frage – wie hier – aufgrund erheblichen Grundrechtseingriffs im Wege der Abwägung zu berücksichtigen sei. Dem erhöhten Begründungserfordernis seien weder die Beklagte noch das Verwaltungsgericht nachgekommen. Zur Sperrfrist: Die Sperrfrist erweise sich aufgrund des schwerwiegenden Eingriffs in das grundsätzlich zu beachtende Privat- und Familienleben des Klägers als unverhältnismäßig. Insbesondere sei das Ermessen auch nicht vollständig ausgeübt worden. Die Beklagte habe gar nicht in Erwägung gezogen, von Art. 11 Abs. 2 Satz 4 AufenthG Gebrauch zu machen und eine kürzere Sperrfrist in Erwägung zu ziehen, soweit eine entsprechend festzusetzende Bedingung des Nachweises der Straf- und Drogenfreiheit erbracht sei. Die Beklagte habe zudem ihr Ermessen im Laufe des Verfahrens nicht ausreichend erneuert (§ 114 VwGO). Die Erneuerung des Ermessens wäre zwingend erforderlich gewesen, da gegenüber dem Bescheiderlass wesentliche Änderungen im Sachverhalt eingetreten seien, sodass sich die Ermessensentscheidung insgesamt als fehlerhaft erweise. Denn es seien nicht alle relevanten Tatsachen bei der Entscheidung berücksichtigt worden, zudem sei der rechtliche Rahmen seitens der Beklagten verkannt worden. Das Verwaltungsgericht habe insoweit die Frage der Ermessensausübung im laufenden Verfahren auch gar nicht geprüft. Im Einzelnen: Eine erneute schriftsätzliche Ermessensausübung im laufenden Verwaltungsstreitverfahren sei nicht erfolgt. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb sich der erfolgreiche Therapieabschluss, die Reststrafenaussetzung, der Nachweis einer Vollzeitbeschäftigung und die Pflege einer wieder mit der Mutter und den Großeltern unbelasteten Beziehung auf die Dauer der Befristungsentscheidung in überhaupt keiner Weise auswirke. Dies zeige, dass überhaupt keine Ermessenserneuerung vorliege. Die Beklagte hätte erläutern müssen, weshalb die veränderten Umstände überhaupt keine Auswirkungen auf die Fernhaltefrist habe. Hinzu komme, dass die Beklagte auch weiterhin nicht in Erwägung gezogen habe, von § 11 Abs. 4 Satz 2 AufenthG Gebrauch zu machen und für den Fall des Eintritts der Bedingung eine kürzere Sperrfrist festzusetzen. Die Beklagte habe des Weiteren den rechtlichen Rahmen verkannt, wenn man der Erklärung der Beklagtenvertreterin in der mündlichen Verhandlung, dass die Beklagte zum gegenwärtigen Zeitpunkt die ursprüngliche Fernhaltefrist für angemessen und erforderlich halte, eine Ermessenserneuerung zubilligen würde. Denn die Befristung (auf sieben Jahre) erweise sich aufgrund der (dargelegten) neu eingetretenen Tatsachen als in jeder Hinsicht unverhältnismäßig. Wenn bereits bei der Ausweisungsentscheidung selbst eine Reststrafenaussetzung besonderes Gewicht habe, gelte dies als Verhältnismäßigkeitsgebot erst recht für die Befristungsentscheidung. Für den Kläger sei ein positiver Verlauf der Bewährung zu erwarten. Auch habe das Verwaltungsgericht nicht berücksichtigt, dass bereits die Ermessensentscheidung im Bescheid unzureichend gewesen sei. Es habe zudem verkannt, dass die Erneuerung des Ermessens nicht gemäß § 114 VwGO erfolgt sei. Es sei vielmehr davon ausgegangen, dass eine Erneuerung des Ermessens gar nicht erforderlich sei, obwohl dies § 114 VwGO erfordert hätte. Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts habe sich das Gewicht des im Zeitpunkt der Ausweisungsentscheidung bestehenden Ausweisungsgrunde im Laufe des Verfahrens reduziert. Dies folge aus dem Therapiebericht, dem Bericht der Bewährungshelferin, der Reststrafenaussetzungsentscheidung des Landgerichts, dem Sachverständigengutachten Dr. S. sowie den aktuellen Lebensverhältnissen des Klägers (Arbeitsstelle, Wohnung, Partnerin, Bindung zur Familie). Es fehle jegliche schlüssige Darstellung geschweige denn ein Beweis, dass bei dem Kläger eine Wiederholungsgefahr über die Dauer von zehn Jahren (gemeint: sieben Jahren) bestehen solle und diese sich nicht reduziert habe. Das Gewicht des Wiederkehrinteresses habe sich zudem erhöht. Dies folge schon allein daraus, dass der Kläger nachgewiesen habe, dass seine Lebensgefährtin mit ihrer Tochter im Bundesgebiet lebe, was im Rahmen des Art. 8 EMRK zu gewichten gewesen wäre. Das Urteil führe diese Tatsache noch nicht einmal auf.
Unter dem 17. Juni 2020 wiederholte, vertiefte und ergänzte der Kläger sein Vorbringen. Es liege keine hinreichende Gefahr der Begehung von Straftaten vor. Bei der dem Strafbefehl vom 2. Juli 2013 zugrundeliegenden Handlung handle es sich nicht um eine einschlägige Vorstrafe. Zudem habe sich der Kläger bei seinem damaligen Fehlverhalten selbst geschädigt (Verlust eines Augenlichts, entstellende Optik im Gesicht). Die vom Sachverständigen L. diskutierte Persönlichkeitsveränderung wirke sich nicht auf die Zukunft aus, da sie erfolgreich behandelt worden sei. Der Verurteilung vom 24. April 2016 liege ein Verhalten zugrunde, das auf einer Persönlichkeitsveränderung beruhe, die einer erst kurze Zeit vor der Tat beginnenden Episode entspringe, die aber lange beendet sei. Der Kläger konsumiere überhaupt keine Betäubungsmittel und keinen Alkohol. Es sei nicht zutreffend, wenn die Beklagte meine, vorzeitige Haftentlassung und Ausweisung verfolgten unterschiedliche Zwecke und unterlägen deshalb unterschiedlichen Regelungen, die Haftentlassung diene der Resozialisierung, die Ausweisung der Gefahrenabwehr. Resozialisierung sei nichts Anderes als Spezialprävention. Sie habe nicht nur das persönliche Freiheitsinteresse des Verurteilten im Blickpunkt. Sie diene vielmehr dem Schutz der Gemeinschaft selbst. Die Bewährungsaussetzung ziele ebenfalls auf die Verhinderung von Straftaten und eine spezialpräventive Wirkung ab. Hinsichtlich der nach § 64 StGB Untergebrachten habe die Behandlung zudem das Ziel, dem Betroffenen von seinem Hang zu heilen und die zugrundeliegende Fehlhaltung zu beheben. Dies sei im Falle des Klägers beachtet und eingehalten worden. Der Kläger habe die Erwartung in jeder Hinsicht erfüllt. Strafrechtliche Kriminalprognoseentscheidungen beruhten nicht auf einem sich vom Gefahrenabwehrrecht unterscheidenden Maßstab. Der Unterschied liege vielmehr in dem unterschiedlichen Grundrecht, dass von der Eingriffsmaßnahme betroffen sei. Es gebe keinen Automatismus zur Bewährungsaussetzung. Führungsaufsicht und weitere Maßnahmen der Aufsicht und Hilfe, insbesondere die Tätigkeit eines Bewährungshelfers und die Möglichkeit bestimmter Weisungen könnten die Annahme einer Reduktion der Gefahr für die Allgemeinheit begründen. Der Prognosezeitraum für eine Strafaussetzung nach § 57 StGB sei zudem nicht die Dauer der Bewährungszeit. Dies gebe § 56 Abs. 1 Satz 1 StGB dem strafrechtlichen Entscheider auch nicht vor. Vielmehr bestehe nach dem Gesetz ein „ewiger“ Prognosezeitraum. Für Entscheidungen nach § 57 StGB bzw. § 36 BtMG gelte nichts Anderes. Es gehe bei Aussetzungsentscheidungen nach § 57 StGB zwar auch um die Frage, ob der Täter das Potential habe, sich während der Bewährungszeit straffrei zu führen, aber eben nicht nur. Die Annahme unterschiedlicher Prognosezeiträume sei falsch. Insbesondere bleibe die Frage unbeantwortet, wie lange der Prognosezeitraum im Ausweisungsverfahren sein solle. Für eine Formel, wonach es bei der Ausweisung um die Frage gehe, ob das Risiko des Misslingens der Resozialisierung von der deutschen Gesellschaft oder von der Gesellschaft des „Heimatstaates“ getragen werden müsse, fehle eine gesetzliche Grundlage. Die Entscheidung, welche Risiken die Gesellschaft zu tragen habe, obliege dem Gesetzgeber. Anders als das Bundesverwaltungsgericht offenbar meine, setze eine Ausweisung von ausländischen Staatsangehörigen allerdings eine hinreichend wahrscheinliche Gefahr der Begehung von Straftaten voraus und nicht nur ein irgendwie geartetes Risiko. Der Sachverständige habe einen inneren Wandel des Klägers ausführlich dargestellt und begründet. Auch sei die Annahme, die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt habe nicht das Ziel, Gefahren für die öffentliche Sicherheit längerfristig zu unterbinden, durch das Gesetz widerlegt. Die Beklagte berücksichtige weder die Bedeutung des Maßregelvollzugs noch die Bedeutung der Beschlüsse der Strafvollstreckungskammer. Oberstes Ziel des Maßregelvollzugs sei der Schutz der Allgemeinheit vor der Begehung weiterer Straftaten (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Maßregelvollzugsgesetz). Soweit der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Ansicht vertrete, dass die Bewährungsentscheidung nach § 67d StGB für die ausländerrechtliche Prognose wenig Aussagekraft habe, da sie einen wesentlich kürzeren Prognosezeitraum in den Blick nehme (B.v. 10.10.2017 – 19 ZB 16.2636 Rn. 21), sei zu beachten, dass die Beurteilungszeitspanne umstritten und differenziert zu betrachten sei. Soweit der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (a.a.O.) darauf abstelle, dass eine „relativ kurze Zeitspanne“ eines erwartenden Behandlungserfolgs für die Rechtmäßigkeit der Anordnung der Maßregel gelte, betreffe dies nur die Anordnung und nicht das Ziel des Maßregelvollzugs und insbesondere nicht die Aussetzungsprognose gemäß § 67d Abs. 2 Satz 1 StGB. Es handle sich um völlig unterschiedliche Prognosen. Vor der Entscheidung nach § 67d Abs. 2 StGB oder vor einer Erledigungsentscheidung nach § 67d Abs. 5 StGB sei ein Sachverständigengutachten zur Kriminalprognose einzuholen (§ 463 Abs. 3 StPO). Auch sei die gesetzliche Erwartung, dass der Betroffene keine erheblichen Straftaten mehr begehen werde (§ 67d Abs. 2 Satz 1 StGB) zeitlich nicht befristet. Wenn die Beklagte meine, eine Gefahr im Sinne des § 53 AufenthG könne auch schon dann vorliegen, wenn es sich nicht um „erhebliche“ Taten im Sinne einer Fortdauer der Unterbringung handeln würde, blende sie aus, dass sich die Strafvollstreckungskammer bei ihrer Prüfung keineswegs nur auf „erhebliche“ Straftaten beschränkt habe. Der Sachverständige habe im Auftrag des Landgerichts die Frage nach der Erwartung von „rechtswidrigen“ Taten zum Gegenstand seiner Begutachtung gemacht. Soweit des Weiteren die Beklagte behaupte, die gebotene Gesamtbetrachtung führe zu einer wesentlichen breiteren Tatsachengrundlage als derjenigen, auf der die strafvollstreckungsrechtliche Aussetzungsentscheidung getroffen sei, benenne sie keine Tatsachen, die bei der Strafvollstreckungsentscheidung nicht berücksichtigt worden wäre. Das Landgericht habe vielmehr eine Gesamtwürdigung vorgenommen. Dass der soziale Empfangsraum wie vom Landgericht angenommen positiv und stabil gewesen sei, könne von der Beklagten nicht substantiiert in Abrede gestellt werden, da der Kläger über stabile Lebens- und Sozialverhältnisse verfüge und diese auch seit über 16 Monaten unter Beweis gestellt habe und sich die Erwartung des Landgerichts geradezu bestätigt habe. Wenn die Beklagte in Abrede stellen wolle, dass das Landgericht nicht sämtliche Gesichtspunkte des § 57 Abs. 1 Satz 2 StGB berücksichtigt habe, beinhalte dies den Vorwurf eines Verbrechens der Rechtsbeugung und der Strafvereitlung im Amt gegen die zuständige Strafvollstreckungskammer bzw. erkennende Richterin. Wenn derartige Behauptungen aufgestellt würden, müsste die Beklagte das Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgeben. Das Landgericht habe alle Umstände berücksichtigt, die auch im Rahmen einer ausländerrechtlichen Gefahrenprognose zu berücksichtigen seien. Es sei unzutreffend, wenn behauptet werde, das Landgericht habe seinen Beschluss „nahezu ausschließlich“ mit dem erfolgreichen Durchlaufen des Therapieprogramms und der dabei erfolgten Erarbeitung rückfallpräventiver Maßnahmen sowie mit dem Bestehen eines tragfähigen Empfangsraums und den erteilten Weisungen begründet. Das Landgericht habe vielmehr ausführlich das Gutachten und die Stellungnahme nach § 67d StGB berücksichtigt und geprüft und begründet, weshalb die Entlassung anzuordnen sei. Die Beklagte vermöge nicht darzulegen, aufgrund welcher breiteren Tatsachengrundlage ein Abweichen von der Prognose des Landgerichts gerechtfertigt sein könnte. Weder die Beklagte noch das Verwaltungsgericht hätten im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 19.10.2016) ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben, das eine Abweichung von der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer zulasse, noch bestünden konkrete Gefahren für höchste Rechtsgüter. Es verkehre die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in das Gegenteil, wenn die Beklagte und das Verwaltungsgericht versuchen würden, die Beachtung von Auflagen und Weisungen, die vom Kläger strafvollstreckungsrechtlich erwartet würden, als negatives Prognoseindiz zu werten. Insbesondere bestehe keinerlei konkreter Anhaltspunkt dafür, dass der Kläger die Auflagen und Weisungen nicht beachten würde, was insbesondere durch den Bericht der Bewährungshelferin nachgewiesen worden sei. Auch habe der Sachverständige zwar Regelverstöße thematisiert, aber herausgehoben, dass diese nicht nennenswert gewesen seien. Erheblich zeitlich zurückliegende Verstöße, die therapeutisch aufgearbeitet worden seien, hätten schlicht keine durchgreifende Relevanz für die Prognose. Es sei gemäß Gutachten „insgesamt“ von deutlich überwiegenden, positiven prognostischen Anhaltspunkten auszugehen. Der Sachverständige gehe davon aus, dass das frühere Verhalten im Zusammenhang mit der Persönlichkeits- und Verhaltensänderung aufgrund des Methamphetaminkonsums gestanden sei. Genau diesen Zusammenhang habe der Kläger gemäß Gutachten auch gut und reflektiert aufgearbeitet und suffiziente Coping-Mechanismen und Strategien ausgearbeitet. Auch habe der Sachverständige eindeutig diagnostiziert, dass beim Kläger keine dissoziale Persönlichkeitsstörung bestehe. Der Sachverständige habe in seinem Gutachten mehrfach ausgeführt und dargelegt, dass auch insoweit erfolgreich eine Verhaltensänderung erzielt worden sei. Dies belege unzweifelhaft, dass es sich nicht um eine pathologische dissoziale Persönlichkeitsänderung handle. Die Beklagte führe kein tragfähiges Argument an, weshalb sich seit der Begutachtung vom 23. November 2018 die Prognosegesichtspunkte nachteilig verändert haben könnten. Zudem habe sich der Sachverständige intensiv mit der Frage der Legalbewährung beim Kläger befasst. Die Beklagte vermöge nicht aufzuzeigen, dass das Ergebnis des Gutachtens (insoweit) falsch wäre. Dafür, dass der Kläger nach Ablauf der Bewährungszeit wieder Methamphetamin konsumieren werde, gebe es nicht im Ansatz einen konkreten Anhaltspunkt, ebenso wenig – worauf es aber ankäme – dafür, dass er Straftaten begehen werde. Auch weise die Beklagte ja selbst daraufhin, dass ein Weisungsverstoß nicht nur einen Bewährungswiderruf zur Folge hätte, sondern darüber hinaus auch strafbewehrt wäre. Hinzu komme: Es entspreche nicht der gesetzlichen Regelung, dass durch die Verwirklichung einer bestimmten Strafhöhe bzw. eines Delikttyps die Ausweisung kraft Gesetzes zwingend zu erfolgen habe und die Gefahr indiziert sei. Der Gutachter habe festgestellt, dass die Suchtproblematik erfolgreich behandelt worden sei. Die Persönlichkeitsveränderungen, deren symptomatischer Zusammenhang mit der Anlassverurteilung feststünden, bestünden ausweislich des Gutachtens nicht fort. Ein Berufen auf erfahrungsgemäß hohe Rückfallquoten sei gemäß Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (19.10.2016 a.a.O. Rn. 22) kein tragfähiges Argument für eine negative Prognose und würde dem Kläger den Beweis einer negativen Tatsache auferlegen. Es sei auch (anders als die Beklagte meine) nicht ersichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 19. Oktober 2016 die Bedeutung von strafvollstreckungsrechtlichen Entscheidungen auf Verurteilungen nach dem Betäubungsmittelgesetz beschränkt hätte. Die Frage der Wiederholungsgefahr habe Grundrechtsrelevanz. Dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Mai 2019 (2 BvR 657/19 Rn. 37) sei im Übrigen durchaus zu entnehmen, dass die Schaffung einer Tatsachengrundlage im Sinne der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Oktober 2016 erforderlich sei, wenn ein Strafvollstreckungsgericht eine positive Prognose getroffen habe. Eine solche breitere Tatsachengrundlage, die eine abweichende negative Prognose erlauben würde, sei im Falle des Klägers gerade nicht geschaffen worden. Weder das Verwaltungsgericht noch die Beklagte hätten Tatsachen aufgeführt, die das Landgericht nicht berücksichtigt hätte. Des Weiteren könne die Beklagte nicht erklären, weshalb die gesetzliche Wertung des § 54 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG im Falle des Klägers nicht gelten solle. Zur Problematik der Generalprävention: Das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 14.2.1012 – 1 C 7.11 Rn. 22) verkenne, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Begriff einer generalpräventiv begründeten Ausweisung überhaupt nicht kenne. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlange regelmäßig, dass von dem Betroffenen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zur Begehung neuer Straftaten ausgehe. Es prüfe daher die Ausweisung, wenn man es in die deutsche Rechtssprache übertragen möchte, spezialpräventiv. Soweit sich die Beklagte auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Mai 2019 (1 C 21/18) beziehe, die eine generalpräventiv begründete Ausweisungsverfügung betreffe, und in der das Bundesverwaltungsgericht ausführe, dass auch allein generalpräventive Gründe ein Ausweisungsinteresse begründen könnten, halte das Bundesverwaltungsgericht verschiedene Tatbestandsmerkmale nicht auseinander. Jedenfalls das Tatbestandsmerkmal der „Gefährdung“ könne nicht damit begründet werden, dass eine nichterfolgende Ausweisung andere Personen nicht abschrecken würde. Das Ausweisungsinteresse betreffe das zweite Tatbestandsmerkmal, nämlich das Erfordernis des Überwiegens des Ausweisungsinteresses. Dagegen betreffe es nicht das Tatbestandsmerkmal der Gefährdung. Das Tatbestandsmerkmal der Gefährdung erlaube es nicht, Sachverhalte hierunter zu subsumieren, die keine konkrete Polizeigefahr darstellten. Eine solche sei zwingend immer Voraussetzung, um eine Ausweisung verfügen zu können, soweit das kumulative Tatbestandsmerkmal des Interessenüberwiegens vorliege. Eine andere Auslegung scheitere bereits an einer ausreichend bestimmten Vorschrift. Das Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes verlange, dass für den Betroffenen die Folgen seines Verhaltens vorhersehbar seien. Die Wesentlichkeitsgarantie verlange bei solchen Eingriffen nicht nur, dass überhaupt ein Parlamentsgesetz vorliege, sondern dass der Gesetzgeber auch die einzelnen Eingriffsbefugnisse selbst regle. Das Bestimmtheitsgebot gelte auch für das Sicherheitsrecht. Eine Auslegung dahingehend, dass eine Gefährdung auch dann vorliegen solle, wenn von dem Betroffenen selbst keine Gefahr ausgehe, zeige deutlich die Unbestimmtheit der vermeintlichen Rechtsgrundlage auf. Des Weiteren finde sich eine ausreichende Grundlage für eine Legitimierung der Generalprävention im Gefahrenabwehrrecht zur Begründung von Eingriffsmaßnahmen nicht. Für die Wirksamkeit einer negativen Generalprävention könne nur die vermeintliche Lebenserfahrung vorgebracht werden, die im Hinblick auf die Eingriffsintensität keine ausreichende Sicherheit biete. Der Tatbestand der Gefährdung könne nicht mittels einer Gefährdung durch (irgendwelche) andere Ausländer ausgefüllt werden. Solle dagegen Abschreckung als Folge schuldhaften Tuns Tatbestandsvoraussetzung sein, ohne dass eine konkrete Polizeigefahr abgewehrt werden solle, stelle die Ausweisung keine Gefahrenabwehr mehr dar. Es handle sich dann um einen Verstoß gegen das Übermaßverbot. Zur Verhältnismäßigkeitsprüfung betreffend die Generalprävention: Die generalpräventiv begründete Ausweisung sei weder im Bescheid noch im Urteil des Verwaltungsgerichts ausreichend begründet worden. Die Beklagte habe die generalpräventive Ausweisung (auch im Zulassungsantragsverfahren) in keiner Weise auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft. Sie meine vielmehr, dass nachtatliches Verhalten überhaupt keine Rolle spiele. Erforderlich sei aber eine besondere Verhältnismäßigkeitsprüfung und demnach sei dem Nachtatverhalten ganz besonderes Gewicht einzuräumen. Zur Abwägung: Die Beklagte stütze sich im weiten Umfang auf nicht tragfähige Abwägungsgesichtspunkte. Es könne keine Rede davon sein, dass sich der Kläger nicht integriert habe. Er habe eine deutsche Staatsangehörige als Lebensgefährtin. Er habe einen Assistenzarzt in einem psychiatrischen Krankenhaus als besonders engen Freund (vgl. Beweisantrag Nr. 3 vor dem Verwaltungsgericht). Aus dem Sachverständigengutachten folge ein positiver sozialer Empfangsraum. Ebenso ergebe sich dies aus der Stellungnahme der Bewährungshelferin, die interessanterweise überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werde. Demnach seien die finanziellen Verhältnisse geregelt, die Wohnverhältnisse geklärt, der Kläger stehe in gutem Kontakt mit seiner Familie und sei in einer festen Partnerschaft. Seine sozialen Kontakte wähle er mit Vorsicht aus (Bericht vom 20.11.2019), der alte Bekanntenkreis bestehe nicht fort. Die Bindungen zur Mutter und den Großeltern seien gut und stabil (gemäß Sachverständigengutachten und Bericht der Bewährungshelferin). Die Beklagte verkenne auch, dass der Verlust des Aufenthaltsrechts nicht nur dazu führe, dass der Kläger einige Jahre die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin in der Bundesrepublik nicht führen könne. Es sei der Lebensgefährtin nicht zumutbar, ihren Lebensmittelpunkt zu verlagern, da sie nicht nur deutsche Staatsangehörige sei, sondern auch ein zwar volljähriges, aber im Haushalt lebendes Kind habe und sie darüber hinaus in der Bundesrepublik Deutschland berufstätig sei.
Unter dem 2. Juli und 21. September 2020 wiederholte, vertiefte und ergänzte der Kläger sein Vorbringen weiter. Im Hinblick auf ein vom Kläger im Jahr 2013 begangenes einmaliges Verkehrsdelikt komme eine Bejahung der Wiederholungsgefahr nicht in Betracht. Für die Frage der Wiederholungsgefahr sei relevant, dass der Kläger bei dem Verkehrsunfall erheblich selbst geschädigt worden sei. Die tagtägliche Erinnerung stelle einen wesentlichen Prognosegesichtspunkt dar, der ausschließe, dass der Kläger erneut ein Verkehrsdelikt begehen werde. Die Verurteilung der Anlasstat (27.4.2016) liege bereits vier Jahre zurück, die abgeurteilte Tatzeit ca. fünf Jahre. Weder nach der Verurteilung noch vor den abgeurteilten Taten sei es zu aggressivem Verhalten des Klägers gekommen. Betreffend die Anlasstat folge aus dem Urteil des Amtsgerichts und den Ausführungen des Sachverständigen keine Persönlichkeitsstörung, sondern eine Persönlichkeitsveränderung. Das Amtsgericht sei beim Kläger von einem unkritischen schädlichen Gebrauch an der Grenze zur Abhängigkeit ausgegangen. Die Beklagte differenziere nicht zwischen einer Persönlichkeitsveränderung und einer (überdauernden (?)) Persönlichkeitsstörung. Der Kläger müsse auch nicht die von der Behörde angenommene Wiederholungsgefahr widerlegen. Vielmehr müsse eine Gefahrenprognose unter Berücksichtigung aller Umstände, wie sie sich zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt darstellen, getroffen werden. Eine Gesamtbetrachtung sei keine breitere Tatsachengrundlage. Der Beklagten gelinge es nicht (um den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts zu genügen) eine „breitere“ Tatsachengrundlage tatsächlich in Form von Tatsachen zu belegen. Die Bedeutung der strafvollstreckungsrechtlichen Entscheidungen habe das Bundesverfassungsgericht in einer neuen Entscheidung nochmal ausdrücklich betont (B.v. 25.8.2020 – 2 BvR 640/20 Rn. 29). Es stehe der Beklagten nicht zu, das Gutachten des Dr. S. umzuinterpretieren, ohne diesen gehört zu haben. Die Interpretation des Gutachtens durch die Beklagte sei falsch. Die Beklagte meine, der Sachverständige habe die Diagnose einer im Rahmen eines intensiven Methamphetaminkonsums entstandenen organischen Persönlichkeits- und Verhaltensstörung bejaht und nur das Fortbestehen verneint. Dies sei falsch. Offenkundig verstehe die Beklagte den Aufbau des Gutachtens falsch. Der Gutachter Dr. S. komme zu dem Ergebnis, dass im Hinblick auf die Diagnose des Sachverständigen L. sich die Diagnose einer Stimulanzienabhängigkeit bestätigt habe, die einer Persönlichkeitsstörung dagegen nicht. Diese habe aber auch der Sachverständige L. gar nicht diagnostiziert. Auf Seite 73 seines schriftlichen Gutachtens heiße es: „Eine etwaige Persönlichkeits- und Verhaltensstörung…“. Dr. S. habe nicht ausgeführt, dass die Störung nicht fortbestehe, sondern dass die Diagnose nicht fortbestehe. Dies sei natürlich etwas völlig Anderes. Dr. S. habe festgestellt, eine solche Störung habe nicht vorgelegen. Ebenso habe er festgestellt, dass die Diagnose einer dissozialen Persönlichkeitsstörung nicht zu stellen sei. Im Ergebnis habe Dr. S. festgestellt, dass überhaupt keine Persönlichkeitsstörung vorliege (S. 23 des Gutachtens). Dies müsse die Beklagte nun einmal so hinnehmen. Hinsichtlich der Stimulanzienabhängigkeit verstehe die Beklagte das Gutachten auch falsch. Die Diagnose einer Abhängigkeit werde selbstverständlich nicht einfach gelöscht, wenn eine Therapie stattgefunden habe. Sie werde vielmehr im Rahmen der ICD-Klassifikation abgeändert, wenn eine Änderung beispielsweise (so hier) in Richtung Abstinenz eingetreten sei. Ergänzend sei im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (B.v. 25.8.2020) auszuführen, dass der Kläger unzweifelhaft unter dem Schutz des Art. 8 EMRK und des Art. 2 Abs. 1 GG stehe. Ihm komme ein umfassender verfassungsrechtlicher und konventionsrechtlicher Schutz zu. Er verfüge über einen sehr hohen Schutz. Ein Eingriff in seine Rechte aus Art. 8 Abs. 1 EMRK sei nur gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK zulässig. Aus Gründen des grundrechtlich gewährleisteten Verhältnismäßigkeitsgebots dürfe die ausländerrechtliche Prognose nicht ohne weiteres von der strafvollstreckungsrechtlichen Prognose abweichen. Es sei weder der Beklagten noch dem Verwaltungsgericht gelungen aufzuzeigen, dass ihre Prognose auf einer wesentlich breiteren Tatsachenprognose beruhen würde als die der Strafvollstreckungskammer. Das Gegenteil sei der Fall: Die Prognose der Strafvollstreckungskammer sei durch weitere Fachstellen (Bericht der Bewährungshilfe, Stellungnahme des Bezirksklinikums vom 26.6.2018, Bericht des Bezirksklinikums vom 18.10.2019) unterstrichen worden. Die Grundlage für die Anordnung des Maßregelvollzugs (§ 64 Satz 2 StGB) habe nichts mit der Prognose bei der Aussetzung der Strafe zur Bewährung zu tun. Es handle sich um grundverschiedene Prognosen. Die Prognosen nach § 57 StGB und die Prognose im Ausweisungsrecht seien nicht an unterschiedlichen Maßstäben orientiert. Dementsprechend habe das Bundesverfassungsgericht den Rechtssatz gebildet, dass eine Einheit der Rechtsordnung bestehe, die es gerade erforderlich mache, der Prognoseentscheidung des Landgerichts wesentliche Bedeutung im Ausweisungsrecht zukommen zu lassen. Anhaltspunkte dafür, dass die Strafvollstreckungskammer einen zu niedrigen Maßstab angesetzt hätte, liegen nicht vor. Es sei verfassungsrechtlich nicht zulässig, wenn die Beklagte im Rahmen einer Prognoseentscheidung zu berücksichtigende Weisungen und Auflagen im Rahmen einer ausländerrechtlichen Prognose nicht als günstige Umstände berücksichtigen wolle. Es sei im Übrigen auch geboten, im Rahmen der Abwägung nach § 53 Abs. 2 AufenthG das nachtatliche Verhalten zu berücksichtigen. Dazu gehöre auch das erfolgreiche Durchlaufen einer Behandlung gemäß § 64 StGB, der positive Bewährungsverlauf und die Arbeitstätigkeit des Klägers. Auch sei nochmals anzumerken, dass die Beklagte offenbar den Unterschied zwischen der Anordnung des Maßregelvollzugs, der Dauer des Maßregelvollzugs und der Beendigung des Maßregelvollzugs verkenne. Es sei eine positive Sozialprognose gestellt worden. Auf die Anordnungsprognose komme es nicht an. Die in § 67d Abs. 2 Satz 1 StGB geforderte Erwartung, dass der Betroffene „keine erheblichen Straftaten mehr begehen wird“, sei zeitlich nicht befristet. Soweit der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einer Entscheidung vom 10. Oktober 2017 ausführe, dass etwas mehr als die Hälfte von Betroffenen, die mit guter Prognose entlassen worden seien, innerhalb von zwei bis drei Jahren erneut straffällig würden und es – davon – bei etwas mehr als der Hälfte erneut zu einer Freiheitsstrafe oder zu einem Widerruf der Aussetzung des Maßregelvollzugs komme, sei diese Feststellung wenig aussagekräftig und für den vorliegenden Fall auch nicht weiterführend. Zum einen sei nicht erkennbar, inwieweit hier zwischen dem Anordnungsgrund der Maßregel differenziert werde, noch hinsichtlich der Art der Straffälligkeit. Die Forschung zu diesen Fragen werde ohnehin als „rar“ und „methodologisch problematisch“ beschrieben. Insgesamt seien verallgemeinernde Aussagen über die vermeintlich geringe Bedeutung von Entscheidungen nach § 67d Abs. 2 StGB nicht ertragreich, da es sich um komplexe Einzelfallentscheidungen handle. Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger zu der Gruppe von der mehr als der „Hälfte der Straftäter“ gehören werde, die innerhalb von zwei bis drei Jahren erneut straffällig würden, bestünden nicht. Denn er sei bereits seit 4. Februar 2019 nicht mehr untergebracht, es liege ein aktualisierter Bericht des Bezirksklinikums vom 18. Oktober 2019 vor, die letzte Straftat liege über fünf Jahre zurück. Im Hinblick auf § 68b StGB sei es falsch, wenn die Beklagte meine, die Führungsaufsicht könne auch ohne Auflagen und Weisungen angeordnet werden. Im Hinblick auf § 57 StGB (Reststrafenbewährung) könne die Beklagte nicht darlegen, auf welcher tragfähigen Grundlage von der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer abgewichen werden könne. Offenbar sei die Beklagte der Auffassung, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts falsch sei. Die Ausführungen der Beklagten zur Frage des zeitlichen Prognosezeitraums seien nicht zutreffend. Bewährungszeit und Prognosezeitraum seien zwei völlig unterschiedliche Dinge. Es bestehe kein Zusammenhang zwischen Bewährungszeit und Prognose. Die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach es darum gehen solle, ob sich der Verurteilte während der Bewährungszeit straffrei führen werde, sei unzutreffend. Sei die Prognose für den Zeitraum nach der Bewährung ungünstig, dürfe auch keine positive Prognose gestellt werden, da dann gerade die weitere Vollstreckung und Einwirkung durch Haft geboten sei. Keinesfalls sei der Prognosezeitraum bei der Strafaussetzung begrenzt auf die Dauer der Bewährungszeit. Es sei auch nicht richtig, dass bei der Bewährungszeit, die wie ausgeführt nichts mit dem Prognosezeitraum zu tun habe, im Vordergrund stehe, wie lange das „Damoklesschwert“ eines drohenden Widerrufs im Vordergrund stehen würde. Die Dauer der Frist stehe im Ermessen des Gerichts. Dass während der Bewährungszeit ein Widerruf der Bewährung drohe, soweit ein Bewährungsverstoß vorliege, sei selbstverständlich richtig. Allerdings sei dies ein prognostisch günstiger Umstand und nicht etwa ein ungünstiger. Dagegen sei der Rückschluss unzulässig, dass ein positiver Bewährungsverlauf eine negative Prognose für die Zeit nach der Bewährung erlaube. Gesamtbetrachtung: Die Beklagte habe keine Tatsachen aufgeführt, die die Strafvollstreckungskammer nicht gewürdigt haben solle. Ein Rechtssatz, wonach nicht davon ausgegangen werden könne, dass sämtliche für die ausländerrechtliche Gefahrenprognose maßgeblichen Umstände von der Strafvollstreckungskammer berücksichtigt worden seien, weil die Beschlussgründe nicht alle Umstände im Einzelnen aufführen, könne nicht gebildet werden. Damit werde die Aussage des Bundesverfassungsgerichts in ihr Gegenteil verkehrt. Es bestehe nicht im Ansatz ein Anhaltspunkt dafür, dass die Strafvollstreckungskammer von den gesetzlichen Vorgaben abgewichen wäre. Es könne keine Rede davon sein, dass die Strafvollstreckungskammer die Gesichtspunkte des § 57 Abs. 1 Satz 2 StGB nicht ausdrücklich gewürdigt habe. Das Landgericht habe auch eine Gewichtung vorgenommen. Dies ergebe sich aus der vorgenommenen Gesamtwürdigung. Eine Gesamtwürdigung sei eine Gewichtung. Erfahrungswerte, dass „Suchttherapien“ nur eine relativ geringe Erfolgswahrscheinlichkeit hätten, seien dagegen keineswegs zu berücksichtigen. Es handle sich dabei um eine derart undifferenzierte Verallgemeinerung, so dass es sich bereits um keinen Erfahrungswert handle. Sie stelle das Gegenteil einer individuellen Gefahrenprognose dar. Soweit man schließlich eine generalpräventive Ausweisung für zulässig erachten würde, seien die Anforderungen an die erforderliche Abwägung nicht beachtet.
Nachdem die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts A. unter dem 26. Januar 2021 die vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof angeforderte Strafvollstreckungsakte vorgelegt hatte, führte der Kläger unter dem 15. Februar 2021 u.a. aus: Im streitgegenständlichen Verfahren sei kein Sachverständigengutachten eingeholt worden. Die Ausführungen der Beklagten zum Gutachten des Dr. S. seien falsch. Es sei erforderlich, im Rahmen einer Berufungshauptverhandlung den Sachverständigen mündlich anzuhören. Der Sachverständige habe keine Persönlichkeitsstörung bestätigt. Seine Formulierung, die Diagnose einer im Rahmen des intensiven Methamphetaminkonsums als organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung zu klassifizierende Störung bestehe nicht mehr fort, bedeute, dass sich der Sachverständige Dr. S. der Verdachtsdiagnose des Sachverständigen L. (zitiert gemäß Seite 4 des Gutachtens Dr. S: „Eine etwaige Persönlichkeits- und Verhaltensveränderung, verursacht durch intensiven Stimulanzienkonsum, könnte grundsätzlich als Restzustand und verzögert auftretende psychologische Störung im Sinne einer Persönlichkeits- und Verhaltensstörung… klassifiziert werden“) ausdrücklich nicht angeschlossen habe, da er sie – zutreffend – als Verdachtsdiagnose interpretiert habe. Wesentlich sei die Aussage des Gutachters Dr. S., eine gravierende seelische Störung, beispielsweise in Form einer überdauernden Psychose, einer schweren psychiatrischen Störung oder auch einer forensisch relevanten Persönlichkeitsstörung lasse sich nicht feststellen (Seite 26 des Gutachtens Dr. S.). Dort heiße es „nicht“ und nicht „nicht mehr“. Etwas Anderes ergebe sich auch nicht aus den Ausführungen des Amtsgerichts Nürnberg. Der Sachverständige L. habe keineswegs eine Diagnose nach ICD-10 F15.71 (Persönlichkeitsstörung) als gesichert angesehen. Noch einmal werde zudem betont, dass eine Führungsaufsicht nicht ohne Weisungen angeordnet werden könne. Es sei nicht erforderlich, dass es einer Weisung bedürfe, um diese anordnen zu dürfen. Unbeschadet dessen bestehe keine tragfähige Grundlage dafür, die positive Wirkung von Auflagen und Weisungen in Abrede stellen zu wollen, solange nicht aufgezeigt werden könne, dass diese nicht beachtet würden. Vielmehr seien alle Umstände zu berücksichtigen, die Einfluss auf eine günstige Prognose haben würden. Auflagen und Weisungen seien prognostisch nicht negativ einzustellen. Hinzuweisen sei darauf, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Bedeutung der Wiederholungsgefahr als Gegenstand verfassungsrechtlicher Abwägung keineswegs auf sogenannte faktische Inländer beschränkt sei. Da hier ein Gericht bereits eine günstige Prognose gestellt und die Schutzinteressen der Allgemeinheit berücksichtigt und die Aussetzung der Restfreiheitsstrafe zur Bewährung beschlossen habe, sei es nicht verhältnismäßig, wenn ein anderes Gericht trotz nicht bestehender anderer Tatsachengrundlagen eine andere Prognose treffen und ein Entfernen vom Gebiet der Bundesrepublik, was einen mindestens ebenso schweren Grundrechtseingriff wie eine Freiheitsentziehung darstelle, für verhältnismäßig erachte. Es liege dann nämlich ein Übermaß der Reaktion auf vergangenes Unrecht vor. Dies erlaube das Verhältnismäßigkeitsgebot gerade nicht. Wolle eine staatliche Stelle von einer bereits getroffenen prognostischen Entscheidung und hiermit einhergehenden Auflagen und Weisungen, die der Betroffene strikt beachte und als Grundrechtsbeschränkung akzeptiere, negativ abweichen, verlange dies eine besondere Rechtfertigung hinsichtlich ihrer Erforderlichkeit und damit Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Dies habe zur Folge, dass von der Strafvollstreckungsentscheidung nicht mit der Begründung abgewichen werden dürfe, dass die dort bereits bekannten Umstände nicht in der Weise gewichtet worden seien, wie es die Beklagte vornehmen würde. Die strafrechtlichen Kriminalprognoseentscheidungen beruhten nicht auf einem sich vom Gefahrenabwehrrecht unterscheidenden Maßstab. Eine breitere Tatsachengrundlage könne die Beklagte nicht darstellen, sie wolle lediglich eine andere Wertung vornehmen als die Strafvollstreckungskammer. Ein derartiges Vorgehen habe das Bundesverfassungsgericht jedoch gerade nicht gebilligt. Die Prognose der Strafvollstreckungskammer bestehe unverändert fort. Es bestehe keine Veranlassung, von einer ungünstigen Prognose auszugehen. Es habe zwar einen Rückfall gegeben, die Bewährungshelferin habe aber keinen Widerruf angeregt.
Die Rügen des Klägers zeigen keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des erstinstanzlichen Urteils auf.
1.1 Der Kläger stellt mit seinem Zulassungsvorbringen nicht erfolgreich in Frage, dass von ihm nach wie vor eine konkrete Gefahr der Begehung weiterer schwerwiegender Straftaten im Sinne von § 53 Abs. 1 AufenthG ausgeht.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts haben Ausländerbehörden und Verwaltungsgerichte bei einer (hier: auch) spezialpräventiven Ausweisungsentscheidung und ihrer gerichtlichen Überprüfung eine eigenständige Prognose zur Wiederholungsgefahr zu treffen (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 15.1.2013 – 1 C 10.12 – juris Rn. 18; BayVGH, B.v. 14.2.2017 – 19 ZB 16.2570). Die Indizien, die für diese Prognose heranzuziehen sind, ergeben sich nicht nur aus dem Verhalten im Strafvollzug und danach. Bei der Prognose, ob eine Wiederholung vergleichbarer Straftaten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit droht, sind die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere die Höhe der verhängten Strafe, die Schwere der konkreten Straftat, die Umstände ihrer Begehung, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts sowie die Persönlichkeit des Täters und seine Entwicklung und Lebensumstände bis zum maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt (vgl. BVerwG, U.v. 16.11.2000 – 9 C 6/00 – BVerwGE 112, 185 – juris Rn. 14; vgl. auch BVerwG, B.v. 4.5.1990 – 1 B 82/89 – NVwZ-RR 1990, 649 – juris Rn. 4; BayVGH, B.v. 6.11.2109 – 19 CS 19.1183 – juris Rn. 10). An die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sind umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist (stRspr., vgl. z.B. BVerwG, U.v. 4.10.2012 – 1 C 13.11 – juris Rn. 18; BayVGH, U.v. 30.10.2012 – 10 B 11.2744 – juris Rn. 34 und B.v. 3.3.2016 – 10 ZB 14.844 – juris). Auch der Rang des bedrohten Rechtsguts ist dabei zu berücksichtigen. Für die im Rahmen tatrichterlicher Prognose festzustellende Wiederholungsgefahr gilt mithin nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein differenzierender, mit zunehmenden Ausmaß des möglichen Schadens abgesenkter Grad der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts (vgl. BVerwG, U.v. 15.1.2013 – 1 C 10/12 – juris Rn. 15). Dies bedeutet nicht, dass bei hochrangigen Rechtsgütern (wie Leben und Gesundheit, vgl. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) bereits jede auch nur entfernte Möglichkeit einer Wiederholungsgefahr eine Wiederholungsgefahr begründet (vgl. BVerwG, U.v. 15.1.2013 – a.a.O. Rn. 16; U.v. 4.10.2012 – a.a.O.).
Was die Prognose der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts im Hinblick auf Drogenstraftaten angeht, ist zudem festzuhalten, dass Betäubungsmitteldelikte (die hiesige Anlassdelinquenz des Klägers steht jedenfalls im symptomatischen Zusammenhang mit dessen Drogenabhängigkeit, wie noch auszuführen sein wird) zu den schweren, Grundinteressen der Gesellschaft berührenden und schwer zu bekämpfenden Straftaten gehören. Zwar wurde der Kläger nicht wegen illegalen Drogenhandels verurteilt, aber auch Beschaffungs-, Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikte, die im Zusammenhang mit einer Betäubungsmittelabhängigkeit stehen, stellen eine (gleichermaßen) schwer zu bekämpfende Kriminalität dar. Zu berücksichtigen ist zudem der hohe Rang, den die Verfassung in den Grundrechten Leib, Leben und körperlicher Unversehrtheit verleiht.
Nach diesen Maßgaben ist unter Berücksichtigung der besonderen Bedeutung der bedrohten Rechtsgüter vorliegend aufgrund der schwerwiegenden Straftaten des Klägers sowie aufgrund der Einzelumstände weiterhin von einer massiven und fortbestehenden Bedrohung der öffentlichen Sicherheit auszugehen:
Nachdem gegen den am 5. September 1999 in das Bundesgebiet eingereisten Kläger im Jahr 2004 wegen Ladendiebstahls ermittelt, sodann im Jahr 2012 aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln von einer Verfolgung abgesehen worden war und im Jahr 2013 gegen ihn ein Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, fahrlässiger Körperverletzung sowie vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ergangen war, des Weiteren im Jahr 2015 gegen ihn wegen Fälschung beweiserheblicher Tatsachen gemäß § 269 StGB und Betruges gemäß § 263 StGB, zudem wegen räuberischer Erpressung gemäß § 255 StGB, Körperverletzung gemäß § 223 StGB, Beleidigung gemäß § 185 StGB und Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB ermittelt worden war, verurteilte ihn das Amtsgericht N. mit Urteil vom 27. April 2016 (rechtskräftig seit 30.5.2016) wegen Nötigung mit vorsätzlicher Körperverletzung mit Sachbeschädigung und Sachbeschädigung und versuchter schwerer räuberischer Erpressung in zwei tateinheitlichen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Angeordnet wurde die Unterbringung des Klägers in einer Entziehungsanstalt. Dem Urteil ist u. a. zu entnehmen, dass der Kläger am 21. August 2015 seine Mutter aufforderte, ihm Geld zu geben. Nachdem diese ihm daraufhin Bargeld in Höhe von 30,- Euro übergeben hatte, griff er zur Durchsetzung seiner Forderung nach mehr Geld in deren Handtasche, ging sie persönlich an, beschimpfte sie und zerriss eine um deren Hals hängende Kette. Am 25. September 2015 klingelte er bei seinen Großeltern. Der Großvater öffnete aus Angst, dass es wie bereits in der Vergangenheit zu Gewalttaten seitens des Klägers kommen könnte, die Tür nicht. Aus Wut darüber warf der Kläger ein vor dem Anwesen abgestelltes Fahrrad um, sprang darauf herum, riss den Deckel aus dem Briefkasten seiner Großeltern heraus und beleidigte diese unentwegt. Ca. 30 Min. später gelangte der Kläger in die Wohnung der Großeltern, nahm aus seinem mitgeführten Rucksack, in dem sich darüber hinaus eine 17 cm lange Ahle befand, ein Jagdmesser mit einer Klingenlänge von 18,5 cm in die Hand, schlug mit voller Wucht gegen einen im Flur abgestellten Schuhschrank, zog das Messer aus seiner Hülle heraus und forderte von den Großeltern unter Vorhalt des Messers mit den Worten „jetzt ist es vorbei, ich bringe euch um, gebt mir Geld, 5.000“ 5.000,- Euro. Sodann folgte der Kläger seiner Großmutter (die um Hilfe geschrien hatte) in das Schlafzimmer, packte sie, warf sie auf das Bett, hielt sie mit einer Hand fest, während er mit der anderen Hand das Messer hielt. Der Großvater warf sich auf den Kläger und forderte ihn auf, die Großmutter loszulassen, worauf es zu einem Gerangel kam. Nachdem der Kläger von der Großmutter abgelassen hatte, verlagerte sich der Streit in die Küche, der Kläger schrie: „Ich bin gekommen, um euch abzustechen“, während er weiterhin das Messer in der Hand hielt. Nachdem er die Sirene eines sich nähernden Polizeiautos gehört hatte, steckte er das Messer wieder ein, nahm den Rucksack sowie den Laptop der Großmutter an sich und lief aus dem Haus. Dem Urteil ist weiter zu entnehmen, dass der Kläger sich zu den Tatzeitpunkten aufgrund eines Betäubungsmittelkonsums wenigstens nicht ausschließbar in einem die Steuerungsfähigkeit erheblich vermindernden Zustand befand. Aus dem Urteil ergibt sich zudem, dass der Kläger die ihm gemachten Tatvorwürfe im Wesentlichen in Abrede gestellt hatte. Seine Mutter und seine Großeltern würden zu 80% lügen, um ihm zu schaden. Die Familie sei mit seinem Drogenkonsum nicht zurechtgekommen. Er habe eine erhebliche Summe an Schulden gehabt, ca. 7.000 oder 8.000 Euro. Die Großeltern hätten ihm zunächst 2.000 Euro, später das Geld „für die Bezahlung der Geldstrafe“ geliehen. Die Mutter habe sich ihm gegenüber oftmals sehr aggressiv gezeigt, sei auf ihn körperlich losgegangen. Er habe sich dann zur Wehr gesetzt. Dabei habe er seiner Mutter u.a. den Finger gebrochen, ihm tue das auch leid. Er habe sich jedoch zum Teil nicht anders zu helfen gewusst. Er habe es satt gehabt, dass seine Mutter und auch seine Großmutter schwarz gearbeitet hätten. Die Familie habe ihn loswerden wollen. Ab Mai 2014 habe er regelmäßig Crystal, mindestens zwei- bis dreimal die Woche jeweils ca. 0,2 bis 0,3 Gramm konsumiert. Zuvor habe er lediglich gelegentlich geraucht oder im Rahmen einer Party Crystal konsumiert. Es sei richtig, dass er gegenüber dem Sachverständigen L. andersartige Angaben zu seinem Betäubungsmittelkonsum gemacht habe. Zu diesem Zeitpunkt habe das Ergebnis der Haaruntersuchung noch nicht vorgelegen. Er habe deshalb keine Veranlassung gesehen, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Er offenbare die Dinge erst dann, wenn die Karten auf dem Tisch liegen würden. Dem Urteil ist weiter zu entnehmen, dass der Sachverständige L. (insbesondere angepasst an die aktuellen Angaben des Klägers zu seinem Betäubungsmittelkonsum) ausgeführt habe, dass bei diesem von einer seitens des von ihm angegebenen Stimulanzienkonsums ausgelösten Persönlichkeitsveränderung im Sinne einer krankhaften seelischen Störung auszugehen sei. Nach den in den bisherigen Krankenakten und auch im hiesigen Verfahrensverlauf divergierenden Angaben des Klägers zu seinem Betäubungsmittelkonsum sei der Wahrheitsgehalt der zuletzt gemachten Angaben des Klägers diesbezüglich schwer einschätzbar. Zuletzt habe der Kläger ihm gegenüber, entsprechend seinen (des Klägers) Angaben in der Hauptverhandlung einen ca. dreimaligen Konsum von Methamphetamin pro Woche eingeräumt. Das Ergebnis der toxikologischen Haaruntersuchung würde hingegen sogar für einen noch häufigeren, hochdosierten und regelmäßigen Amphetaminkonsum sprechen. Nach den ICD-10-Kriterien für ein manifestes Abhängigkeitssyndrom sei bei dem Kläger von einem schädlichen Gebrauch an der Grenze zur Abhängigkeit auszugehen. Die durch die Mutter und die Großeltern des Klägers geschilderten Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen des Klägers seien in ihrem Ursprung nicht eindeutig zuordenbar. Der Kläger habe im Jahr 2013 einen schweren Autounfall erlitten, durch dessen Folge er ein Auge verloren habe. Es spreche deshalb viel dafür, dass die Persönlichkeits- und Verhaltensveränderung, wie von den Zeugen beschrieben, eine Spätfolge der erlittenen Verletzungen seien. Andererseits sei nicht ausschließbar, dass die Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen durch den intensiven Stimulanzienkonsum des Klägers verursacht worden seien. Der Kläger werde durch die ihm nahestehenden Personen als vermehrt aggressiv und impulsiv beschrieben. Zwar seien diese Zustandsbilder größtenteils jeweils einem aktuellen Rauschzustand zuzuordnen, allerdings könne es sich dabei auch um eine überdauernde Wesensveränderung im Sinne einer verzögert auftretenden psychotischen Störung handeln (…). Vor diesem Hintergrund bzw. auf dieser Grundlage sei auch von einer tief verwurzelten inneren Disposition des Klägers auszugehen, berauschende Substanzen, konkret Methamphetamin, im Übermaß zu konsumieren. Die Straftaten seien auch in einem zumindest indirekten Zusammenhang mit dem Drogenkonsum zu sehen. Die durch den Drogenkonsum zumindest nicht ausschließbar bedingte Persönlichkeitsstörung und Verhaltensänderung führe zu einer erhöhten Aggressivität und Impulsivität, was beides für die Tatbegehungen als mitursächlich angesehen werden müsse. Insofern sei ein symptomatischer Zusammenhang zwischen dem Drogenkonsum und den Straftatbegehungen zu bejahen. Entsprechend gestalte sich auch die Kriminalprognose negativ, da davon auszugehen sei, dass sich das Aggressionsverhalten des Klägers durch einen weitergehenden Drogenkonsum bestärke bzw. steigere. (…) Das Gericht führte weiter aus, dass zulasten des Klägers sein jeweils massives, verbal und körperlich extrem bedrängendes, teils aggressives bis brutales Vorgehen gewertet werden müsse.
Dem Gutachten der forensisch-analytischen Laboratorien Professor Dr. B. am Institut für Rechtsmedizin der Universität E.-N. vom 22. Oktober 2015 ist u.a. zu entnehmen, dass nach chemisch-toxikologischer Untersuchung einer übersandten Haarprobe des Klägers die gemessenen Werte einem sehr intensiven Konsum von Methamphetamin und einem gelegentlichen bis regelmäßigen Konsum von Kokain während des von der Untersuchung erfassten Zeitraums von etwa drei Monaten vor der Abnahme (die Haarprobe wurde am 25.9.2015 abgeschnitten) zugeordnet werden könnten.
Wesentlicher Hintergrund jedenfalls der letzten Delinquenz des Klägers war seine Suchtmittelabhängigkeit, zu der sich der Kläger gegenüber dem Gutachter L. unter dem 25. November und 17. Dezember 2015 (zuletzt konfrontiert mit dem Ergebnis der toxikologischen Haaruntersuchung vom 22.10.2015) und auch gegenüber dem Gutachter Dr. S. am 13. November 2018 eher undeutlich und verschleiernd, ersichtlich bagatellisierend äußerte. Dem Strafurteil vom 27. April 2016 (angeordnet wurde die Unterbringung des Klägers in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB) ist (wie dargelegt) zu entnehmen, dass der Sachverständige L. ausführte, beim Kläger sei von einer bereits tief verwurzelten inneren Disposition auszugehen, berauschende Substanzen, konkret Methamphetamin, im Übermaß zu konsumieren. Die Straftaten seien auch in einem zumindest indirekten Zusammenhang mit dem Drogenkonsum zu sehen. Die durch den Drogenkonsum zumindest nicht ausschließbar bedingte Persönlichkeitsstörung und Verhaltensänderung führe zu einer erhöhten Aggressivität und Impulsivität, was beides für die Tatbegehungen als mitursächlich angesehen werde müsse. Insofern sei ein symptomatischer Zusammenhang zwischen dem Drogenkonsum und den Strafbegehungen zu bejahen. Entsprechend gestalte sich auch die Kriminalprognose negativ, da davon auszugehen sei, dass sich das Aggressionsverhalten des Klägers durch einen weitergehenden Drogenkonsum bestärke bzw. steigere.
Gutachter Dr. S. kam in seinem für die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts A. erstellten Gutachten vom 23. November 2018 (unter „Zusammenfassung und Beurteilung“) zu der Erkenntnis, hinsichtlich der Anlassstraftaten müsse ausgeführt werden, dass sich diese nicht klar als primäre, unmittelbare Drogend.h. Beschaffungskriminalität darstellen, jedoch die Gewalt- und Raubtaten in Zusammenhang mit der drogenverursachten Persönlichkeits- und Verhaltensänderung stehen und somit als Symptomcharakter für die (damals) aktive Substanzabhängigkeit zu werten sind. Dem entsprechend kam auch die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts A. in ihrem Beschluss vom 15. Januar 2019 zu der Überzeugung, dass die Anlasstaten in der Abhängigkeitserkrankung des Klägers („wie das Ausgangsgericht sachverständig beraten festgestellt hat“) wurzelten. Davon ausgehend ist auch der Kläger nach eigenem Vortrag der Auffassung, die Anlassverurteilung habe im kausalen Zusammenhang mit seiner Betäubungsmittelabhängigkeit gestanden.
Die durch die erhebliche Delinquenz indizierte Gefährlichkeit des Klägers ist bislang nicht beseitigt. Insbesondere lässt die Entwicklung des Klägers nach der den Anlass für die Ausweisung bildenden strafgerichtlichen Verurteilung nicht darauf schließen, dass die Gefährlichkeit des Klägers abgenommen hat oder gar beseitigt ist:
Die Aussetzung des weiteren Vollzugs der mit Urteil des Amtsgerichts N. vom 27. April 2016 angeordneten Unterbringung in einer Entziehungsanstalt so wie der weiteren Vollstreckung der durch dieses Urteil gegen den Kläger erkannten Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren drei Monaten zur Bewährung ab dem 5. Februar 2019 durch strafvollstreckungsgerichtlichen Beschluss des Landgerichts A. vom 15. Januar 2019 führt nicht zu einer positiven Sicherheitsprognose im Ausweisungsverfahren. Dieser Beschluss stellt zwar einen veränderten, zu berücksichtigenden Umstand dar, der jedoch die wesentlichen Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts nicht in Frage zu stellen vermag. Eine Vorverlagerung der auf der Basis der zum maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt gegebenen tatsächlichen Umstände zu treffenden Prognose- und Abwägungsentscheidung in das Berufungszulassungsverfahren ist daher aufgrund der Einzelfallumstände (das Verwaltungsgericht hat sich im Urteil vom 27.11.2019 mit dem damals bereits erlassenen Beschluss der Strafvollstreckungskammer vom 15.1.2019 auseinandergesetzt) und des langfristigen ausländerrechtlichen Prognosehorizonts vorliegend nicht zu befürchten (vgl. BVerfG, B.v. 8.5.2019 – 2 BvR 657/19 – juris Rn. 37).
Grundsätzlich gilt: Einer Straf- und ggf. Maßregelaussetzungsentscheidung der Strafvollstreckungskammer – und ggf. den dieser Entscheidung zugrundeliegenden Gutachten und sonstigen Stellungnahmen, entweder der Justizvollzugsanstalt oder der Therapieeinrichtung – kommt zwar eine erhebliche indizielle Bedeutung zu. Die Ausländerbehörde und die Verwaltungsgerichte sind für die Frage der Wiederholungsgefahr daran aber nicht gebunden; es bedarf jedoch einer substantiierten Begründung, wenn von der strafgerichtlichen Entscheidung abgewichen wird (BVerfG, B.v. 19.10.2016 – 2 BvR 1943/16 – juris Rn. 21; BayVGH, B.v. 14.1.2019 – 10 ZB 18.1413 – juris Rn. 10 m.w.N.). Hier liegen durchgreifende Gründe für eine Abweichung vor. Insbesondere ist eine relevante Wiederholungsgefahr deshalb zu bejahen, weil die ausländerrechtliche Einschätzung auf einer breiteren Tatsachengrundlage als derjenigen der Strafvollstreckungskammer getroffen wird (vgl. BVerfG, a.a.O. Rn. 24). Die vom Kläger ausgehende ausländerrechtliche Gefahr liegt (gerade unter Berücksichtigung aktueller Tatsachen – dazu im Einzelnen sogleich – vgl. BVerfG, B.v. 25.8.2020 – 2 BvR 640/20 – juris Rn. 24) weiter vor.
Im Einzelnen:
In seinem Beschluss vom 2. Mai 2017 (19 CS 16.2466 – juris, insbesondere Rn. 8 ff.; KommunalPraxis BY 2017, 275 – Leitsatz, NVwZ 2017, 1637/1638 – Leitsatz – und ZAR 2017, 339 – Leitsatz) hat sich der Senat detailliert mit der Unterschiedlichkeit der Prognosen bei Strafrestaussetzungen und Ausweisungsentscheidungen befasst. Der Senat hat in seinem Beschluss vom 2. Mai 2017 dargelegt, dass die Rechtsordnung insoweit (hinsichtlich des Prognoserahmens) aus guten Gründen nicht einheitlich ist. Nach anerkannten Auslegungsgrundsätzen ist zu berücksichtigen, dass die in diesen beiden Rechtsbereichen zu erstellenden Prognosen auf unterschiedlichen Rechtsvorschriften in einem jeweils eigenen Regelungskontext gründen und deshalb an unterschiedlichen Maßstäben zu orientieren sind (systematische Auslegung, vgl. etwa Zippelius, Juristische Methodenlehre, JuS-Schriftenreihe 93, 11. Aufl. 2012, § 8 S. 36). Ein Beschluss über die Aussetzung des Strafrests trifft zur ausweisungsrechtlichen Frage, ob der Ausländer (auch) in Zukunft eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit darstellt, keine unmittelbar verwertbare Aussage; ihm ist insbesondere nicht die Überzeugung zu entnehmen, dass der Ausländer nach der Beendigung strafvollstreckungsrechtlicher Einwirkungen keine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit mehr darstellen wird. Der Ausländer kann eine solche Bedrohung darstellen und die Strafrestaussetzung dennoch rechtmäßig sein. Die dezidierte Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts, die Annahme einer Wiederholungsgefahr im Ausweisungsverfahren stelle kein Abweichen von der strafgerichtlichen Entscheidung über die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe zur Bewährung dar (B.v. 16.11.1992 – 1 B 197/92 – InfAuslR 1993, 121, juris Rn. 4, vgl. auch die eingehende Erläuterung im U.v. 15.1.2013 – 1 C 10/12 – juris Rn. 19), gibt die Rechtslage zutreffend wieder.
Strafvollstreckungsrechtliche Entscheidungen, durch die (wie hier ebenfalls durch Beschluss der Strafvollstreckungskammer vom 15. Januar 2019 angeordnet) die Vollstreckung der weiteren Unterbringung in einer Entziehungsanstalt zur Bewährung ausgesetzt wird, haben eine Bedeutung, die der im zitierten Senatsbeschluss vom 2. Mai 2017 dargestellten Bedeutung der Strafrestaussetzungsentscheidung vergleichbar ist. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt hat nicht das Ziel, Gefahren für die öffentliche Sicherheit längerfristig zu unterbinden. Für eine Anordnung dieser Maßregel genügt die hinreichend konkrete Aussicht (ein vertretbares Risiko ist einzugehen, vgl. Fischer, StGB, 64. Aufl. 2017, § 67d Rn. 11), dass durch sie der Verurteilte über eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den Hang bewahrt wird (§ 64 Satz 2 StGB), wobei „eine erhebliche Zeit“ in der Regel bereits ab einem Jahr angenommen werden kann (Schöch in Leipziger Kommentar StGB, 12. Aufl. 2008, § 64 Rn. 136 und in Festschrift für Klaus Volk, 2009, S. 705). Eine langfristige Bewahrung vor dem Rückfall kann bereits deshalb nicht als Ziel der Unterbringung festgelegt werden, weil dann entsprechend lange Unterbringungszeiten erforderlich wären. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt als freiheitsentziehende Maßnahme darf jedoch nach § 67 Abs. 1 Satz 1 StGB grundsätzlich (vorbehaltlich des Satzes 3 der Bestimmung) zwei Jahre nicht übersteigen, muss in jedem Fall verhältnismäßig sein (§ 62 StGB) und insoweit umso strengeren Voraussetzungen genügen, je länger die Unterbringung dauert (BVerfG, B.v. 19.11.2012 – 2 BvR 193/12 – StV 2014,148 ff.). Die Beendigung der Unterbringung nach § 67d Abs. 5 Satz 1 StGB, „wenn die Voraussetzungen des § 64 Satz 2 nicht mehr vorliegen“, ist somit bereits dann vorzunehmen, wenn für eine – im Vergleich zum ausländerrechtlichen Prognosehorizont – relativ kurze Zeitspanne die konkrete Aussicht (unter Eingehung eines vertretbaren Risikos) auf das Unterbleiben rechtswidriger Taten besteht. Nichts Anderes gilt für die Beendigung der Unterbringung nach § 67d Abs. 2 Satz 1 StGB, „wenn zu erwarten ist, dass der Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine rechtswidrigen Taten mehr begehen wird“, denn auch bei dieser strafvollstreckungsrechtlichen Entscheidung sowie bei der Erstellung eines Prognosegutachtens hierfür sind die begrenzte Zielsetzung der Unterbringung und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Für eine Evaluierung der Unterbringung zur Suchtbehandlung stehen nur wenige Untersuchungen zur Verfügung. Diesen zufolge wird mehr als die Hälfte der Straftäter, die aus dem Maßregelvollzug wegen guter Prognose (vorläufig) entlassen werden, innerhalb von zwei bis drei Jahren erneut straffällig. Bei etwas weniger als der Hälfte kommt es in diesem Zeitraum erneut zu einer Freiheitsstrafe oder zu einem Widerruf der Aussetzung des Maßregelvollzugs (vgl. Dessecker, Recht & Psychiatrie, 2004, 192, 197 ff.). Insgesamt ist nach der dargestellten Rechtslage das erforderliche Maß an Erfolgswahrscheinlichkeit für eine Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung und für eine entsprechende vorläufige Beendigung der Maßregel wesentlich kleiner als dasjenige für eine positive ausländerrechtliche Gefahrenprognose, weil aus der Sicht des Strafrechts auch die kleinste Resozialisierungschance genutzt werden muss. Das Strafrecht unterscheidet nicht zwischen Deutschen und Ausländern und berücksichtigt daher regelmäßig (die Ausnahmebestimmungen in § 67 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 3 StGB haben vorliegend wegen des offenen Ausweisungsverfahrens keine Anwendung gefunden) nicht die Möglichkeit, die Sicherheit der Allgemeinheit durch eine Aufenthaltsbeendigung zu gewährleisten.
Gemessen hieran kann durch Vornahme einer notwendigen Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände auch unter Berücksichtigung der positiven Entwicklungen nicht der Schluss gezogen werden, dass durch die Bewährungsaussetzung der jeweiligen Vollstreckungen die vom Kläger ausgehende Gefahr soweit entfallen ist, dass dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung bzw. sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr gefährdet.
Bei Straftaten, die auf einer Suchterkrankung des Ausländers beruhen, kann nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs von einem Wegfall der für die Ausweisung erforderlichen Wiederholungsgefahr aber nicht ausgegangen werden, solange der Ausländer nicht eine Drogentherapie erfolgreich abgeschlossen hat und die damit verbundene Erwartung eines künftig drogen- und straffreien Verhaltens auch nach Therapieende glaubhaft gemacht hat (siehe z.B. BayVGH, B.v. 29.5.2018 – 10 ZB 17.1739 – juris Rn. 9; B.v. 16.2.2018 – 10 ZB 17.2063 – juris Rn. 10; BayVGH, B.v. 7.2.2018 – 10 ZB 17.1386 – juris Rn. 10; BayVGH, U.v. 3.2.2015 – 10 B 14.1613 – juris Rn. 32 m.w.N.). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Erfolgschancen einer Therapie im Allgemeinen bereits deutlich unter 50% liegen (vgl. Fabricius in Körner/Patzak/Volkmer, BtMG, 9. Aufl. 2019, § 35 Rn. 46 ff: nur 25% der beobachteten Personen blieben strafrechtlich unauffällig und dürften eine Chance der sozialen Reintegration und der gesundheitlichen Stabilisierung erreicht haben; „bescheidene Erfolge“; nach Klos/Görgen – Rückfallprophylaxe bei Drogenabhängigkeit, 2. Aufl. 2020, S. 18 ff. – sind Rückfälle eher die Regel als die Ausnahme; Jehle/Albrecht/Hohmann-Fricke/Tetal haben in der bundesweiten Rückfalluntersuchung „Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen“ für den Zeitraum 2004/2010 bis 2013 – www.bmjv.de – ermittelt, dass nach Delikten gemäß BtMG innerhalb des 1. bis 3. Jahres 45% der Straftäter erneut registriert wurden mit einer Zunahme von weiteren 11% auf 56% vom 4. bis 6. Jahr und weiteren 4% auf 60% innerhalb des 7. bis 9. Jahres des Beobachtungszeitraums; von der Gesamtpopulation der Straftäter wurden innerhalb von 3 Jahren 36% erneut verurteilt). Solange sich der Ausländer nicht außerhalb des Straf- bzw. Maßregelvollzugs bewährt hat, kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit auf einen Einstellungswandel und eine innerlich gefestigte Verhaltensänderung geschlossen werden, die ein Entfallen der Wiederholungsgefahr rechtfertigen würde (BayVGH, B.v. 13.10.2017 – 10 ZB 17.1469 – juris Rn. 12; BayVGH, B.v. 6.5.2015 – 10 ZB 15.231 – juris Rn. 11).
An diesen dargelegten Voraussetzungen fehlt es: Die Drogentherapie des Klägers wurde, auch wenn er die stationäre Therapie in der Entziehungsanstalt formell abgeschlossen hat, zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt nicht erfolgreich beendet. Der Kläger ist vielmehr rückfällig geworden. Es fehlt damit auch die Glaubhaftmachung der Erwartung eines künftig straffreien Lebens.
Im Einzelnen:
Das Bezirksklinikum A. teilte der Bewährungshilfe des Klägers unter dem 9. Juni 2020 mit, das Drogenscreening vom 5. Juni 2020 sei positiv mit einem Wert von 874 ng/ml verlaufen. Der Kläger habe bei der Abgabe den Rückfall nicht erwähnt, nach telefonischer Konfrontation mit dem Befund habe er zögerlich zugegeben, dass er einmalig Amphetamine konsumiert habe. Unter dem 28. August 2020 sah die Bewährungshilfe gegenüber der Strafvollstreckungskammer „aktuell hohe Risikofaktoren“ aufgrund des ungeklärten Ausweisungsverfahrens sowie der „unstetigen Beziehung zu seiner Lebensgefährtin“. Er habe gegenüber seiner Therapeutin angegeben, dass seine Lebensgefährtin Alkoholikerin sei, dies wäre der Grund, weshalb sich das Paar schon mehrmals getrennt habe. Er sei zudem unter bislang angegebener bekannter Adresse nicht mehr wohnhaft. Er sei mehrmals angemahnt worden, eine neue Adresse der Bewährungshilfe mitzuteilen. Er habe immer wieder Ausreden gehabt, warum er diese nicht habe nennen können. Heute habe er eine Adresse genannt, sei aber dort nicht gemeldet. Es mache den Anschein, dass er hauptsächlich bei der Lebensgefährtin wohne. Unter dem 19. Oktober 2020 teilte die Bewährungshilfe der Strafvollstreckungskammer eine neue Meldeadresse des Klägers mit. Unter dem 16. Dezember 2020 erklärte die Bewährungshilfe gegenüber der Strafvollstreckungskammer, der Proband sei durch ein Helfertreffen nochmals stabilisiert worden, er habe am 25. November 2020 angegeben, dass er sich von seiner Lebensgefährtin getrennt habe, er fühle sich stabil, habe erkannt, dass er sich in einer für ihn toxischen Beziehung befunden habe.
Nachdem sodann der Senat den Beteiligten den Entwurf eines Vergleichsvorschlags (Bewährungsduldung) hatte zukommen lassen, fragte er vor Erlass eines Beschlusses über einen Vergleichsvorschlag vorsorglich bei der Strafvollstreckungskammer an, ob die Strafvollstreckungsakte hier nicht bekannte Aktualisierungen erfahren habe. Dadurch wurde dem Senat bekannt: neuerlicher Rückfall des Klägers am 19. Februar 2021, Polizeikontrolle nach dem Konsum, Sicherstellung von 0,21 g Amphetamine. Die Bewährungshilfe teilte sodann der Strafvollstreckungskammer unter dem 5. März 2021 mit, „im Zuge der Polizeikontrolle“ habe der Kläger sich „im Anschluss“ bei seiner ehemaligen Lebenspartnerin gemeldet, um den Vorfall mit ihr zu besprechen. Seitdem habe er wieder regelmäßig Kontakt zu ihr. Es sei im letzten Helfertreffen und durch die Bewährungshilfe thematisiert worden, dass die Beziehung zu der Partnerin konfliktbehaftet und für seine Abstinenz schädlich sei. Die Beklagte stimmte daraufhin einer Vergleichslösung nicht (mehr) zu. Unter dem 6. April 2021 erklärte die Bewährungshilfe sodann gegenüber der Strafvollstreckungskammer, der Kläger habe sich bei einer Rückfallpräventionsgruppe angemeldet. Vorgelegt wurde die Bestätigung eines Drogenhilfevereins, der Kläger werde seit November 2018 betreut.
Unabhängig von dem Rückfallgeschehen ist zunächst festzuhalten, dass bei der Einschätzung des Gewichts des eine bedingte Entlassung aus dem Maßregelvollzug befürwortenden Berichts des Bezirksklinikums A. vom 26. Juni 2018 zu berücksichtigen ist, dass – wie der Senat bereits in seinem Beschluss vom 2. Mai 2017 (19 CS 16.2466 – juris Rn. 48) im Einzelnen dargelegt und belegt hat – zu einer effektiven Drogenbehandlung ein enges Vertrauensverhältnis erforderlich ist, der Therapeut kein verlängerter Arm des Staates ist und Therapieberichte keine objektive Bewertung oder gar Begutachtung darstellen, weswegen Therapiestellungnahmen als einseitige Stellungnahmen zu bewerten sind, und die Therapieeinrichtung regelmäßig dann eine günstige Prognose abgibt, wenn sie – wie vorliegend – nicht vom Klienten durch einen erheblichen Verstoß gegen ihre Regeln zu einem disziplinarischen Therapieabbruch genötigt worden ist. Dazu kam es nicht, allerdings erweist sich der Therapieverlauf des Klägers (worauf das Verwaltungsgericht zu Recht hingewiesen hat) nicht als uneingeschränkt positiv (kritische Elemente enthaltende Stellungnahmen des Bezirksklinikums vom 25.10.2016, 11.5.2017, 10.11.2017 und 8.5.2018; letztgenannter Bericht enthält noch die Aussage, es könne derzeit noch nicht erwartet werden, dass beim Kläger keine Gefahr mehr bestehe bzw. dass er keine rechtswidrigen Taten mehr begehe). Dem entsprechend äußert sich das Klinikum unter dem 26. Juni 2018 – verbunden mit dem Hinweis, es habe im Behandlungsverlauf sechs Ereignismeldungen gegeben, zweimal hätten grobe Verstöße gegen therapeutische Absprachen stattgefunden – auch eher vorsichtig, wenn es ausführt, es sei festzustellen, dass der Kläger von der hiesigen Maßregelvollzugsbehandlung ausreichend habe profitieren können. Hätten sich in der Behandlung zu Beginn und auch zwischenzeitlich die sozial geprägten Denk- und Verhaltensmuster gepaart mit eher uneinsichtigem Verhalten in bestimmte Vorgaben gezeigt, so habe der Kläger unter den weitreichenden Lockerungen „scheinbar“ mehr und mehr Einlassbereitschaft für therapeutische Vorgaben aufbringen können. (…) Seien im stationären Setting noch Selbstüberschätzungstendenzen hinsichtlich seiner Abstinenz zu beobachten gewesen, so „scheine er während der Resozialisierungsphase durchaus besser eigene Risiken benennen und reflektieren zu können (…)“, es sei zu bemerken gewesen, dass er bei für ihn kränkenden bzw. belastenden Ereignissen das Gespräch mit dem Personal gesucht habe. Das im Umgang mit Wunschversagen und -begrenzen anfänglich stark fordernde Auftreten habe im Laufe der Zeit abgenommen. … Da die Prognose bezüglich einer Rückfallwahrscheinlichkeit in die Suchtmittelabhängigkeit nunmehr „dennoch“ als günstig erachtet werde, könne die bedingte Entlassung unter der Voraussetzung einer vorerst 14-tägigen Vorstellung zum therapeutischen Gespräch und sozialarbeiterischen Unterstützung in der hiesigen forensischen Ambulanz mit unangekündigten Urinuntersuchungen auf Drogeninhaltsstoffe, Bestimmung von ETG und Atemalkoholkontrollen sowie Hausbesuchen befürwortet werden. Hinzu kommt, dass sich der Kläger im geschützten und kontrollierten Rahmen des Maßregelvollzugs befand, der die Möglichkeiten zur Begehung von Straftaten wesentlich verringert hat. Die bedingte Aussagekraft der Einschätzungen des Bezirksklinikums für die Frage einer künftigen Drogen- bzw. Strafffreiheit hat sich auch durch das nunmehrige Rückfallgeschehen bestätigt.
Auch das Prognosegutachten des Sachverständigen Dr. S. vom 23. November 2018 benennt zwar eine Reihe positiver Prognosegesichtspunkte, die der Senat berücksichtigt, weist aber (ebenfalls) auf die Unabdingbarkeit von Nachsorgemaßnahmen im Rahmen der einzutretenden Führungsaufsicht und auf die Notwendigkeit von Weisungen und Maßnahmen zur Sicherung der Abstinenz hin, um Straftaten des Klägers zu verhindern. Der Sachverständige führt u.a. aus, die Bereiche der Einsicht des Klägers in seine Störung, die Auseinandersetzung mit der Anlassstraftat, die postdeliktische Persönlichkeitsentwicklung mit Erwerb von sozialen Kompetenzen, Rückfallvermeidungsstrategien, einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit seiner Sucht- und Delinquenzbiografie, die gute und erfolgreiche Nutzung der erworbenen Therapiemöglichkeiten, die Aufrechterhaltung einer glaubhaften Therapie- und Abstinenzbereitschaft, die Besserung der psychopathologischen Symptome und eine Persönlichkeitsnachreifung sowie der geordnet und stabil erscheinende Empfangsraum seien allesamt als prognostisch günstig zu bewerten. Aufgrund des bisherigen Therapieverlaufs und der gutachterlichen Gesamteinschätzung durch ein Untersuchungsgespräch komme er zu dem Schluss, dass bei der Beachtung von dringend erforderlichen Nachsorgemaßnahmen im Rahmen der einzutretenden Führungsaufsicht die begründete Aussicht bestehe, dass der Kläger außerhalb des Maßregelvollzugs keine neuerlichen Straftaten im Rahmen seiner Suchtmittelabhängigkeit begehen werde. Die vom Bezirksklinikum vorgeschlagenen Weisungen und Maßnahmen zur Sicherung der Abstinenz seien unter der Voraussetzung der Einhaltung der selben sinnvoll und notwendig.
Weiter ist – grundsätzlich davon ausgehend, dass das Potential, sich während der Bewährungszeit rückfallfrei und straffrei zu führen, (nur) einen von mehreren Integrationsfaktoren darstellt (BVerwG, U.v. 15.1.2013 – 10 C 10.12 – juris Rn.19; BayVGH, B.v. 14.1.2019 – 10 ZB 18.1413 – juris Rn. 10) – festzuhalten, dass auch das Strafvollstreckungsgericht der Auffassung ist, dass beim Kläger die Gefahr der weiteren Begehung von Straftaten besteht und dieser Gefahr vorgebeugt werden muss. Dies lässt sich dem Umstand entnehmen, dass eine fünfjährige Bewährungsfrist sowie eine fünfjährige Führungsaufsicht (in beiden Fällen die gesetzliche Maximaldauer) festgelegt worden sind. Zudem ist der Beschluss mit einer Reihe (zum Teil strafbewehrter) Anweisungen gemäß § 68b Abs. 1 und 2 StGB versehen. Das Strafvollstreckungsgericht macht insoweit deutlich, die von ihm verfügten Weisungen seien erforderlich, um ein etwaiges Wiederaufleben des Betäubungsmittelkonsums rechtzeitig erkennen und darauf reagieren zu können, womit der Schutz der Allgemeinheit vor künftigen abhängigkeitsbedingten erheblichen rechtswidrigen Taten in gebotenem Umfang gewährleistet ist. Auch führt das Strafvollstreckungsgericht aus, dass bei der insoweit vorgenommenen Gesamtwürdigung aller Umstände auch zu berücksichtigen ist, dass die Anlasstaten in der Abhängigkeitserkrankung des Klägers wurzelten. Er habe nun nach der Einschätzung seiner Ärzte und Therapeuten das Therapieprogramm erfolgreich durchlaufen und rückfallpräventive Maßnahmen erarbeitet. Während der Therapie sei es zu keinen Suchtmittelrückfällen gekommen.
Können mithin der Einschätzung des Bezirksklinikums vom 26. Juni 2018, dem Gutachten des Dr. S. vom 23. November 2018, dem Beschluss der (von Gutachter Dr. S. sachverständig beratenen) Strafvollstreckungskammer vom 15. Januar 2019 und auch den Stellungnahmen der Bewährungshilfe (z. B. Berichte vom 5.8.2019 und vom 20.11.2019, die später folgenden Berichte erweisen sich als wesentlich kritischer) zwar positive (aber bereits nicht durchgreifende) Gesichtspunkte im Hinblick auf die ausländerrechtliche Gefahrenprognose entnommen werden, kommt hinzu, dass diese Institutionen bei Ihren Feststellungen die nunmehr eingetretenen Entwicklungen (wieder aufgenommener Methamphetaminkonsum des Klägers) noch nicht berücksichtigen konnten. Unabhängig davon, ob der Kläger die Anweisung Ziff. V Nr. 1 des Beschlusses vom 15. Januar 2019 missachtet hat, liegt jedenfalls ein Verstoß gegen die Anweisung Ziff. V Nr. 4 vor, mithin unter den Voraussetzungen der Ziff. VI eine Straftat gemäß § 145a StGB. Auch stellt sich die Frage des Widerrufs der Bewährung (vgl. Ziff. VII des Beschlusses). Ebenso wenig konnte (insbesondere) das Strafvollstreckungsgericht bei seiner Einschätzung, der Kläger habe einen tragfähigen sozialen Empfangsraum (…), er unterhalte eine stabile und harmonisch wirkende Fernbeziehung zu einer etwas älteren Frau, wobei er sich auch mit deren fünfjährigen Sohn gut verstehe, den Kontakt zu seinem konsumierenden vormaligen Freundeskreis habe er beendet, die insoweit nunmehr eingetretenen Entwicklungen berücksichtigen. Der Kläger hat sich wohl bereits im Frühjahr 2019 einer neuen Lebenspartnerin („Alkoholikerin“, „toxische Beziehung“) zugewandt, es ist ihm trotz behaupteten Versuchs nicht gelungen, sich aus dieser Verbindung zu lösen, sie ist vielmehr eine enge (engste) Bezugsperson. Mithin ist zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt beim Kläger schwerlich (die Bewährungshilfe weist auf die Schädlichkeit der Beziehung für die Abstinenz des Klägers hin) von einem positiven sozialen Empfangsraum auszugehen. Entgegen den Erwartungen der Strafvollstreckungskammer in ihrer Aussetzungsentscheidung hat sich der Kläger nicht bewährt und erprobt, die vom Kläger betonte bewusste Abkehr von jeglichem Betäubungsmittelumgang hat sich (außerhalb des geschützten und kontrollierten Rahmens des Maßregelvollzugs) nicht bewahrheitet.
Die neuen Umstände hat der Senat aufgrund seiner (dargelegten) Pflicht, eine eigenständige Prognose zur Wiederholungsgefahr zu treffen, zu berücksichtigen. Sie vermögen jedoch die wesentlichen Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts nicht in Frage zu stellen. Eine Vorverlagerung der auf der Basis der zum maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt gegebenen tatsächlichen Umstände zu treffenden Prognose- und Abwägungsentscheidung in das Berufungszulassungsverfahren ist daher auch insoweit – es handelt sich betreffend das Rückfallgeschehen um für den Kläger negative Prognosegesichtspunkte – vorliegend nicht zu befürchten (vgl. BVerfG, B.v. 8.5.2019 – 2 BvR 657/19 – juris Rn. 37).
Zusätzlich haben die dem Kläger zuzurechnenden positiven Prognosegesichtspunkte grundsätzlich auch deshalb wenig Gewicht, weil es allgemeiner Erfahrung (und der Absicht des Gesetzgebers) entspricht, dass die Möglichkeit, eine zur Bewährung verfügte Straf- bzw. Maßregelaussetzung zu widerrufen, einen erheblichen Legalbewährungsdruck erzeugt, also zu erheblichen Auswirkungen in Richtung Selbstdisziplin und Lebensordnung führen kann (vgl. Stree/Kinzig in Schönke/Schröder, StGB 30. Aufl. 2019, § 57 Rn. 14 m.w.N. und Rn. 1: „Damoklesschwert“). Zusätzlich wirkt auf das Verhalten des Klägers das laufende Ausweisungsverfahren ein. Ein solches Verfahren entwickelt noch einmal mindestens denselben Legalbewährungsdruck wie die Straf- bzw. Maßregelaussetzung zur Bewährung. Eine drohende Ausweisung erzeugt insbesondere bei Personen mit Hafterfahrung (Ausgewiesene besitzen diese regelmäßig, auch beim Kläger ist dies der Fall) häufig einen Legalbewährungsdruck, der über denjenigen einer drohenden Inhaftierung hinausgeht; erst recht gilt dies für einen erlassenen, aber noch nicht bestandskräftigen Ausweisungsbescheid. Zu diesem Legalbewährungsdruck trägt wesentlich der Umstand bei, dass im Ausweisungsverfahren aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Im vorliegenden Fall konnten der erhebliche Legalbewährungsdruck sowie das Einwirken des laufenden Ausweisungsverfahrens auf das Verhalten des Klägers diesen nicht davon abhalten, in den Suchtmittelkonsum und in als überwunden behauptete Strukturen zurückzufallen. Dies bestätigt deutlich die nicht überwundene tiefgreifende Drogenproblematik des Klägers. Soweit dieser die Rückfälle in Zusammenhang mit der drohenden Ausweisung setzt, weist die Beklagte zurecht darauf hin, dass ihn belastende Faktoren in Zukunft immer wieder auftreten werden.
Aufgrund der Erweiterung der Erkenntnis- und Tatsachengrundlagen trifft die vom Kläger vorgebrachte (deutliche) Distanzierung von jedem Suchtmittelkonsum nicht (mehr) zu. Die Nichtbeachtung der (strafbewehrten) Weisung des Strafvollstreckungsgerichts stellt einen weiteren durchgreifenden negativen Prognosegesichtspunkt dar, auch davon ausgehend, dass nunmehr die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Kläger im Raume steht. Insbesondere ist (auch in Anbetracht der Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips) davon auszugehen, dass zusätzlich aufgrund der nunmehr vorliegenden Umstände das Risiko, dass der Kläger erneut erhebliche Straftaten begehen wird, erheblich gesteigert ist. Der Rückfall in ein Drogenkonsumverhalten, die erneuten Kontakte in die Drogenszene, um das Rauschgift zu erhalten, der nicht transparente Umgang mit den Rückfällen, der zu Tage getretene fehlende gefestigte Einstellungswandel, das wiederholte Versagen der im Rahmen des Maßregelvollzugs erarbeiteten Rückfallstrategien sowie auch hinsichtlich seiner Freundin der (erneute) Umgang in einem Milieu, das einen positiven sozialen Empfangsraum schwerlich darstellen kann, erweisen sich im Zusammenhang mit der verwirklichten Delinquenz als erhebliches Risiko für die Begehung von gewichtigen Straftaten im Bereich der Drogenbeschaffungskriminalität und betreffend Gewaltdelikte. Der Sachverständige L. hat in seinem insoweit weiter gültigen Gutachten (S. 76) vom 29. Dezember 2015 ausgeführt: „(…) Das Risiko für neuerliche aggressive Übergriffe wird dann zunehmen, wenn Herr… wieder illegale Rauschdrogen konsumiert und sich die Persönlichkeitsproblematik wieder verstärkt. Es sind dann grundsätzlich auch Straftaten zu befürchten, die erhebliche psychische und körperliche Folgen auslösen könnten.“ Der Sachverständige Dr. S. hat in seinem Gutachten im Rahmen seiner klinischen Diagnose (S. 23) festgestellt: „(…) Die dissozialen Verhaltensweisen haben sich primär in Zusammenhang mit dem intensiven Methamphetaminkonsum und der damit assoziierten organischen Persönlichkeits- und Verhaltensänderung eingestellt.“ Mithin besteht auf der Grundlage der sachverständigen Ausführungen die Gefahr, dass die Persönlichkeitsveränderung, deren symptomatischer Zusammenhang mit der Anlassverurteilung gutachterlich festgestellt wurde, wiederauflebt. Der Kläger hat durch seine Rückfälle deutlich gemacht, dass er sich nicht positiv erproben konnte. Protektive Faktoren treten mithin gegenüber Risikofaktoren in den Hintergrund. Eine ausreichende Motivation für ein drogenfreies Leben, einen insoweit tragfähigen inneren Wandel, konnte er nicht dartun. Dies gilt auch in Anbetracht des Umstandes, dass er ersichtlich weiterhin berufstätig ist. Dem Urteil des Amtsgerichts Nürnberg betreffend die Anlassstraftat ist zu entnehmen, dass dieser auch im Zeitraum der Verwirklichung der Anlassstraftaten als Sicherheitsdienstmitarbeiter angestellt war, ein Umstand, der dessen Delinquenz nicht hinderte.
Im Übrigen spricht auch der Umstand, dass gegenüber dem Kläger erstmals eine Freiheitsstrafe vollzogen worden ist, nicht gegen die Annahme einer Wiederholungsgefahr. Zwar gehen die Straf- und Verwaltungsgerichte davon aus, dass die erstmalige Verbüßung einer Haftstrafe, insbesondere als erste massive Einwirkung auf einen jungen Menschen, unter Umständen seine Reife fördern und die Gefahr eines erneuten Straffälligwerdens mindern kann (BayVGH, B.v. 24.2.2016 – 10 ZB 15.2080 – juris Rn. 12). Die Straftaten des Klägers beruhen aber (zumindest auch) auf einer Suchtmittelabhängigkeit des Klägers, die (was auch durch die nunmehr eingetretenen Ereignisse zum Ausdruck kommt) als weiterhin bestehend zu bezeichnen ist. Daher kann (wie dargelegt) ohne den erfolgreichen Abschluss einer Drogentherapie und die Glaubhaftmachung einer damit verbundenen Erwartung eines künftigen drogen- und straffreien Verhaltens auch nach Therapieende von einem Wegfall der Wiederholungsgefahr nicht ausgegangen werden. Den Anlasstaten liegt (anders als der Kläger behauptet) kein Verhalten zugrunde, das auf einer Persönlichkeitsveränderung beruht, die einer erst kurze Zeit vor der Tat beginnenden Episode entspringe, die aber lange beendet sei. Dagegen sprechen nicht nur die aktuellen Entwicklungen. Die tiefgreifende Drogen- und Straftatenproblematik des Klägers ergibt sich auch aus den Aussagen eines seiner Opfer. Als Zeuge erklärte der geschädigte Großvater bei der ermittlungsrichterlichen Vernehmung vom 25. September 2015 u.a.: „Das heute Morgen war kein Vorfall, sondern ein Überfall. Es ist nicht das erste Mal vorgefallen. Wir haben diesen Druck bisher geduldet. Es gibt auch eine Aufzeichnung auf dem Telefon. Alle Drohungen sind aufgezeichnet. Morddrohungen wegen Geld oder Sätze wie „Ich steche dich ab, ich bringe dich um, gib mir Geld.“ Das ist alles mehrfach gefallen. Innerhalb eines Jahres ist dies jede Woche vorgefallen, mehrfach. 10-, 15- bis 20-mal. Ständiges: „Ich steche dich ab, ich bringe euch um, ich schneide euch die Eier ab, deine Frau lasse ich auch ausbluten“. All dies ist in dem Zusammenhang passiert, dass er gegen das deutsche Gesetz verstößt. Er verstößt gegen das deutsche Gesetz und die Polizei hat ihn nicht nur einmal mitgenommen. Er saß bei der Polizei, aber die Polizei hat ihn jedes Mal wieder rausgelassen. Deshalb ist er wütend geworden. Er denkt, dass die deutschen Gesetze für ihn nicht gelten. … „Wenn ihr mir kein Geld gebt, vernichte ich euch“, sagte er und „Ich schicke euch die Tschetschenen ins Haus, die schneiden euch in Stücke und es wird nichts mehr von euch übrig bleiben, was man beerdigen kann. Wenn ihr mir kein Geld gebt“. Diese Geldforderungen hängen damit zusammen, mit dem Drogenkonsum. Ständiges Spielen am Spielautomaten und seiner Arbeitslosigkeit. Er arbeitet nicht. Bereits seit acht Monaten sitzt er zu Hause rum und tut nichts. Alles ist abgerissen, seine Kleidung, seine Schuhe. … Die Drohungen fingen an mit Morddrohungen, dass meine Tochter erwürgt werden soll. Er hat sie geschlagen. An der U-Bahn-Station ist alles auf Video aufgezeichnet worden, wie er sie schlägt. Sie war komplett mit blauen Flecken übersät. Er lässt uns nicht in Frieden, wir sind kranke Leute. … Das Ganze geht schon ein ganzes Jahr so. … Ständige Drohungen, das war ja nicht nur einmal der Fall. Er hat mit Kriminellen zu tun. Dabei handelt es sich um Drogenkriminalität. … Wir haben zu ihm gesagt: Hör sofort auf damit. Du landest im Gefängnis. Aber er hat darauf geantwortet: Ich habe keine Angst vor der Polizei, ich habe keine Angst vor dem Gericht, ich habe einen starken Anwalt. … Es ist unmöglich mit so einem Enkel hier weiterzuleben, er verfolgt uns…“.
Unabhängig von der Beantwortung der Frage, ob (wie zu bejahen ist) nach dem Verhalten des Klägers damit gerechnet werden muss, dass er erneut die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet (Spezialprävention), konnte die Ausweisungsentscheidung der Beklagten selbständig tragend auch auf generalpräventive Gründe gestützt werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 12. Juli 2018 (1 C 16.17 – juris) entschieden, dass diese Intention des Gesetzgebers (Zulassung einer zum Zwecke der Abschreckung Anderer dienenden Ausweisung) im Wortlaut des § 53 Abs. 1 AufenthG eine hinreichende Verankerung gefunden hat und Generalprävention ein Ausweisungsinteresse begründen kann. § 53 Abs. 1 AufenthG verlange nämlich nicht, dass von dem ordnungsrechtlich auffälligen Ausländer selbst eine Gefahr ausgehen müsse. Vielmehr müsse dessen weiterer „Aufenthalt“ eine Gefährdung bewirken. Vom Aufenthalt eines Ausländers, der Straftaten begangen habe, könne aber auch dann eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen, wenn von ihm selbst keine Wiederholungsgefahr mehr ausgehe, im Falle des Unterbleibens einer ausländerrechtlichen Reaktion auf sein Fehlverhalten andere Ausländer aber nicht wirksam davon abgehalten werden, vergleichbare Delikte zu begehen (vgl. auch z.B. BayVGH, B.v. 14.2.2019 – 10 ZB 18.1967 – juris sowie Bauer in Bergmann/Dienelt, AuslR, 13. Aufl. 2020, § 53 AufenthG Rn. 61 ff. m.w.N.). Mit Urteil vom 9. Mai 2019 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (1 C 21/18 – juris Rn.17), dass eine Ausweisung auch nach dem seit 1. Januar 2016 geltenden Ausweisungsrecht auf generalpräventive Gründe gestützt werden kann. Ein generalpräventives Ausweisungsinteresse müsse zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt noch aktuell (also noch vorhanden) sein (Rn. 18 ff).
Unabhängig davon, dass im vorliegenden Fall (wie ausgeführt) auch eine vom Kläger ausgehende Wiederholungsgefahr zu bejahen ist, muss eine generalpräventiv begründete Ausweisung in jedem Einzelfall zusätzlich den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren (vgl. schon BVerfG, B.v. 18.7.1979 – 1 BvR 650/77 – juris Rn. 37). Sie ist insbesondere nur zur Bekämpfung schwerwiegender Verfehlungen zulässig (vgl. Bauer in Bergmann/Dienelt, a.a.O. Rn. 63 m.w.N.) und nur dann geeignet, eine generalpräventive Wirkung zu erzielen, wenn eine kontinuierliche Ausweisungspraxis vorliegt, wenn die Anlasstat nicht derart singuläre Züge aufweist, dass die an sie anknüpfende Ausweisung keine abschreckende Wirkung entfalten könnte und wenn angesichts der Schwere der Straftat ein dringendes Bedürfnis auch für eine ordnungsrechtliche Prävention besteht (BVerwG, U.v. 14.2.2012 – 1 C 7/11 – juris Rn. 17).
Gemessen an diesen Grundsätzen ist die Ausweisung des Klägers (auch) aus generalpräventiven Gründen insbesondere in Anbetracht der Schwere der Tat, der Umstände der Tatbegehung und der Lebensumstände des Ausländers (vgl. BVerfG, B.v. 10.8.2007 – 2 BvR 535/06 – juris Rn. 28) nicht unverhältnismäßig. Insbesondere begründet die Gesamtbeurteilung der klägerischen Anlasstaten deren Schwere. Gegeben ist ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG. Eine Würdigung der konkreten Umstände der Straffälligkeit und der Lebensumstände des Ausländers (auch des Rückfallgeschehens) bestätigt die Verhältnismäßigkeit der Ausweisung. Die Auffassung des Klägers, es fehle insoweit an der Verhältnismäßigkeit, da er durch seine Therapiebereitschaft und seinen Therapieerfolg an der Beseitigung der Gefahr mitgewirkt habe, trifft in Anbetracht der Gesamtumstände, insbesondere auch der weiter bestehenden triefgreifenden Drogenproblematik des Klägers nicht zu.
1.2 Mit seinem Zulassungsvorbringen hat der Kläger die Gesamtabwägung des Verwaltungsgerichts gemäß § 53 Abs. 1 und 2 AufenthG nicht ernstlich im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO in Zweifel gezogen.
Ein Ausländer kann – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen – nur dann ausgewiesen werden, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt (§ 53 Abs. 1 AufenthG). In die Abwägung sind somit die in § 54 AufenthG und § 55 AufenthG vorgesehenen Ausweisungs- und Bleibeinteressen mit der im Gesetz vorgenommenen grundsätzlichen Gewichtung mit einzubeziehen (BT-Drs. 18/4097, S. 49); durch diese Begriffe wird die Abwägung strukturiert.
Ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse (im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG) ist beim Kläger in Folge seiner rechtskräftigen Verurteilung vom 27. April 2016 wegen Nötigung mit vorsätzlicher Körperverletzung mit Sachbeschädigung und Sachbeschädigung und versuchter schwerer räuberischer Erpressung in zwei tateinheitlichen Fällen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten gegeben. Das in § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG vertypte Ausweisungsinteresse setzt ein Strafmaß von zwei Jahren voraus. Dem steht ein besonders schwerwiegendes Bleibeinteresse nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG gegenüber, da der Kläger eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält.
Besonders schwerwiegende Interessen stehen sich grundsätzlich gleichrangig gegenüber. Welches Interesse überwiegt, ist immer im Rahmen einer Interessenabwägung zu klären, schon allein deshalb, weil nach der Vorstellung des Gesetzgebers neben den explizit in den §§ 54, 55 AufenthG aufgeführten Interessen auch noch weitere, nicht ausdrücklich benannte sonstige Bleibe- oder Ausweisungsinteressen denkbar sind (vgl. BT-Drs. 18/4097 Seite 49). Selbst das Vorliegen eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses, bei dessen Vorliegen ein besonderes öffentliches Interesse an der Aufenthaltsbeendigung besteht und häufig von einem Übergewicht des öffentlichen Interesses an der Ausweisung auszugehen sein wird, entbindet nicht von der Notwendigkeit der in § 53 Abs. 1 AufenthG vorgeschriebenen umfassenden Interessenabwägung mit eventuellen Bleibeinteressen des Betroffenen (BVerwG, U.v. 27.7.2017 – 1 C 28/16 – juris Rn. 39). Die gesetzliche Unterscheidung in besonders schwerwiegende und schwerwiegende Ausweisungs- und Bleibeinteressen ist für die Güterabwägung zwar regelmäßig prägend (BVerwG, U.v. 27.7.2017 – 1 C 28/16 – juris Rn. 39). Eine schematische und alleine den gesetzlichen Typisierungen und Gewichtungen verhaftete Betrachtungsweise, die einer umfassenden Bewertung der den Fall prägenden Umstände, jeweils entsprechend deren konkretem Gewicht, zuwiderlaufen würde, ist aber unzulässig (BVerfG, B.v. 10.5.2007 – 2 BvR 304/07 – juris Rn. 41 bereits zum früheren Ausweisungsrecht). Bei Vorliegen besonderer Umstände können die Ausweisungsinteressen auch weniger schwer zu gewichten sein (vgl. BT-Drs. 18/4097 Seite 50). Im Rahmen der Abwägung ist mithin nicht nur von Belang, wie der Gesetzgeber das Ausweisungsinteresse abstrakt einstuft. Vielmehr ist das dem Ausländer vorgeworfene Verhalten, das den Ausweisungsgrund bildet, im Einzelnen zu würdigen und weiter zu gewichten (BVerwG, U.v. 27.7.2017 – 1 C 28/16 – juris Rn. 39). Gerade bei prinzipiell gleichgewichtigen Ausweisungs- und Bleibeinteressen kann daher das gefahrbegründende Verhalten des Ausländers näherer Aufklärung und Feststellung bedürfen, als dies für die Erfüllung des gesetzlich vertypten Ausweisungsinteresses erforderlich ist (BVerwG, U.v. 27.7.2017 – 1 C 28/16 – juris Rn. 39). Es verbietet sich zudem aber auch eine „mathematische“ Abwägung im Sinne eines bloßen Abzählens von Umständen, die das Ausweisungsinteresse einerseits und das Bleibeinteresse andererseits begründen (BayVGH, U.v. 21.11.2017 – 10 B 17.818 – juris Rn. 41; VGH BW, U.v. 13.1.2016 – 11 S 889/15 – juris Rn. 142).
Davon ausgehend und diese Vorgaben berücksichtigend hat das Verwaltungsgericht sowohl die Umstände ermittelt und in die Abwägung eingestellt, die zugunsten des Klägers sprechen und zu einem Bleibeinteresse führen, als auch solche, die ein Ausweisungsinteresse begründen. Es ist auch mit Blick auf die Anforderungen der wertentscheidenden Grundsatznormen des Art. 6 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 GG und des Art. 8 Abs. 1 EMRK in nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gekommen, dass das Ausweisungsinteresse das Bleibeinteresse des Klägers überwiegt.
Zu berücksichtigen ist zudem bzw. im Einzelnen:
In der Rechtsprechung des EGMR ist anerkannt, dass selbst schwerwiegende Beeinträchtigungen familiärer Beziehungen nicht stets das öffentliche Interesse an einer Aufenthaltsbeendigung verdrängen. Vielmehr ist anhand der sogenannten „Boultif-Kriterien“ ein gerechter Ausgleich der gegenläufigen Interessen zu finden (vgl. z.B. U.v. 18.10.2006 – „Üner“ – juris Rn. 57 ff.). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist zu berücksichtigen, dass der vom Kläger angeführte Art. 6 GG keinen unmittelbaren Anspruch auf Aufenthalt gewährt und allein aufgrund formal-rechtlicher Bindungen ausländerrechtliche Schutzwirkungen nicht entfaltet (vgl. BVerfG, B.v. 1.12.2008 – 2 BvR 1830/08 – juris). Wie der Gerichtshof betont auch das Bundesverfassungsgericht, dass selbst gewichtige familiäre Belange sich nicht stets gegenüber gegenläufigen öffentlichen Interessen durchsetzen (z.B. 23.1.2006 – 2 BvR 1935/05 – juris Rn. 23).
Soweit es sich beim Kläger um einen „faktischen Inländer“ handeln könnte, ist weiter zu berücksichtigen:
Der Begriff „faktischer Inländer“ ist nicht einheitlich definiert, sondern wird in der Rechtsprechung unterschiedlich umschrieben. Das Bundesverwaltungsgericht bezeichnet faktische Inländer als „im Bundesgebiet geborene und aufgewachsene Kinder, deren Eltern sich hier erlaubt aufhalten“ (vgl. BVerwG, U.v. 16.7.2002, 1 C 8/02, BVerwGE 116, 378 – juris Rn. 23). Das Bundesverfassungsgericht umschreibt den Begriff mit „hier geborene bzw. als Kleinkinder nach Deutschland gekommenen Ausländer“ (vgl. BVerfG, B.v. 19.10.2016 – 2 BvR 1943/16 – juris Rn. 19; B. v. 25.8.2020 – 2 BvR 640/20 – juris Rn. 24). Bei Ausländern, die im Alter von 13 bzw. 14 Jahren eingereist waren und eine gelungene Integration in die Gesellschaft und Rechtsordnung nicht zu verzeichnen war, wurde die Stellung als „faktischer Inländer“ verneint (vgl. BayVGH, B.v. 26.11.2018 – 19 CE 17.2454 – juris Rn. 24; B.v. 7.3.2019 – 10 ZB 18.2272 – juris Rn. 10). Letztlich entbindet die Bezeichnung eines Ausländers als „faktischer Inländer“ nicht davon, die im jeweiligen Einzelfall gegebenen Merkmale der Verwurzelung zu prüfen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts besteht auch für so genannte „faktische Inländer“ kein generelles Ausweisungsverbot (vgl. BVerfG, B.v. 19.10.2016 – 2 BvR 1943/16 – juris Rn .19; B.v. 25.8.2020 – 2 BvR 640/20 – juris Rn. 24). Bei der Ausweisung im Bundesgebiet geborener Ausländer ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung der besonderen Härte, die eine Ausweisung für diese Personengruppe darstellt, in angemessenem Umfang Rechnung zu tragen. Auch nach der Rechtsprechung des EGMR bietet Art. 8 EMRK bei sogenannten „Zuwanderern der zweiten Generation“ keinen absoluten Schutz vor einer Aufenthaltsbeendigung (vgl. EGMR [Große Kammer], U.v. 18.10.2006 – 46410/99 Rn. 54 – Üner, NVwZ 2007, 1279).
Im Rahmen der Ermittlung der privaten Belange ist in Rechnung zu stellen, inwieweit der Ausländer unter Berücksichtigung seines Lebensalters in die hiesigen Lebensverhältnisse integriert ist. Als Gesichtspunkte für das Vorhandensein von anerkennenswerten Bindungen können Integrationsleistungen in persönlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht von Bedeutung sein, der rechtliche Status, die Beachtung gesetzlicher Pflichten und Verbote, der Grund für die Dauer des Aufenthalts und Kenntnisse der deutschen Sprache. Diese Bindungen des Ausländers im Inland sind in Beziehung zu setzen zu den (noch vorhandenen) Bindungen an seinen Heimatstaat. Hierzu gehört die Prüfung, inwieweit der Ausländer unter Berücksichtigung seines Lebensalters, seiner persönlichen Befähigung und seiner familiären Anbindung im Heimatland von dem Land seiner Staatsangehörigkeit bzw. Herkunft entwurzelt ist.
All dies zugrunde gelegt kommt der Senat im Rahmen einer Gesamtabwägung zu dem Ergebnis, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise die privaten Interessen des Klägers überwiegt:
Der ledige und kinderlose Kläger reiste am 5. September 1999 – also im Alter von zehn Jahren – mit seiner Mutter, seinen Großeltern und einer Tante in das Bundesgebiet aufgrund einer Aufnahmezusage als jüdischer Zuwanderer ein. Er hatte in Russland die Grundschule besucht, in Deutschland verließ er nach Wiederholung der 9. Klasse die Hauptschule mit einem regulären Hauptschulabschluss. Er absolvierte im Anschluss daran ein Berufsvorbereitungsjahr, sodann eine berufsvorbereitende Maßnahme, wurde drei Jahre in einem Ausbildungszentrum ohne Abschluss ausgebildet. Danach arbeitete er teilweise im Sicherheitsdienstbereich oder war arbeitslos. Vor seiner Festnahme und Inhaftierung am 25. September 2015 (wegen der Anlasstat) war er als Sicherheitsdienstmitarbeiter angestellt. Nach seiner probeweisen Entlassung aus der Entziehungsanstalt war er als Lagermitarbeiter tätig. Unter dem 12. Mai 2020 teilte die Bewährungshilfe der Strafvollstreckungskammer mit, der Kläger habe einen Arbeitsvertrag vorgelegt (unbefristete Tätigkeit als Lagerhelfer seit 3.2.2020, 40 Wochenstunden). Diese Umstände würdigend (durchwegs positive Integrationsmerkmale fehlen insoweit, der Kläger war/ist in mehreren Beschäftigungsverhältnissen – unterbrochen von Arbeitslosigkeit, Inhaftierung und Aufenthalt in der Entziehungsanstalt – ungelernt tätig), liegen (andererseits) in Anbetracht der von ihm begangenen Straftaten und seiner (sonstigen) Entwicklung bis zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt Anhaltspunkte für eine dauerhaft negative Einstellung gegenüber der deutschen Rechtsordnung vor. Die Anlassstraftat beruht nicht nur (wie der Kläger meint) auf einer (einmaligen) Verhaltensepisode. Der Kläger hat Körperverletzungs- und Gewaltdelikte verübt, dadurch ein hohes Aggressionspotential offenbart. Das Schutzgut der körperlichen Integrität nimmt in der Hierarchie der in den Grundrechten enthaltenen Werteordnung einen sehr hohen Rang ein und löst staatliche Schutzpflichten aus (BVerwG, U.v. 10.7.2012 – 1 C 19/11 – juris Rn. 15). Darüber hinaus gehören Delikte im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Betäubungsmitteln zu den schweren, die Grundinteressen der Gesellschaft berührenden und schwer zu bekämpfenden Straftaten (vgl. Art. 83 Abs. 1 Unterabschn. 2 AEUV). Zwar wurde der Kläger nicht wegen illegalen Drogenhandels verurteilt, allerdings stellen auch Beschaffungs-, Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikte, die im Zusammenhang mit einer Betäubungsmittelabhängigkeit stehen, eine (gleichermaßen) schwer zu bekämpfende Kriminalität dar. Es wird nicht verkannt, dass sich die streitgegenständliche Ausweisung in Anbetracht der langjährigen Aufenthaltsdauer des Klägers im Bundesgebiet (ihn als „faktischen Inländer“ zu bezeichnen liegt allerdings in Anbetracht der dargestellten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts fern; unabhängig davon prüft der Senat im Rahmen der Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Ausweisung die besonderen Härten, die sich für den Kläger aus ihr ergeben) und seiner hier bestehenden familiären und ggf. auch sozialen Bindungen (allerdings hat er keine Kinder; sonstige positive Integrationsfaktoren sind insoweit kaum ersichtlich; die angeführte Freundschaft mit dem Assistenzarzt S. hat den Kläger ersichtlich weder von seinem delinquenten Verhalten noch jedenfalls von seinen Rückfällen abhalten können; die Beziehungen zur Mutter (zeitweises Kontaktverbot) – der Vater ist ersichtlich in Russland – und zu den Großeltern sind, wie sich insbesondere aus den Anlasstaten zeigt, problembehaftet; dahinstehen kann, ob sich die jeweiligen Beziehungen verbessert haben, was nicht weiter belegt wurde, jedenfalls sind stabilisierende familiäre Verhältnisse nicht ersichtlich; auch das Verhältnis zur nunmehrigen, ebenfalls ersichtlich suchtkranken Partnerin erweist sich wie ausgeführt als nicht günstig; hinzukommen immer wieder angesprochene hohe Schulden, so dass eine wirtschaftliche Integration fern liegt, vielmehr aufgrund der eher geringen Verdienstmöglichkeiten des Klägers als ungelernter Arbeitnehmer auf legalem Wege sich die Gefahr verstärkt, – erneut – in eine Kriminalität im Zusammenhang mit Drogen abzugleiten) als gravierender Grundrechtseingriff darstellt. In Anbetracht der Delinquenz des Klägers im Zusammenhang mit seiner tiefgreifenden, weiterhin aktuellen Drogenproblematik überwiegt jedoch das Ausweisungsinteresse. Dies gilt auch in Anbetracht insbesondere des Strafaussetzungsbeschlusses des Landgerichts als positivem Prognosefaktor (verwiesen wird auf die getätigten Ausführungen). Im Übrigen haben seine im Bundesgebiet lebenden Verwandten (Mutter, Tante, Großeltern) den Kläger in der Vergangenheit nicht davon abhalten können, Drogen zu konsumieren und strafrechtlich in Erscheinung zu treten. In Anbetracht der weiterhin (wie dargelegt) bestehenden Wiederholungsgefahr ist es ihm auch zumutbar, im Land seiner Staatsangehörigkeit Fuß zu fassen und als erwachsener Mann die Kontakte zu seinen im Bundesgebiet lebenden Verwandten von dort aus aufrecht zu erhalten. Selbst wenn er keine Kontakte nach Russland mehr haben sollte (hiergegen könnte sprechen, dass er 2011 nach eigenen Angaben in Russland Urlaub machte, im letzten Strafverfahren zudem deutlich machte, dass er Dinge nur offenbare, wenn die Karten auf dem Tisch liegen), ist es ihm zumutbar, angesichts der von ihm ausgehenden Gefahren und auch seines noch nicht fortgeschrittenen Alters jedenfalls die erforderlichen Sprachkenntnisse aufzufrischen, sich dort eine Existenz aufzubauen und sich in die heimatlichen Verhältnisse zu reintegrieren. Die Beklagte hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der Kläger seine Sozialisierung in Russland erfahren hat, mit Mutter und Großeltern russisch spricht, sein Bekanntenkreis nach eigenen Angaben aus „Russen“ bestanden hat. Der russische Kulturkreis ist dem Kläger mithin nicht fremd. Durchgreifende Anhaltspunkte, warum sich bei ihm als jüdischer Emigrant stärkere Bindungen an das Bundesgebiet ergeben sollten, als bei anderen Zuwanderern bestehen im Übrigen nicht. In Anbetracht der Schwere seines delinquenten Verhaltens und der daraus resultierenden Gefahr für besonders schützenswerte Güter der Gesellschaft ist es dem Kläger zudem zumutbar, den Kontakt zu hier verbleibenden Verwandten oder Nahestehenden insbesondere über moderne Medien aufrecht zu erhalten. Jedenfalls z.B. die Mutter kann den Kläger auch besuchen. Für den Kläger sind ggf. zudem kurzfristige Betretungserlaubnisse gemäß § 11 Abs. 8 AufenthG nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Auch können ihn die Mutter, die Tante, die Großeltern oder auch sein genannter sehr guter Freund (Assistenzarzt) während der Eingewöhnungsphase unterstützen. Nämliches gilt für seine nunmehrige Partnerin. Es ist ihm ebenfalls zumutbar, den Kontakt zu ihr über moderne Medien oder Besuche aufrecht zu erhalten. Nähere Angaben betreffend das Verhältnis zur neuen Partnerin bzw. zu deren nach Vortrag volljährigen Kind (der Kläger ist nicht der Vater) hat der Kläger nicht gemacht. Wie dargelegt erscheint die Freundin jedenfalls kaum dazu beitragen zu können, die Lebensverhältnisse des Klägers zu stabilisieren.
Mithin berücksichtigt die vom Verwaltungsgericht bestätigte Ausweisung angemessen die Bindung des Klägers zu seinen benannten Bezugspersonen in Deutschland. Auch lässt unter der Annahme, dass die Ausweisung des Klägers einen Eingriff in sein durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschütztes Recht auf Familienleben bedeutet, Art. 8 Abs. 2 EMRK hier einen solchen Eingriff zu, weil er „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die… öffentliche Sicherheit“. Denn die bei der Abwägung einzustellenden Interessen von Bezugspersonen am weiteren Verbleib des Klägers im Bundesgebiet besitzen erheblich weniger Gewicht als die gegen einen weiteren Aufenthalt des Klägers im Bundesgebiet sprechenden Gründe. Bezug genommen wird insbesondere auf die bereits getätigten Ausführungen zur weiterhin bestehenden Gefährlichkeit des Klägers.
1.3 Die Dauer der Einreise- und Aufenthaltsverbotsfrist von nunmehr fünf Jahren (vgl. die durch den Beklagten mit Schriftsatz vom 12.5.2021 vorgenommene Änderung des Ausweisungs- und Befristungsbescheides mit Ermessenserneuerung) begegnet keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken.
Für einen Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, ist ein Einreise- und Aufenthaltsverbot zu erlassen (§ 11 Abs. 1 Satz 1 AufenthG), wobei in der behördlichen Befristungsentscheidung – wie hier – der konstitutive Erlass eines befristeten Einreiseverbots zu sehen ist (BVerwG, U.v. 27.7.2017 – 1 C 28.16 – juris Rn. 42; U.v. 21.8.2018 – 1 C 21/17 – juris Rn. 25). Wenn der Ausländer auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, darf die Frist fünf Jahre übersteigen und soll zehn Jahre nicht überschreiten (§ 11 Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 Satz 1 AufenthG). Über die Länge der Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbots wird nach Ermessen entschieden (§ 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG). Dies hat zur Folge, dass das Gericht die Länge der Frist grundsätzlich nur in dem durch § 114 Satz 1 VwGO vorgegebenen Rahmen überprüfen darf. Eine Fristverkürzung durch das Gericht selbst kommt also nur in Betracht, wenn eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt. In allen anderen Fällen ist zwar die Entscheidung der Verwaltungsbehörde aufzuheben, jedoch muss das Gericht der Verwaltungsbehörde erneut Gelegenheit geben, ihr Ermessen rechtsfehlerfrei auszuüben (BayVGH, U.v. 28.6.2016 – 10 B 15.1854 – juris Rn. 47; BayVGH, U.v. 12.7.2016 – 10 BV 14.1818 – juris Rn. 59 m.w.N.).
Bei der Bestimmung der Länge der Frist sind in einem ersten Schritt das Gewicht des Ausweisungsgrundes und der mit der Ausweisung verfolgte Zweck zu berücksichtigen; es bedarf einer prognostischen Einschätzung im Einzelfall, wie lange das Verhalten des Betroffenen, das der zu spezialpräventiven Zwecken verfügten Ausweisung zu Grunde liegt, das öffentliche Interesse an der Gefahrenabwehr zu tragen vermag, wie lange also die Gefahr besteht, dass der Ausländer weitere Straftaten oder andere Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung begehen wird, wobei die Umstände des Einzelfalles anhand des Gewichts des Ausweisungsgrundes zu berücksichtigen sind. In einem zweiten Schritt ist die so ermittelte Frist an höherrangigem Recht, d.h. verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen und den Vorgaben aus Art. 8 EMRK zu überprüfen und gegebenenfalls zu verkürzen; dieses normative Korrektiv bietet den Ausländerbehörden und den Gerichten ein rechtsstaatliches Mittel, um die fortwirkenden einschneidenden Folgen des Einreise- und Aufenthaltsverbots für die persönliche Lebensführung des Betroffenen zu begrenzen (BVerwG, U.v. 13.12.2012 – 1 C 14.12 – juris Rn. 14; BayVGH, U.v. 25.8.2015 – 10 B 13.715 – juris Rn. 56; BayVGH, U.v. 28.6.2016 – 10 B 15.1854 – juris Rn. 50; BayVGH, U.v. 12.7.2016 – 10 BV 14.1818 – juris Rn. 67).
Maßgeblicher Zeitpunkt für die rechtliche Bewertung der Befristungsentscheidung ist grundsätzlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung oder Entscheidung des Tatsachengerichts, hier also des Senats (BVerwG, U.v. 25.3.2015 – 1 C 18.14, BVerwGE 151, 361 Rn. 10 m.w.N.; BayVGH, U.v. 12.7.2016 – 10 BV 14.1818 – juris Rn. 61).
Dem Kläger steht im Rahmen der behördlichen Fristbestimmung grundsätzlich ein Anspruch auf fehlerfreie Ausübung des Ermessens zu. Die Beklagte hat diesen Anspruch aber durch eine fehlerfreie Ermessensausübung im Ausweisungsbescheid in seiner nunmehr gefundenen Fassung (vgl. auch die erneute Ermessensausübung im Fristreduzierungsbescheid) erfüllt. Es ist insoweit nicht zu beanstanden, dass die Beklagte eine Frist von nunmehr fünf Jahren festsetzt, weil sie – in zulässiger Weise – weiterhin (unter Beachtung der dargestellten Prüfungsschritte) von einer Wiederholungsgefahr beim Kläger ausgeht. Jedenfalls erweist sich die nunmehr festgesetzte Frist gemessen an den verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen und den Vorgaben des Art. 8 EMRK angesichts der bedrohten Rechtsgüter und der erheblichen Wiederholungsgefahr nicht als unverhältnismäßig, so dass dem Kläger mangels ersichtlicher Ermessensfehler kein Anspruch auf Verpflichtung der Beklagten, neu unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu entscheiden, zusteht. Ggf. entstehende Härten können durch die Möglichkeit der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 11 Abs. 8 AufenthG gemildert werden.
2. Die Rechtssache weist keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten auf, sodass die Berufung nicht gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO zuzulassen ist.
Besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten im Sinne dieser Vorschrift weist eine Rechtssache dann auf, wenn die Beantwortung der für die Entscheidung erheblichen Fragen in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht voraussichtlich das durchschnittliche Maß nicht unerheblich überschreitende Schwierigkeiten bereitet, wenn sie sich also wegen der Komplexität und abstrakten Fehleranfälligkeit aus der Mehrzahl der verwaltungsgerichtlichen Verfahren heraushebt (BayVGH, B.v.10.4.2017 – 15 ZB 16.673 – juris Rn. 42 m.w.N.). Für die Darlegung der besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten genügt dabei die allgemeine Behauptung eines überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrads nicht. Vielmehr ist erforderlich, dass sich der Kläger mit dem verwaltungsgerichtlichen Urteil substantiell auseinandersetzt und im Einzelnen darlegt, hinsichtlich welcher aufgrund der erstinstanzlichen Entscheidung auftretenden Fragen sich besondere tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten ergeben sollen (BayVGH, B.v. 2.5.2011 – 8 ZB 10.2312 – juris Rn. 21 m.w.N.).
Davon ausgehend bietet der Sachverhalt keine besonderen tatsächlichen Schwierigkeiten. Der Kläger trägt (pauschal) vor, die Schwierigkeit der Rechtssache folge daraus, dass sich die Beklagte auf Persönlichkeitsdefizite des Klägers gestützt habe, ohne diese sachverständig aufzuklären und obwohl diese in einem eindeutigen Widerspruch zu dem Gutachten des Sachverständigen Dr. S. stehen. Aufgrund des medizinisch relevanten Kausalzusammenhangs zwischen einer Erkrankung und dem Bescheid zugrundeliegenden wesentlichen strafrechtlichen Vorwurf sei die Sachlage besonders schwierig. Unabhängig davon, ob der Kläger mit diesem Vortrag im Hinblick auf die Frage, ob die Rechtssache besondere tatsächliche Schwierigkeiten aufweist, dem Darlegungsgebot des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO genügt, bietet der Sachverhalt keine besonderen tatsächlichen Schwierigkeiten. Die zur Beurteilung der Frage, ob gegen den Kläger rechtmäßig eine Ausweisung wie verfügt ausgesprochen werden kann, erforderlichen Tatsachen haben die Beklagte und das Verwaltungsgericht hinreichend ermittelt. Sie ergeben sich zudem aus den bis zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt eingetretenen hinzukommenden Umständen. Auch hebt sich das Verfahren nicht in der dargestellten Weise aus der Mehrzahl der verwaltungsgerichtlichen Verfahren betreffend Ausweisungen heraus.
Ebenso wenig liegt eine besondere rechtliche Schwierigkeit der Rechtssache vor. Eine Rechtssache weist (neben den genannten Voraussetzungen) besondere rechtliche Schwierigkeiten auf, wenn eine kursorische, aber sorgfältige, die Sache überblickende Prüfung der Erfolgsaussichten einer Berufung keine hinreichend sichere Prognose über den Ausgang des Rechtsstreits erlaubt. Die Offenheit des Ergebnisses charakterisiert die besondere rechtliche Schwierigkeit und rechtfertigt – insbesondere zur Fortentwicklung des Rechts – die Durchführung des Berufungsverfahrens. Dabei ist der unmittelbare sachliche Zusammenhang des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO mit Abs. 2 Nr. 1 VwGO in den Blick zu nehmen (vgl. Happ in Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 124 Rn. 16, 25, 27).
Davon ausgehend erlaubt die Prüfung der Erfolgsaussichten einer Berufung hier die Prognose, dass diese zurückzuweisen wäre. Da die vom Kläger vorgebrachten ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des Urteils nicht bestehen, ist die Rechtssache im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO rechtlich nicht besonders schwierig. Die Voraussetzungen für den Erlass einer Ausweisungsverfügung sind durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts geklärt. Die Frage, ob die Delinquenz des Klägers unter Würdigung aller ihn betreffenden Umstände dessen Ausweisung rechtfertigt, kann aufgrund der dem Senat vorgelegten behördlichen und gerichtlichen Akten beantwortet werden. Die Beantwortung der für die Entscheidung erheblichen Fragen bereitet in rechtlicher Hinsicht mithin nicht das durchschnittliche Maß nicht unerheblich überschreitende Schwierigkeiten. Soweit der Kläger vorträgt, die Schwierigkeit der Rechtssache folge daraus, dass sich die Beklagte auf Persönlichkeitsdefizite des Klägers gestützt habe, ohne diese sachverständig aufzuklären und obwohl diese in einem eindeutigen Widerspruch zu dem Gutachten des Sachverständigen Dr. S. stünden, zudem auf den medizinisch relevanten Kausalzusammenhang zwischen einer Erkrankung und den dem Bescheid zugrundeliegenden wesentlichen strafrechtlichen Vorwurf hinweist, bereiten (unabhängig von der Frage, ob der Kläger den Anforderungen des Darlegungsgebotes im Sinne des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO genügt) die vom Kläger aufgeworfenen Fragen keine das durchschnittliche Maß nicht unerheblich überschreitende Schwierigkeiten. Sie betreffen vielmehr Konstellationen, die in einer Vielzahl von Ausweisungsverfahren zu bearbeiten sind und ohne Zulassung einer Berufung gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO geklärt werden können.
3. Die Rechtssache hat nicht die grundsätzliche Bedeutung (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO), die der Kläger ihr zumisst.
Die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache setzt voraus, dass für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eine konkrete, jedoch fallübergreifende Rechts- oder Tatsachenfrage von Bedeutung ist, deren noch ausstehende obergerichtliche Klärung im Berufungsverfahren zu erwarten ist und zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder zu einer bedeutsamen Weiterentwicklung des Rechts geboten erscheint. Dementsprechend verlangt die Darlegung (§ 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO) der rechtsgrundsätzlichen Bedeutung, dass eine konkrete Rechts- oder Tatsachenfrage formuliert und aufgezeigt wird, weshalb die Frage im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder der Fortentwicklung des Rechts klärungsbedürftig und entscheidungserheblich (klärungsfähig) ist; ferner muss dargelegt werden, worin die allgemeine, über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung dieser Frage besteht (stRspr., vgl. BayVGH, B.v. 12.4.2019 – 10 ZB 19.275 – juris Rn. 7; B.v. 8.9.2019 – 10 ZB 18.1768 – Rn. 11; B.v. 14.2.2019 – 10 ZB 18.1967 – juris Rn. 10; BayVGH, B.v. 17.12.2015 – 10 ZB 15.1394 – juris Rn. 16 m.w.N.); Happ in Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 124a Rn. 72). Klärungsbedürftig sind solche Rechts- oder Tatsachenfragen, deren Beantwortung zweifelhaft ist oder zu denen unterschiedliche Auffassungen vertreten werden und die noch nicht oder nicht hinreichend ober- und höchstrichterlich geklärt sind (vgl. BVerfG, B.v. 28.4.2011 – 1 BvR 3007/07 – juris Rn. 21; Roth in Posser/Wolff, BeckOK, VwGO, Stand 1.1.2019, § 124 Rn. 55 m.w.N.; Happ in Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 124 Rn. 38). Ein derartiger Klärungsbedarf besteht nicht, wenn die Rechtsfrage bereits geklärt ist oder auf der Grundlage der bestehenden Rechtsprechung mit Hilfe der anerkannten Auslegungsregeln auch ohne Durchführung eines Berufungsverfahrens beantwortet werden kann (stRspr., BVerwG, B.v. 9.4.2014 – 2 B 107.13 – juris Rn. 9 m.w.N.; BVerfG, B.v. 29.7.2010 – 1 BvR 1634/04 – juris Rn. 64).
Die vom Kläger aufgeworfene Frage, „ob eine Vorrangprüfung des § 11 Abs. 2 Satz 4 AufenthG jedenfalls dann grundsätzlich immer erforderlich ist, wenn es sich um einen faktischen Inländer handelt und die den Ausweisungsanlass bildende Straftat auf einem Hang beruhte, Drogen im Übermaß zu konsumieren und die Ausländerbehörde nachweisen muss, dass sie eine kürzere Sperrfrist für den Fall des Nachweises der Bedingung geprüft hat und gegebenenfalls eine gestaffelte Sperrfrist festsetzen“, rechtfertigt die Zulassung der Berufung gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO schon deshalb nicht, weil diese Ausführungen den Anforderungen des Darlegungsgebots gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO nicht genügen. Unterstellt, der Kläger meint § 11 Abs. 2 Satz 5 AufenthG statt § 11 Abs. 2 Satz 4 AufenthG, weiter unterstellt, der Kläger könnte als sogenannter faktischer Inländer (was in Anbetracht der dargelegten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts fern liegt) bezeichnet werden, handelt es sich bei § 11 Abs. 2 Satz 5 AufenthG jedenfalls um eine Ermessensvorschrift, deren Anwendung jeweils bezogen auf den betreffenden Einzelfall zu prüfen ist (vgl. BayVGH, U.v. 12.7.2016 – 10 BV 14.1818 – juris Rn. 72, 82; Dollinger in Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 13. Auflage 2020, § 11 AufenthG Rn. 50). Mithin steht es im jeweiligen fallbezogenen Ermessen der Ausländerbehörde, ob insoweit eine Befristungsentscheidung mit einer derartigen Bedingung versehen wird.
Soweit der Kläger weiter die Frage aufwirft, „ob im Falle einer spezialpräventiv begründeten Ausweisung der Tatbestand des § 53 Abs. 1 AufenthG die Feststellung einer individuellen Polizeigefahr, die von dem Betroffenen ausgeht, festgestellt werden muss“, und dazu ausführt, das Verwaltungsgericht habe den Rechtssatz aufgeworfen, dass die Ausweisung nur dann rechtswidrig wäre, wenn eine „positive Sicherheitsprognose“ gestellt werden könne, dies stelle eine Umkehr der Grundsätze im Polizeirecht dar, das Verwaltungsgericht unternehme eine Gefahrindizierung, indem es davon ausgehe, dass aus einer vorangegangenen Verurteilung eine Gefährlichkeit als fortbestehend zu unterstellen sei, die nur durch eine „positive Sicherheitsprognose“ widerlegt werden könne, rechtfertigt dieser Vortrag die Zulassung der Berufung ebenso wenig. Die vom Kläger behauptete Klärungsbedürftigkeit der Frage ist nicht gegeben. Denn die Rechtsfrage kann (worauf die Beklagte zu Recht hinweist) auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bzw. des Gesetzeswortlauts mit Hilfe der üblichen Auslegungsregeln eindeutig beantwortet werden. Zudem hat das Verwaltungsgericht (bereits deshalb fehlt es an der Entscheidungserheblichkeit der aufgeworfenen Frage) in seinem Urteil vom 27. November 2019 (den genannten Vorgaben genügend) zum einen durch die Bezugnahme auf den Beschluss vom 16. Juni 2017 (AN 5 S 16.02236) und zum anderen ausdrücklich (Seite 9 des Urteils) ausgeführt, dass beim Kläger „auch gegenwärtig von einer erheblichen Wiederholungsgefahr auszugehen“ ist. Die vom Verwaltungsgericht (Seite 8 des Urteils) gewählte Formulierung, es sei im vorliegenden Fall, trotz der Tatsache, dass die Unterbringung des Klägers im Maßregelvollzug mittlerweile – nach zwei Jahren und sieben Monaten – beendet ist, der Kläger in der mündlichen Verhandlung einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Beginn zum 4. November 2019 und einer sechsmonatigen Probezeit vorgelegt hat und es bisher nicht zu weiteren Regelverstößen gekommen ist, nicht von einer positiven Sicherheitsprognose betreffend den Kläger für den Zeitraum, der über die Dauer der Bewährung hinausgeht und der für das Ausweisungsverfahren maßgeblich ist, auszugehen, versteht sich im Zusammenhang mit der Problematik, ob vom Kläger eine Wiederholungsgefahr ausgeht. Durchgreifende Anhaltspunkte dafür, dass das Verwaltungsgericht (wie der Kläger meint) eine Umkehr der Grundsätze im Polizeirecht formulieren wollte und eine Gefahrindizierung vorgenommen hat, liegen nicht vor.
4. Auch die Voraussetzungen für die Zulassung einer Berufung gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO liegen nicht vor. Nach § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO ist die Berufung zuzulassen, wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht.
Die Darlegung einer Divergenz nach § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO erfordert, dass ein inhaltlich bestimmter, die angefochtene Entscheidung tragender Rechts- oder Tatsachensatz bezeichnet wird, mit dem die Vorinstanz von einem in der Rechtsprechung eines übergeordneten Gerichts aufgestellten ebensolchen entscheidungstragenden Rechts- oder Tatsachensatzes in Anwendung derselben Rechtsvorschrift abgewichen ist. Die divergierenden Sätze sind einander so gegenüber zu stellen, dass die Abweichung erkennbar wird (vgl. z.B. BayVGH, B.v. 30.8.2019 – 10 ZB 19.1519 – juris Rn. 3 m.w.N.).
Der Kläger benennt als tragenden Rechts- oder Tatsachensatz im Urteil des Divergenzgerichts (BVerfG, B.v. 19.10.2016 – 2 BvR 1941/16, Rn. 24): „Wiegt das Bleibeinteresse des Ausländers besonders schwer, so wird sich nach einer Strafaussetzungsentscheidung der Strafvollstreckungskammer eine relevante Wiederholungsgefahr nur dann bejahen lassen, wenn die ausländerrechtliche Entscheidung auf einer breiteren Tatsachengrundlage als derjenigen der Strafvollstreckungskammer getroffen wird, etwa wenn Ausländerbehörde oder Gericht ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben haben, welches eine Abweichung zulässt oder wenn die vom Ausländer in der Vergangenheit begangenen Straftaten fortbestehende konkrete Gefahren für höchste Rechtsgüter erkennen lassen. (…) Für die Annahme fortbestehender konkreter Gefahren für höchste Rechtsgüter hätte es konkreter Feststellungen zu den vom Beschwerdeführer drohenden Straftaten bedurft“.
Dem stellt der Kläger als nach Behauptung divergierenden Satz des Verwaltungsgerichts gegenüber:
„… Trotz des Strafaussetzungsbeschlusses des Landgerichts A. (…) demnach, insbesondere im Hinblick auf die Schwere der abgeurteilten Tat und den Rang der durch die verübte Straftat gefährdeten Rechtsgüter der körperlichen Unversehrtheit, aufgrund des erheblichen Legalbewährungsdrucks, nämlich, dass ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen der Bewährung zur Folge hätte, und der kurzen Zeit nach Beendigung des Maßregelvollzugs, auch gegenwärtig von einer erheblichen Wiederholungsgefahr auszugehen (ist).“
Davon ausgehend ist aus der Gegenüberstellung der nach Behauptung divergierenden Sätze das Vorliegen einer Abweichung nicht erkennbar. Zu Recht weist die Beklagte darauf hin, dass der Kläger insoweit der Sache nach ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils geltend macht, indem er darlegt, weshalb das Verwaltungsgericht bei Beachtung des angeführten Rechtssatzes des Bundesverfassungsgerichts – seiner Auffassung nach – zu einer anderen rechtlichen Bewertung hätte gelangen müssen. Diese rechtlichen Zweifel liegen nicht vor. Im Übrigen ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Zitate nicht, dass das Verwaltungsgericht von der benannten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abgewichen ist. Das Verwaltungsgericht hat sich im Urteil vom 27. November 2016 mit dem Strafaussetzungsbeschluss des Landgerichts auseinandergesetzt und (auch unter Bezugnahme auf den im Eilverfahren ergangenen Beschluss) dargelegt, warum es dennoch eine relevante Widerholungsgefahr bejaht. Zudem ist auszuführen, dass zum (wie dargelegt) entscheidungserheblichen Zeitpunkt der Senat in der hiesigen Entscheidung sich ausführlich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auseinandersetzt und nach dessen Maßgaben darlegt, dass die ausländerrechtliche Entscheidung auf einer breiteren Tatsachengrundlage als derjenigen der Strafvollstreckungskammer beruht. Zusätzlich ist in den Blick zu nehmen, dass der Kläger rückfällig geworden ist, was die bei ihm gegebene fortwährende tiefgreifende Drogenproblematik belegt. Auch unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall maßgeblich dadurch, dass der dort betroffene Ausländer eine Drogentherapie erfolgreich abgeschlossen hatte. Trotz vorangegangener Therapien in der Vergangenheit kann der Kläger auch aufgrund der nunmehr eingetretenen Ereignisse nicht vorweisen, dass eine (formal abgeschlossene) Drogentherapie erfolgreich war. Auch daraus ergibt sich (wie unter Nr. 1 dargestellt), dass vom Kläger weiterhin eine Wiederholungsgefahr ausgeht. Wie dargelegt ist die durch die Delinquenz indizierte Gefährlichkeit des Klägers auch aufgrund der neueren Entwicklungen bis zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt bislang nicht beseitigt. Da die Straftaten des Klägers jedenfalls im Zusammenhang mit einer Suchterkrankung stehen, kann nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs (wie dargelegt) von einem Wegfall der für die Ausweisung erforderlichen Wiederholungsgefahr nicht ausgegangen werden, solange der Ausländer nicht eine Drogentherapie erfolgreich abgeschlossen hat und die damit verbundene Erwartung eines künftig drogen- und straffreien Verhaltens auch nach Therapieende glaubhaft gemacht hat. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, die vom Kläger durchgeführte Therapie ist in diesem Sinne jedenfalls auch unter dem Eindruck der Rückfallereignisse als erfolglos anzusehen.
Nicht erforderlich ist es im Übrigen, zur Zulassung einer Abweichung von der Strafaussetzungsentscheidung der Strafvollstreckungskammer im Hinblick auf die Bejahung einer relevanten Wiederholungsgefahr ein Sachverständigengutachten einzuholen. Denn bei der Prognoseentscheidung zur Wiederholungsgefahr bewegt sich das Gericht regelmäßig in Lebens- und Erkenntnisbereichen, die Gerichten allgemein zugänglich sind. Gerade die Frage der Wiederholungsgefahr nach strafrechtlichen Verurteilungen kann daher grundsätzlich von den Gerichten im Wege einer eigenständigen Prognose ohne Zuziehung eines Sachverständigen beurteilt werden (stRspr., BVerwG, U.v. 13.12.2012 – 1 C 20/11 – juris Rn. 23; BayVGH, B.v. 10.10.2017 – 19 ZB 16.2636 – juris Rn. 36; B.v. 8.11.2017 – 10 ZB 16.2199 – juris Rn. 7 m.w.N.). Eine Ausnahme kommt danach nur in Betracht, wenn die Prognose die Feststellung oder Bewertung von Umständen voraussetzt, für die eine dem Richter nicht zur Verfügung stehende Sachkunde erforderlich ist, wie es z.B. bezüglich der Frage des Vorliegens oder der Auswirkungen eines seelischen Leidens der Fall sein kann (vgl. BVerwG, B.v. 4.5.1990 – 1 B 82/89 – juris Rn. 7; U.v. 4.10.2012 – 1 C 13.11 – juris Rn. 5), wobei ein Sachverständigengutachten die Prognoseentscheidung des Tatrichters nicht ersetzen, sondern nur Hilfestellung bieten kann (BVerwG, U.v. 13.3.2009 – 1 B 20.08 – juris Rn. 5). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Insbesondere steht die Suchtmittelabhängigkeit des Klägers und deren symptomatischer Zusammenhang mit den Anlasstaten fest; dies wird vom Kläger auch nicht bestritten. In den Blick zu nehmen ist zudem, dass die jeweiligen Erkenntnisse der Gutachter L. und Dr. S. weiter herangezogen werden können. Insbesondere sind die vorsichtigen Beurteilungen des Dr. S. aufgrund der neu aufgetretenen Umstände einer neuen tatrichterlichen Würdigung zugänglich.
5. Ein Zulassungsgrund nach § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO liegt ebenfalls nicht vor.
Gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO ist die Berufung zuzulassen, wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.
Der Kläger trägt vor, das Urteil sei nicht ausreichend begründet. Die Vorschrift des § 117 Abs. 5 VwGO erlaube keinen Verweis auf frühere Beschlüsse. Es sei nicht klar, was Gegenstand der Urteilsbegründung sein solle. Der vorangegangene Beschluss im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes vom 16. Juni 2017 enthaltene nur eine summarische Prüfung und umfasse Fragen zu § 80 Abs. 5 VwGO, die nicht die Fragen der Hauptsache beträfen. Auch verhalte sich der Beschluss zu wesentlichen Fragen nicht.
Dies zugrunde gelegt hat das Verwaltungsgericht sein Urteil ausreichend mit Entscheidungsgründen im Sinne des § 117 Abs. 2 Nr. 5 VwGO versehen. Zwar ermöglicht § 117 Abs. 5 VwGO den Wortlaut nach (lediglich) die Möglichkeit der Bezugnahme auf angefochtene Bescheide. Eine Bezugnahme auf eine vorangegangene Entscheidung (wie hier einen Beschluss im vorläufigen Rechtsschutzverfahren) des Verwaltungsgerichts ist jedoch zulässig (BVerwG, U.v. 17.12.1997 – 2 B 103.97 – juris). Dadurch bleibt grundsätzlich die Funktion der schriftlichen Gründe gewahrt, deutlich zu machen, dass das Gericht alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt und sich mit ihnen auseinandergesetzt hat (vgl. Stuhlfauth in Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth/v. Albedyll, VwGO, 7. Aufl. 2018, § 117 Rn. 22).
Diesen Vorgaben genügt das Urteil des Verwaltungsgerichts. Davon ausgehend, dass jedenfalls ein Kern der Begründung sich aus dem Urteil ergeben muss (Stuhlfauth a.a.O. Rn. 22) hat die Kammer ausreichend einen Tatbestand formuliert und nachvollziehbar unter Bezugnahme auf den Ausweisungsbescheid der Beklagten und den gerichtlichen Beschluss vom 16. Juni 2017 (AN 5 S 16.02236) dargelegt, dass die Ausweisungsverfügung rechtmäßig ist und den Kläger nicht in seinen Rechten verletzt. Es hat weiterhin sich an den Beschluss im Eilverfahren anschließende Entwicklungen, insbesondere den Beschluss der Strafvollstreckungskammer vom 15. Januar 2019 (sowie die zugrundeliegenden Stellungnahmen des Sachverständigen Dr. S. sowie des Bezirksklinikums A.) dargestellt und gewürdigt, zudem sich mit der Frage der Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots auseinandergesetzt. Bei verständiger Würdigung sind die Ausführungen im Urteil des Verwaltungsgerichts auch unter dem Blickwinkel ausreichend, dass der Beschluss der Kammer vom 6. Juni 2017 ein Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes (aber auch der Prozesskostenhilfe) betraf.
Auch soweit der Kläger einen „Verstoß gegen § 86 VwGO“ vorträgt, liegt der Zulassungsgrund des § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO nicht vor.
Soweit der Kläger meint, das Verwaltungsgericht habe seinen Beweisantrag auf Einvernahme des Herrn S. als sachverständigen Zeugen zum Beweis der Tatsache, dass beim Kläger keine Gefahr der Begehung von Straftaten bestehe und dieser keine psychische Labilität vorweise und sich ernsthaft von jeglichem Drogenkonsum und Kontakt zur Betäubungsmittelszene dauerhaft distanziert habe, verfahrensfehlerhaft abgelehnt, greift diese Rüge nicht durch.
Aus dem Zulassungsvorbringen ergibt sich nicht, dass die Ablehnung des Beweisantrags verfahrensfehlerhaft erfolgt ist. Die Ablehnung eines förmlichen (unbedingt gestellten) Beweisantrags ist nur dann verfahrensfehlerhaft, wenn sie im Prozessrecht keine Stütze findet (BVerwG, B.v. 14.8.2017 – 9 B 4.17 – juris Rn. 6). Das Verwaltungsgericht hat den Antrag in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich und begründet beschieden (vgl. § 86 Abs. 2 VwGO). Auch die Begründung der Ablehnung durch das Verwaltungsgericht, der Einvernahme des Zeugen S. bedürfe es nicht, da dem Gericht in Hinblick auf die unter Beweis gestellten Tatsachen zum Gesundheitszustand und zur persönlichen Entwicklung des Klägers bereits ein aktuelles Gutachten und Stellungnahmen der behandelnden Ärzte bzw. der Therapieeinrichtung vorliegen und nicht dargelegt ist, welche zusätzlichen Erkenntnisse durch die Einvernahme des mit den Kläger befreundeten Zeugen gewonnen werden können, und soweit sich der Beweisantrag auf die subjektiven Wahrnehmungen, Überlegungen und Erwartungen des Zeugen beziehe, seien diese einer Beweiserhebung schon nicht zugänglich, ist nicht zu beanstanden. Ein Beweisantrag setzt die Behauptung einer hinreichend bestimmten Beweistatsache voraus. Richtet sich der Beweisantrag auf die Vernehmung eines Zeugen (auch der sachverständige Zeuge ist Zeuge), so muss der Sachverhalt angegeben werden, der in das Wissen des Zeugen gestellt wird. Es ist mithin eine bestimmte Behauptung über das Vorhandensein (Vorliegen) einer Tatsache aufzustellen (vgl. BGH, B.v. 3.11.2011 – 1 StR 497/10- juris Rn. 11; Vierhaus, Beweisrecht im Verwaltungsprozess, München 2011, Rn. 55). Diesen Anforderungen genügt der gestellte Beweisantrag nicht. Er ist nicht auf den Beweis einer Tatsache, sondern auf eine dem Gericht vorbehaltene und der Beweiserhebung nicht zugängliche rechtliche Würdigung gerichtet und deshalb unzulässig (vgl. auch BayVGH, B.v. 13.5.2019 – 19 ZB 18.1039 Rn.36). Auch legt der Kläger insoweit die Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht (hinreichend) dar.
Die Berufung ist auch nicht wegen eines Verfahrensmangels nach § 124 Abs. 4 Nr. 5 VwGO wegen der Ablehnung des weiteren Beweisantrags auf Einholung eines forensischen Sachverständigengutachtens durch Dr. R. oder eines anderen, vom Verwaltungsgericht zu bestimmenden Sachverständigen zum Beweis der Tatsache, dass vom Kläger kein Rückfallrisiko hinsichtlich des Konsums von Rausch- bzw. Betäubungsmitteln ausgehe und die Begehung von Straftaten nicht zu erwarten sei, zuzulassen. Das Verwaltungsgericht hat den Beweisantrag mit der Begründung abgelehnt, es bedürfe der Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht, da dem Gericht mit dem aktuellen Sachverständigengutachten von Dr. S., den Stellungnahmen der behandelnden Ärzte und Therapeuten und dem Bericht der Therapieeinrichtung der Verlauf der Therapie des Klägers substantiiert dargestellt worden sei und dem Gericht damit die notwendigen sachlichen Grundlagen für die Prognoseentscheidung zur Wiederholungsgefahr vorlägen.
Der Kläger hat nicht hinreichend dargelegt, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) im verwaltungsgerichtlichen Verfahren verletzt worden ist oder ein Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 86 Abs. 1, 2 VwGO) durch das Verwaltungsgericht vorliegt. Eine Verletzung von § 86 Abs. 2 VwGO liegt nicht vor, weil das Verwaltungsgericht den vom Kläger in der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisantrag durch einen mit Gründen versehenen Beschluss abgelehnt hat. Soweit der Kläger vorbringt, der Beweisantrag sei zu Unrecht abgelehnt worden, trifft dies nicht zu.
Die Frage, ob von einem Ausländer eine Wiederholungsgefahr ausgeht, ist eine rechtliche Frage. Bei der Prognoseentscheidung zur Wiederholungsgefahr bewegt sich das Gericht regelmäßig in Lebens- und Erkenntnisbereichen, die Gerichten allgemein zugänglich sind. Gerade die Frage der Wiederholungsgefahr nach strafrechtlichen Verurteilungen kann daher (wie bereits dargelegt) grundsätzlich von Gerichten im Wege einer eigenständigen Prognose ohne Zuziehung eines Sachverständigen beurteilt werden (stRspr., BVerwG, U.v. 13.12.2012 – 1 C 20/11 – juris Rn. 23; BayVGH, B.v. 10.10.2017 – 19 ZB 16.2636 – juris Rn. 36; B.v. 8.11.2017 – 10 ZB 16.2199 – juris Rn. 7 m.w.N.). Eine Ausnahme kommt danach nur in Betracht, wenn die Prognose die Feststellung oder Bewertung von Umständen voraussetzt, für die eine dem Richter nicht zur Verfügung stehende Sachkunde erforderlich ist, wie es z.B. bezüglich der Frage des Vorliegens oder der Auswirkungen eines seelischen Leidens der Fall sein kann (BVerwG, B.v. 4.5.1990 – 1 B 82/89 – juris Rn. 7). Ein solcher Fall, bei dem ein Sachverständigengutachten ausnahmsweise als Hilfestellung in Betracht kommt (ohne die Prognoseentscheidung des Tatrichters zu ersetzen, BVerwG, U.v. 13.3.2009 – 1 B 20.08 – juris Rn. 5) liegt nicht vor. Anhaltspunkte dafür, dass die tatrichterliche Prognose hier nicht ohne spezielle fachliche Kenntnisse erstellt werden könnte (BVerwG, U.v. 4.10.2012 – 1 C 13.11 – juris Rn. 5) liegen nicht vor. Insbesondere steht die Suchtmittelabhängigkeit des Klägers und deren symptomatischer Zusammenhang mit den Anlasstaten fest; dies wird vom Kläger auch nicht bestritten.
Wegen des Grundsatzes der einheitlichen Kostenentscheidung ist diese sowie die Streitwertfestsetzung der Instanz abschließenden Entscheidung im Verfahren 19 ZB 21.1377 vorbehalten.
Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO).
Mit der Ablehnung des Antrags auf Zulassung der Berufung wird das angefochtene Urteil (mit der sich aus Nr. I dieses Beschlusses ergebenden Einschränkung) rechtskräftig (§ 124a Abs. 5 Satz 4 VwGO).