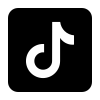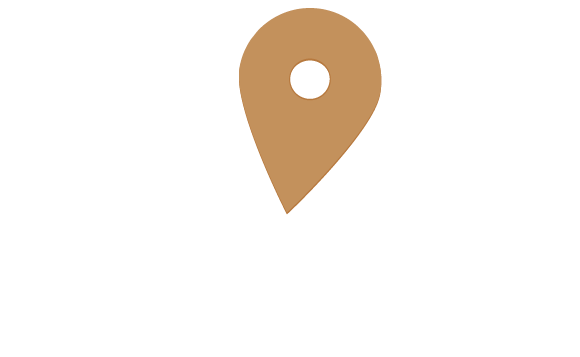Aktenzeichen M 12 K 13.2743, M 12 K 13.5369
Leitsatz
1 Ein Dienstunfall ist dann als wesentliche Ursache im Rechtssinne anzuerkennen, wenn er bei natürlicher Betrachtungsweise entweder überragend zum Erfolg (Körperschaden) beigetragen hat oder zumindest annähernd die gleiche Bedeutung für den Eintritt des Schadens hatte wie die anderen Umstände insgesamt (ebenso BVerwG BeckRS 1988, 31272685). (redaktioneller Leitsatz)
2 Löst ein Unfallereignis ein bereits vorhandenes Leiden aus oder beschleunigt oder verschlimmert es dieses, so ist das Unfallereignis dann nicht wesentliche Ursache für den Körperschaden, wenn das Ereignis von untergeordneter Bedeutung gewissermaßen „der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte“ bei einer Krankheit, „die ohnehin ausgebrochen wäre, wenn ihre Zeit gekommen war“. (redaktioneller Leitsatz)
3 Der Beamte trägt die materielle Beweislast, sowohl für das Vorliegen des behaupteten Körperschadens als auch dafür, dass die Schädigungsfolge wesentlich auf den Dienstunfall und nicht etwa auf eine anlagebedingte Konstitution zurückzuführen ist (hier: keine sicheren Hinweise darauf, dass nicht von einem regelrechten Heilungsverlauf einer unfallbedingten HWS-Distorsion auszugehen ist). (redaktioneller Leitsatz)
4 Zur Beweiswürdigung vielfacher Sachverständigengutachten zu Körperschäden auf Hals-Nasen-Ohren-fachärztlichem, orthopädischem/radiologischem, neurochirurgischem, neurologischem, neuropsychologischem sowie algesiologischem/psychiatrischem Fachgebiet bei durch Auffahrunfall erlittener HWS-Distorsion und gleichzeitiger Diagnose einer veranlagungsbedingten Osteochondrose (Knochen- und Knorpeldegeneration) im Halswirbelbereich. (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
I.
Die Klagen werden abgewiesen.
II.
Der Kläger hat die Kosten der Verfahren zu tragen.
III.
Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Gründe
Die Entscheidung kann ohne weitere mündliche Verhandlung ergehen, da die Beteiligten dem zugestimmt haben (§ 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO).
Die Klagen sind zulässig, aber unbegründet.
Der Kläger hat weder einen Anspruch auf Anerkennung weiterer Körperschäden als Folge des Dienstunfalls am 16. Oktober 1997 noch auf Gewährung von Unfallausgleich und/oder Unfallruhegehalt (§ 113 Abs. 5 VwGO).
Streitgegenstand der Verpflichtungsklagen in Gestalt der Versagungsgegenklage ist der jeweilige Anspruch des Klägers; der jeweilige Ablehnungsbescheid in der Gestalt des Widerspruchsbescheids hat für die Begründetheit der Verpflichtungsklage keine eigenständige Bedeutung (vgl. Happ in Eyermann, VwGO, 13. Aufl. 2010, § 42 Rn. 29).
Auf die vorliegenden Verpflichtungsklagen ist das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) anzuwenden. Denn nach Art. 100 Abs. 4 Satz 1 BayBeamtVG steht für die am 31. Dezember 2010 vorhandenen Unfallfürsorgeberechtigten ein vor dem 1. Januar 2011 erlittener Dienstunfall im Sinn des Beamtenversorgungsgesetzes in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung dem Dienstunfall im Sinn des Beamtenversorgungsgesetzes gleich. Diese Voraussetzungen liegen hier vor, weil der am 16. Oktober 1997 erlittene Dienstunfall des Klägers mit Bescheid vom 13. November 1997 gem. § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG anerkannt wurde.
I.
Der Kläger hat keinen Anspruch auf Anerkennung weiterer Körperschäden als Folge des Dienstunfalls am 16. Oktober 1997.
Nach der Legaldefinition des Art. 46 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) ist ein Dienstunfall ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder als Folge des Dienstes eingetreten ist. Als Folgen eines Dienstunfalls können nur Körperschäden anerkannt werden, die durch diesen verursacht wurden.
Ein äußeres, den Dienstunfall verursachendes Ereignis kann dabei nicht nur ein physisch auf den Körper des Beamten einwirkendes Ereignis sein, sondern auch ein solches, das nur mittelbar krankhafte Vorgänge im Körper auslöst, etwa durch die Verursachung eines seelischen Schocks (vgl. BVerwG, U. v. 9.4.1970 – juris Rn. 14). Unter einem Körperschaden im Sinne des Dienstunfallrechts ist jede über Bagatelleinbußen hinausgehende Verletzung der körperlichen oder seelischen Integrität zu verstehen, mithin auch eine als Folge einer Traumatisierung eingetretene seelische Erkrankung (vgl. BVerwG, U. v. 29.10.2009 – 2 C 134.07 – juris Rn. 24).
Als Ursachen im Rechtssinne auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Dienstunfallversorgung sind nur solche für den eingetretenen Schaden ursächlichen Bedingungen im naturwissenschaftlich-philosophischen (natürlich-logischen) Sinne anzuerkennen, die wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg nach natürlicher Betrachtungsweise zu dessen Eintritt wesentlich beigetragen haben. Der Ursachenzusammenhang ist nicht schon dann ausgeschlossen, wenn außer dem Unfall auch andere Umstände (namentlich eine anlage- oder schicksalsbedingte Krankheit oder ein anderes Unfallereignis) als Ursachen in Betracht kommen. In derartigen Fällen ist der Dienstunfall vielmehr dann als wesentliche Ursache im Rechtssinne anzuerkennen, wenn er bei natürlicher Betrachtungsweise entweder überragend zum Erfolg (Körperschaden) beigetragen hat oder zumindest annähernd die gleiche Bedeutung für den Eintritt des Schadens hatte wie die anderen Umstände insgesamt (vgl. BVerwG, U. v. 7.5.1999 – 2 B 117/98 – juris).
Löst ein Unfallereignis ein bereits vorhandenes Leiden aus oder beschleunigt oder verschlimmert es dieses, so ist das Unfallereignis dann nicht wesentliche Ursache für den Körperschaden, wenn das Ereignis von untergeordneter Bedeutung gewissermaßen „der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte“ bei einer Krankheit, „die ohnehin ausgebrochen wäre, wenn ihre Zeit gekommen war“. Das Unfallereignis tritt dann im Verhältnis zu der schon gegebenen Bedingung (dem vorhandenen Leiden oder der krankhaften Veranlagung) derartig zurück, dass die bereits gegebene Bedingung als allein maßgeblich anzusehen ist. Nicht Ursache im Rechtssinn sind demgemäß sogenannte Gelegenheitsursachen, d. h. Ursachen, bei denen zwischen dem eingetretenen Schaden und dem Dienst eine rein zufällige Beziehung besteht, d. h. wenn die krankhafte Veranlagung oder das anlagebedingte Leiden so leicht ansprechbar waren, dass es zur Auslösung akuter Erscheinungen nicht besonderer, in ihrer Eigenart unersetzlicher Einwirkungen bedurfte, sondern auch ein anderes alltäglich vorkommendes Ereignis denselben Erfolg herbeigeführt hätte (vgl. BVerwG, U. v. 29.10.2009 – 2 C 134.07 – juris Rn. 26; U. v. 18.4.2002 – 2 C 22.01 – juris Rn. 10; OVG NRW, U. v. 6.5.1999 – 12 A 2983/96 – juris Rn. 50; Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, BeamtVG, Anm. 1 a und 5 zu § 31).
Der Grundgedanke dieser aus der gesetzlichen Unfallversicherung und der Kriegsopferversorgung übernommenen Kausaltheorie liegt darin, dass der Dienstherr nicht für Folgen haften soll, die nicht seiner Risikosphäre zugerechnet werden können. Die beamtenrechtliche Unfallfürsorge darf nicht dazu führen, dass dem Beamten jedes denkbare Risiko abgenommen wird, auch wenn es sich in gar keiner Weise aus dem Dienst ableitet; vielmehr kann nur eine solche Risikoverteilung sinnvoll sein, die dem Dienstherrn die eigentümlichen und spezifischen Gefahren der Beamtentätigkeit auferlegt, dagegen dem Beamten mindestens die Risiken belässt, die sich aus seinen persönlichen Anlagen und etwa bereits bestehenden Beeinträchtigungen seines Gesundheitszustandes ergeben. Körperschäden auch psychischer Art sind so dem individuellen Lebensschicksal des Beamten und damit seinem Risikobereich zuzurechnen, wenn der Körperschaden jederzeit auch außerhalb des Dienstes bei einer im Alltag vorkommenden Belastungssituation hätte eintreten können (vgl. BVerwG, U. v. 18.4.2002, a. a. O., juris Rn. 11).
Für das Vorliegen eines Dienstunfalls, eines Körperschadens und der Ursächlichkeit des Dienstunfalls für den Körperschaden ist grundsätzlich der volle Beweis zu erbringen. Der Beamte trägt das Feststellungsrisiko bzw. die materielle Beweislast, sowohl für das Vorliegen des behaupteten Körperschadens als auch dafür, dass die Schädigungsfolge wesentlich auf den Dienstunfall und nicht etwa auf eine anlagebedingte Konstitution zurückzuführen ist. Bleibt nach Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten im Rahmen der Amtsermittlungspflicht offen, ob die anspruchsbegründenden Voraussetzungen erfüllt sind, geht dies damit zulasten des Beamten. Ein Anspruch ist nur dann zuzuerkennen, wenn sowohl das Vorliegen des behaupteten Körperschadens als auch der Kausalzusammenhang mit dem Dienstunfallgeschehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen sind (ständige Rechtsprechung; vgl. BVerwG, U. v. 25.2.2010 – 2 C 81.08 – NVwZ 2010, 708; BVerwG, B. v. 4.4.2011 – 2 B 7.10 – juris).
Gemessen an diesen Vorgaben konnte der Kläger nicht zur Überzeugung des Gerichts nachweisen, dass durch den Dienstunfall vom 16. Oktober 1997 weitere Körperschäden hervorgerufen wurden und somit als weitere Dienstunfallfolgen anzuerkennen sind.
1. Körperschäden auf Hals-Nasen-Ohren-fachärztlichem Gebiet
a) Vorliegend kommt das vom Beklagten eingeholte Hals-Nasen-Ohren-fachärztliche Gutachten von Prof. Dr. M. (Klinikum …) vom 16. September 2008 zu dem Ergebnis, dass eine unfallbedingte Beeinträchtigung des Hör- und Gleichgewichtsorgans nicht stattgefunden hat. Zwar könnten HWS-Distorsionen in Einzelfällen Funktionsstörungen am Gleichgewichts- und Hörorgan auslösen. Diese seien meist einseitig und auch sofort nach dem Unfall oder nach Stunden oder Tagen vorhanden. Bei Störungen des peripheren Gleichgewichtsorgans trete ein systematischer Schwindel auf, darüber hinaus sei initial ein Spontannystagmus und im weiteren Verlauf ein Provokationsnystagmus nachweisbar, ferner eine thermische Erregbarkeitsdifferenz beider peripherer Gleichgewichtsorgane. Die Funktionsstörungen am Hörorgan zeigten kein einheitliches Schädigungsmuster, am häufigsten finde man eine Schallempfindungsschwerhörigkeit mit flachem Kurvenverlauf, gelegentlich auch ein Ohrgeräusch. Ein solches werde dann in den geschädigten Frequenzbereichen lokalisiert. Das initiale Beschwerdebild beim Kläger, bestehend aus einem ungerichteten Schwindel in Verbindung mit dem fehlenden Nachweis einer Funktionsstörung des peripheren Gleichgewichtsorgans, sei als nicht vestibulärer Schwindel zu bezeichnen. Auch sei zu keinem Zeitpunkt ein Spontannystagmus nachgewiesen, ebenso keine thermische Seitendifferenz. Beides sei bei einer akut vestibulären Funktionsstörung stets vorhanden. Es habe sich eine unauffällige Funktion beider peripherer Gleichgewichtsorgane gezeigt. Die diskreten Hinweise auf eine Funktionsstörung des zentral-vestibulären Systems könnten durchaus eine Folge der umfangreichen Medikation darstellen, da nahezu alle Medikamente zentral-nervöse Wirkung entfalteten. Auch die Ableitung der vestibulär evozierten myogenen Potentiale habe keine Hinweise auf eine Funktionsstörung der Gleichgewichtssinneszellen im Sakkulus bzw. deren zugehörigen Nervenfasern ergeben. Hinweise auf eine nachweisbare Hörstörung fänden sich in der initialen hals-nasen-ohrenärztlichen Diagnosestellung nicht. Erstmals in einem Bericht vom 19. Juni 1998 fänden sich Hinweise auf eine Schallempfindungsschwerhörigkeit sowie auf Ohrgeräusche im Hochtonbereich. Im Rahmen der gutachtlichen Untersuchung des Klägers sei nicht nur ein ungestörtes Gehör beidseits gefunden worden, sondern sogar unter Berücksichtigung des Alters ein überdurchschnittlich sehr gutes Gehör. Das beidseits mit 3.000 Hz angegebene Ohrgeräusch habe mit einer Funktionsstörung des Gehörs nicht kausal verknüpft werden können, weil bei 3.000 Hz ein absolut ungestörtes Gehör vorliege. Auch eine Lärmempfindlichkeit sei weder bei der tonschwellenaudiometrischen noch bei der sprachaudiometrischen Untersuchung nachweisbar gewesen.
b) Das Gericht folgt den überzeugenden und in sich schlüssigen Ausführungen des Gutachtens. Das Gutachten vom 16. September 2008 ist nachvollziehbar und weist keine offen erkennbaren Mängel auf. Das Gutachten überzeugt des Weiteren nach Methodik und Durchführung der Erhebungen. Der Gutachter hat die relevanten Gutachten und Befunde der Akten umfassend ausgewertet und im Rahmen der Anamnese die Beschwerden des Klägers ausführlich eruiert. Aufgrund einer persönlichen Untersuchung des Klägers hat er des Weiteren einen umfassenden Untersuchungsbefund am 26. Juni und 9. Juli 2008 erstellt sowie elektroakustische Hörprüfungen und Prüfungen der Gleichgewichtsorgane vorgenommen. Seine Folgerungen beruhen sowohl auf eigenen medizinischen Erkenntnissen als auch auf Befunden, die in nachprüfbarer Weise in dem Gutachten selbst angegeben sind.
An der Sachkunde oder Unparteilichkeit des Gutachters, der Professor an der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde des Klinikums … ist, bestehen für die Kammer keine Zweifel.
Nach ständiger Rechtsprechung stellen im Verwaltungsverfahren eingeholte Gutachten auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zulässige Beweismittel dar, sofern sie inhaltlich und nach der Person des Sachverständigen den Anforderungen entsprechen, die an ein gerichtliches Gutachten zu stellen sind (BVerwG, B. v. 20. 2.1998 – 2 B 81/97 – juris). Die von einer Verwaltungsbehörde bestellten Gutachter sind grundsätzlich als objektiv urteilende Gehilfen der das öffentliche Interesse wahrenden Verwaltungsbehörde und nicht als parteiische Sachverständige anzusehen (BVerwG, U. v. 28. 8.1964 – VI C 45.61 – juris).
c) Die Ausführungen des Gutachters werden auch nicht durch privatärztliche Befunde bzw. Atteste durchgreifend in Frage gestellt.
In der Rechnung von Dr. F. vom 8. Dezember 1997 ist als Diagnose V.a. Hörsturz, Schwindel angeführt. In der Rechnung der Dres. H., B., H. vom 8. Januar 1998 ist als Diagnose Z.n. Commotio und Vertigo aufgeführt. Auch wird in der Rechnung der Drs. H. vom 11. März 1998 eine Untererregbarkeit im rechten Labyrinth, Schwindel, Tinnitus bds. diagnostiziert. Auch Dr. B. diagnostiziert in mehreren Rechnungen, u. a. vom 26. Mai 1998, Vertigo und Tinnitus. In der Rechnung von Dr. C. findet sich die Diagnose Dysaequilibrium.
Ein kausaler Zusammenhang mit dem Dienstunfall ergibt sich jedoch aus keiner der o.g. Rechnungen. Bei Dr. B. handelt es sich zudem nicht um einen Facharzt. Der Gutachter hat nachvollziehbar ausgeführt, dass der Kläger auch initial nicht an einem vestibulären Schwindel gelitten hat, da weder ein Spontannystagmus noch eine thermische Seitendifferenz nachgewiesen worden ist. Ebenso nachvollziehbar wird ausgeführt, dass sich eine unauffällige Funktion beider peripherer Gleichgewichtsorgane gezeigt hat. Eine Gehirnerschütterung hat der Kläger nicht erlitten.
In dem Befundbericht der Dr. … C. vom 19. Juni 1998 werden zwar eine multisensorische neurootologische Funktionsstörung, periphere Vestibularishemmung, Hirnstammtaumeligkeit, zentrale Reaktionsenthemmung des optokinetischen Systems, Hochtonschwerhörigkeit und Tieftonschwerhörigkeit, pontomedulläre Hörbahnstörung, supratentorielle Hörbahnverlangsamung, Tinnitus aurium, sowie ein Syndrom des überempfindlichen Ohres mit verminderter akustischer Dynamik diagnostiziert. Diese Befunde seien typisch für ein HWS-Schleudertrauma.
Abgesehen davon, dass die Bezeichnung als „typisch“ keine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der kausalen Verursachung durch den Dienstunfall begründen kann, hat der Gutachter hierzu nachvollziehbar ausgeführt, dass die verwendeten Diagnosen nicht standardisiert seien und die Validität der zugrundeliegenden Untersuchungsverfahren bislang auch nicht überprüft sei. Zudem würden die verwendeten Termini nicht dem allgemeinen neurootologischen Sprachgebrauch entsprechen.
Im Bericht der Kliniken … vom 21. Juli 1998 wird u. a. ausgeführt, dass klinische Zeichen für eine Innenohr- und Hochtonschwerhörigkeit leichten Grades bds. sowie Anhalt für eine Schädigung des Gleichgewichtssystems Hirnstamm-Kopfgelenke und hierdurch bedingte Beeinträchtigung des Gleichgewichtssinnes vorliegen würden.
Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei Dr. R. um einen Facharzt für Neurochirurgie und Orthopädie, Physikalische und Rehabilitative Medizin handelt, nicht um einen HNO-Arzt. Eine Innenohr- und Hochtonschwerhörigkeit sowie eine Schädigung des Gleichgewichtssystems konnte von dem HNO-fachärztlichen Gutachter Prof. Dr. M. nicht festgestellt werden. Zudem werden Aussagen zur Kausalität mit dem Dienstunfall nicht getroffen. Eine unfallbedingte Schädigung des cranio-cervikalen Übergangs hat Prof. Dr. B. ausgeschlossen. Die gelenkigen Verbindungen in diesem Bereich seien vielmehr altersentsprechend, die knöcherne Darstellung unauffällig. Auch Prof. Dr. P. konnte keine Traumatisierung des cranio-cervikalen Übergangs feststellen (s.u. Nr. I.2).
Zur Überzeugung des Gerichts steht daher fest, dass der Kläger auf HNO-fachärztlichem Gebiet keine weiteren Körperschäden erlitten hat, die sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückführen lassen.
2. Körperschäden auf orthopädischem/radiologischem Gebiet
a) Das vom Landgericht … eingeholte interdisziplinäre Gutachten des Orthopädischen … (O.) vom 2. April 2012 von Dr. L./Dipl.-Ing. Dr. S. kommt zu dem Ergebnis, dass nach unfallanalytischer Bewertung der Schäden an den Fahrzeugen von einer kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung von 9 – 11 km/h auszugehen sei. Bei der körperlichen Untersuchung des Klägers am 13. Juli 2011 habe die Wirbelsäule keine wesentliche Seitverbiegung gezeigt. Es habe sich eine normale Halslordose, eine normale Brustkyphose und eine normale Lendenlordose gefunden. Über den Dornfortsätzen der HWS und der oberen HWS habe ein Berührungsschmerz bestanden. Die paravertebrale Muskulatur sowie die seitliche Halsregion seien beidseits druckschmerzhaft gewesen. Verhärtungen des Musculus Trapezius seien festzustellen gewesen. Bei der Ultraschalluntersuchung der aktiven Beweglichkeit der HWS hätten sich Bewegungseinschränkungen in allen gemessenen Bewegungsrichtungen gezeigt. Angesichts der individuellen körperlichen Belastbarkeit und den Gegebenheiten zum Unfallzeitpunkt sowie der klinischen Symptomatik sei nachvollziehbar, dass der Kläger eine HWS-Distorsion erlitten habe. Auf orthopädischem Gebiet ließen sich aber keine sicheren Hinweise darauf finden, dass im Fall des Klägers nicht von einem regelrechten Heilungsverlauf einer unfallbedingten HWS-Distorsion auszugehen sei. Von einer folgenlosen Ausheilung dieser Verletzung bis spätestens Mitte Oktober 1998 sei auszugehen. Die über diesen Zeitraum hinaus geschilderten Beschwerden seien nicht mehr als Folge einer unfallbedingten Distorsion der Halswirbelsäule auf orthopädischem Fachgebiet nachzuvollziehen.
Bestätigt werden die Ergebnisse des Gutachtens sowohl durch das vom Landgericht … eingeholte radiologische Gutachten von Prof. Dr. P., Klinikum … (Klinische Radiologie), vom 9. Februar 2007, auf das auch das o.g. Gutachten des O. Bezug nimmt, als auch durch das vom Beklagten eingeholte neuroradiologische Gutachten von Prof. Dr. B., Klinikum … (Neuroradiologie), vom 7. Dezember 2007:
Prof. Dr. P. befundet degenerative Veränderungen der HWS mit einer Knickbildung zwischen HWK 5/6 sowie eine Bandscheibenprotrusion. Diese Befunde der mittleren HWS seien im Wesentlichen anlagebedingt als degenerative Veränderungen zu werten, da sie bereits zum Unfallzeitpunkt bestanden und bis 2006 deutlich zugenommen hätten. Sehr unterschiedlich seien von allen Befundern die Bänder des craniocervicalen Übergangs, insbesondere die Bänder zum Dens beschrieben worden. Bei der ersten kernspintomographischen Untersuchung von 1997 ergebe sich kein Hinweis für eine Verletzung im Bereich dieser Bänder. Direkt nach einem Unfall müsste bei einer Bandverletzung ein bone bruise an den Bandansätzen oder ein Ödem im umgebenden Fettgewebe zu erkennen gewesen sein, was nicht der Fall gewesen sei. Der fehlende Nachweis eines wesentlichen Traumas im Bereich des Atlantookcipitalgelenks vor allem unfallnah in der ersten kernspintomographischen Untersuchung sowie die sehr gute Beweglichkeit in den Rotationsuntersuchungen sprächen gegen eine wesentliche Traumatisierung des craniocervikalen Übergangs. Die Beschwerden des Klägers seien aufgrund der erheblichen degenerativen Veränderungen im Bereich der mittleren HWS erklärbar.
Prof. Dr. B. befundet ebenfalls eine Fehlhaltung mit Steilstellung der HWS, eine Rekurvation HWK 4-7 sowie einen Bandscheibenvorfall HWK 5/6, jedoch ohne raumgreifende Wirkung, ohne wesentliche Einengung des Spinalkanals, ohne Forameneinengung. Bei den gezielten Untersuchungen des cranio-cervikalen Übergangs hätten sich vermehrte Degenerationen im Bereich der Gelenkflächen des C0/C1-Gelenks dargestellt. Hier fänden sich konstant eine Verschmälerung der Gelenksspalten mit etwas vermehrter subchondraler Sklerosierung bei durchweg unauffälligen Signalen im Knochenmark ohne Hinweis auf ein Ödem und ohne pathologisches KM-Enhancement. Somit bestehe kein Anhalt auf eine entzündliche Aktivierung dieses Befundes. Insgesamt handele es sich um eine mäßige Degeneration/Präarthrose ohne ausgeprägte Deformierung des Gelenks. Ferner lasse sich eine minimale beginnende Degeneration auch im Bereich des Atlantodental-Gelenkes feststellen, die sich ebenfalls als Verschmälerung des Gelenkspalts manifestiere. Im Übrigen stellten sich die gelenkigen Verbindungen des cranio-cervikalen Übergangs als altersentsprechend dar. Die ligamentären und membranösen Strukturen seien unauffällig, es liege keine Ruptur eines Ligamentum alare oder einer bindegewebigen Membran vor. Auch das Ligamentum transversum sei intakt. Es gebe keine Zeichen einer Myelopathie, also keine Zeichen einer akuten oder abgelaufenen Schädigung des Rückenmarks. Auch in der knöchernen Darstellung des cranio-cervikalen Übergangs sei der Befund unauffällig. Es ließen sich auch diskrete knöcherne Veränderungen, z. B. im Bereich der Bandansätze der Ligamenta alaria oder des Ligamentum transversum sicher ausschließen. Es fänden sich keine Frakturen im Bereich der oberen HWS und keine Sklerosierungslinien, die auf alte, verheilte Frakturen hindeuten könnten. Die Rekurvation im Bereich HWK 4-7 in Verbindung mit der Steilstellung der gesamten HWS stelle einen häufig zu beobachtenden Befund im Sinne einer degenerativen Veränderung dar. Die Bandscheibenvorfälle seien Folge der Fehlstellung. Die Fehlstellung selbst lasse sich anhand des vorliegenden Bildmaterials nicht sicher dem Unfallereignis vom 16. Oktober 1997 zuweisen. Direkte Beweise für ein abgelaufenes Trauma wie Zeichen alter Frakturen fehlten. Die degenerativen Veränderungen im Bereich des cranio-cervikalen Übergangs stellten ebenfalls lediglich Abnutzungserscheinungen dar, ein kausaler Zusammenhang mit dem Unfallereignis lasse sich ebenfalls keineswegs herleiten.
b) Das Gericht folgt den überzeugenden und in sich schlüssigen Ausführungen der Gutachten. Die Gutachten sind nachvollziehbar und weisen keine offen erkennbaren Mängel auf. Sie überzeugen nach Methodik und Durchführung der Erhebungen. Die Gutachter haben die relevanten Atteste und Gutachten ausgewertet und das O. hat im Rahmen der Anamnese die Beschwerden des Klägers ausführlich eruiert. Aufgrund einer persönlichen Untersuchung des Klägers am 13. Juli 2011 hat das O. des Weiteren einen umfassenden Untersuchungsbefund erstellt. Seine Folgerungen beruhen sowohl auf eigenen medizinischen Erkenntnissen als auch auf Befunden, die in nachprüfbarer Weise in dem Gutachten selbst angegeben sind.
An der Sachkunde oder Unparteilichkeit der Gutachter bestehen für die Kammer keine Zweifel. Die in einem anderen Gerichtsverfahren gerichtlich eingeholten Gutachten können auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren verwertet werden (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 98 Rn. 15a).
c) Die Ausführungen der Gutachter werden auch nicht durch privatärztliche orthopädische Gutachten bzw. Befunde durchgreifend in Frage gestellt.
Die im MRT der Drs. B., N., V. (Radiologische Gemeinschaftspraxis …) vom 25. November 1997 festgestellte Osteochondrose C4 bis C7, Protrusion C5/6 und kyphotische Fehlhaltung wurden bereits amtsärztlich vom Landratsamt … am 26. Mai 1998 nachvollziehbar als degenerative Veränderungen eingestuft. Dies wird auch in den radiologischen Gutachten bestätigt.
Dr. K. diagnostizierte zwar u. a. in seinem Bericht vom 9. Januar 1998 ein blockiertes C5-Gelenk als Unfallfolge. Dies befundete auch Dr. V. in seinem Bericht vom 10. Februar 1998 und Dr. M… in seinem Bericht vom 25. Juni 2002. Der Gutachter Dr. L.. vom O. führt hierzu jedoch nachvollziehbar aus, dass – unabhängig davon, dass unklar bleibt, ob damit das C4/5- oder das C5/6-Gelenk gemeint sei – es sich bei einer Gelenkblockierung nicht um einen verletzungsspezifischen Befund handelt. Die erst 13 Tage nach dem Unfall am 29. Oktober 1997 festgestellte Gelenksblockierung sei eher nicht als Unfallfolge einzuschätzen, da eine unfallbedingte Gelenksblockierung insbesondere dann nachvollziehbar sei, wenn sie frühzeitig festgestellt werde und zeitnah zu Funktionsbeeinträchtigungen führe. Aus dem kurzen Arztbericht des erstbehandelnden Arztes, Dr. P. (Kreiskrankenhaus …), gehe jedoch hervor, dass eine freie Beweglichkeit ohne Blockaden festgestellt wurde. Auch aus dem ärztlichen Bericht von Dr. S. vom 22. Dezember 1997 (Bl. 711 der BA) gehe hervor, dass fünf Tage nach dem Unfall am 21. Oktober 1997 noch eine freie Beweglichkeit der HWS festgestellt wurde. Dies spreche ebenfalls dagegen, die festgestellte Blockierung als Unfallfolge einzuschätzen. Angesichts dieser nachvollziehbaren Ausführungen ist aus Sicht der Kammer der Nachweis, dass die Blockierung des „C5-Gelenks“ mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückzuführen ist, nicht erbracht. Zur ebenfalls von Dr. K. festgestellten eingeschränkten Links-Rechts-Rotation hat der Gutachter Dr. L. erklärt, dass diese unter Berücksichtigung des Alters des Klägers als normal einzustufen sei. Im Übrigen hat Dr. K. am 29. Oktober 1997 eine HWS-Distorsion 1. Grades nach Erdmann festgestellt und insofern die Gutachten bestätigt.
In den Rechnungen von Dr. V. vom 30. März 1998 über Untersuchungen des Klägers am 12. und 17. März 1998 ist als Diagnose lediglich „Ausschluss einer oberen HWS-Subluxationsposition in Funktionszuständen“ bzw. „Ausschluss Ruptur der Kopfgelenksbänder“ aufgeführt. Ein möglicher Körperschaden ergibt sich hieraus nicht.
Dr. B. stellt in der Rechnung vom 21. April 1998 die Diagnose „Unfallfolgen 10/97 mit Strukturverletzungen im Bereich der Kopfgelenke“ und in der Rechnung vom 26. Mai 1998, 6. Juli 1998 und 24. September 1998 die Diagnose „Unfallfolgen 10/97 mit V.a. Strukturverletzungen im Bereich der Kopfgelenke C5-Blockade“.
Abgesehen davon, dass der Kausalzusammenhang von Strukturverletzungen im Bereich der Kopfgelenke mit dem Dienstunfall darin in keiner Weise begründet wird und die in der Rechnung vom 21. April 1998 aufgestellte Diagnose in der darauffolgenden Rechnung zu einem bloßen Verdacht herabgesetzt wurde, handelt es sich bei Dr. B. um einen Allgemeinarzt, nicht um einen Facharzt. Nach den orthopädischen und radiologischen Fachgutachtern sind Strukturverletzungen im Bereich der Kopfgelenke gerade nicht ersichtlich. Bzgl. der C5-Blockade wird zudem auf obige Ausführungen verwiesen.
In dem Bericht von Dr. H. (….-Kliniken) vom 21. September 1998 wird u. a. ein Kopf-Hals-Akzelerationstrauma am ehesten Grad II bei Wegeunfall diagnostiziert.
Der Bericht enthält schon keine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit getroffene Diagnose („am ehesten“). Zudem bleibt unklar, nach welcher Tabelle (Erdmann oder Quebec Task Force) sich die Gradeinteilung richten soll.
Dr. P. führt in seinem ärztlichen Gutachten vom 15. Dezember 1998 aus, dass Dr. M. eine unfallbedingte Instabilität des cranio-cervikalen Übergangs in Höhe C1/C2 sowie eine Gefügeinstabilität in Höhe C4/C5 festgestellt habe. Die Erstdiagnose einer Distorsionsverletzung stehe hierzu nicht im Widerspruch. Die Schwere einer Distorsionsverletzung der HWS könne nur aus dem weiteren Verlauf und den Symptomen erkannt werden. Die geklagten Beschwerden seien jedenfalls als unfallbedingt zu werten.
Dr. P. stellt vorliegend nicht selbst die Diagnose einer Instabilität der HWS, sondern führt lediglich aus, dass der Erstbefund dieser Diagnose nicht entgegenstünde. Eine posttraumatische Instabilität der HWS konnte Dr. L. in seinem Gutachten vom 2. April 2012 angesichts des radiologischen Gutachtens vom 9. Februar 2007 aber gerade nicht bestätigen (s.u.). Im Übrigen werden zur Kausalität der Beschwerden, außer deren bloßer Behauptung, keine tragfähigen Aussagen gemacht.
Der Befundbericht von Dr. G. vom 19. April 2000 (Bl. 163 der BA) bestätigt die Diagnose einer Fehlstellung der HWS mit Kyphosierung zwischen HWK 4 und 7 sowie die Bandscheibenprotrusionen HWK 5/6 und 6/7. Zwar wird festgestellt, dass es Hinweise auf eine atlanto-axiale Instabilität gebe. Abgesehen von einer fehlenden gesicherten Diagnose diesbzgl. werden auch keine Aussagen zum Kausalzusammenhang mit dem Dienstunfall getroffen.
Dr. M., Facharzt für Neurochirurgie, diagnostiziert in seinem Befundbericht vom 25. Juni 2002 u. a. eine Instabilität der oberen HWS C0/C1/C2. Dr. B., Allgemeinarzt, spricht in seinem Schreiben vom 22. Juni 2002 ebenfalls von einem HWS-Trauma mit Instabilität der Kopfgelenke. Dr. P., Facharzt für Neurochirurgie, diagnostiziert in seinem Bericht vom 18. August 2006 eine posttraumatische Instabilität C0/C1, C1/C2 bei Teilruptur des Lig. Alarius und Lig. apicis dentis. Schließlich diagnostiziert Dr. H., Arzt für Orthopädie und Physikalische Therapie (… Klinik), in seinem Bericht vom 19. Dezember 2003 „Zustand nach HWS-Schleudertrauma Okt. 1997 mit Instabilität von C0, C1, C2 und Ruptur der Ligamenta alaria mit cerviko-cephalen und cerviko-encephalen Symptomen“.
Zur Kausalität der Diagnosen mit dem Dienstunfall werden in den Berichten keine näheren Ausführungen gemacht. Dr. L. führt demgegenüber in seinem Gutachten vom 2. April 2012 nachvollziehbar aus, dass angesichts des radiologischen Gutachtens vom 9. Februar 2007 weder eine posttraumatische Instabilität der Kopfgelenke (d. h. der Gelenke C0/C1 und C1/C2) noch eine morphologisch fassbare Verletzung des Bandapparats C2/3 als gesichert anzunehmen sei. Auch im Bericht der Kliniken … vom 21. September 1998 wird eine am 17. März 1998 von Dr. V.angefertigte Kernspintomographie mit „ohne Anhalt auf ligamentäre Verletzung“ befundet.
Dr. H., Arzt für Orthopädie und Physikalische Therapie (… Klinik), diagnostiziert in seinem Bericht vom 19. Dezember 2003 zudem „Unfallbedingt Zustand nach geschlossenem Schädel-Hirn-Trauma“ und „Kiefergelenksluxation bds. 1997“. Auch nach Dr. B. (Schreiben vom 22. Juni 2002) lägen ein HWS-Schleudertrauma mit Kiefergelenkssubluxation und ein geschlossenes Schädel-Hirn-Trauma vor.
Die Diagnose eines unfallbedingten Zustands nach Schädel-Hirn-Trauma kann allein schon deshalb im Zusammenhang mit dem Dienstunfall nicht nachvollzogen werden, da der Kläger hierbei keine Schädelverletzung erlitten hat. Dies ergibt sich bereits aus dem Unfallhergang wie er im Gutachten des O. vom 2. April 2012 beschrieben wird. Danach ist der Kopf des Klägers nicht an die Kopfstütze, sondern an dieser vorbei nach hinten geschlagen und vom Oberkörper abgebremst worden. Für eine Schädelverletzung ergibt sich daher kein Anhalt. Unter einem Schädel-Hirn-Trauma versteht man aber Verletzungen des Schädels mit Beteiligung des Gehirns. Darüber hinaus wurden auch in den zeitnah erstellten Befunden keine Schädelverletzungen dokumentiert. Unabhängig davon wird die Kausalität mit dem Dienstunfall in keinem der Berichte näher begründet.
Auch der Bericht von Dr. V. vom 17. Juni 2004 führt zu keiner anderen Einschätzung. Danach zeige der HWK 2 demarkierbare intraspongiöse Veränderungen und on top Periostkonturunregelmäßigkeiten. Die fibrösen Kapselgelenke zeigten subchondrale Strukturunregelmäßigkeiten in den C0-C1- und C1-C2-Gelenken bds. mit Druckusuren in den C1-C2-Gelenken und Zeichen einer Rotationsfehlposition links im C1-C2-Gelenk. Es gebe keine Zeichen einer Myelomalazie, jedoch eine funktionelle Tangierung des Myelons im craniocervikalen Übergang in beiden Rotationspositionen. In den Anspannungspositionen zeigten sich die Ligamenta alaria mit allgemeinen Strukturveränderungen insertionsnah bds. und zentral Faserverdickungen links (Typ IIb) und Faserausdünnungen rechts (Typ IIa). Des Weiteren wurden ausgeprägte densnahe Gelenkkapselveränderungen mit Kapselrandpathologie bds. und insgesamt Zeichen einer traumatischen Kapselruptur befundet. In der Zusammenfassung werden zudem eine funktionelle cranio-cervikale Myelopathie sowie ein instabiler Dens diagnostiziert. Die Funktionsdefizite stünden eindeutig im ursächlichen Zusammenhang mit dem Dienstunfall.
Prof. Dr. B. hat in seinem Gutachten hierzu ausgeführt, dass die knöcherne Struktur des HWK 2 unauffällig gewesen sei. Das Periost als bindegewebige Struktur (äußere Knochenhaut) sei nur histologisch zu beurteilen, eine Beurteilung im Kernspintomographen sei nicht möglich. Im Bereich des C0-C1-Gelenkes hätten sich subchondrale Hypersklerosierungen gefunden, die als degenerative Veränderungen bewertet würden. Die übrigen Facettengelenke hätten sich unauffällig dargestellt. Der Befund einer Rotationsfehlposition links im C1-C2-Gelenk könne nicht nachvollzogen werden. Der Begriff der funktionellen Tangierung sei im (neuro)radiologischen Sprachgebrauch in keiner Weise etabliert. Man erkenne allenfalls in den maximalen Rotationspositionen ein Näherrücken des Myelons nach ventral zum anterioren Rand des Foramen magnums hin, was im Rahmen der Kopfrotation als physiologisch zu interpretieren sei. Grundsätzlich könne es Spinalkanalstenosen geben. Diese zögen jedoch eine eindeutige, neurologisch zu verifizierende Symptomatik nach sich, die sich in der Regel klinisch eindeutig identifizieren lasse. Bis zum Eintreten solcher Symptome seien erfahrungsgemäß erhebliche, permanente Einengungen des Spinalkanals nötig, die sogar eine geringgradige Verformung des Myelons bedingen können. Ein Diagnostikpfad, wie ihn Dr. V. zu verwenden scheint, sei in keiner Weise etabliert. Er beschreibe ihn als „Videodiagnose“ und habe eine Arbeit hierzu veröffentlicht, die aus wissenschaftlicher Sicht aber nicht haltbar sei. Es fehlten jegliche Angaben zur Auswertung, Zahl der Betrachter, zur Reliabilität sowie Kontrollgruppen. Die Ligamenta alaria stellten sich als normal dar, die minimalen, intraligamentären Signalinhomogenitäten dürften keinesfalls als pathologisch gewertet werden. Die von Dr. V. vorgenommene Einteilung Typ IIa und IIb seien kein radiologischer Goldstandard. Dr. V. habe diese Einteilung in einer eigenen Publikation vorgestellt. Zur Beschreibung dieser Veränderungen zitiere er eine eigene Arbeit, die sich auch bei einer erweiterten Literaturrecherche nicht auffinden lasse. An den Gelenkkapseln seien lediglich geringe degenerative Veränderungen im Bereich des Atlantodental-Gelenkes mit Verschmälerung des Gelenkspalts nachzuvollziehen, keine weichteiligen Veränderungen. Keinesfalls sei die Diagnose einer Kapselruptur oder gar einer traumatischen Genese zulässig. Daher müsse die gesamte Bewertung von Dr. V. abgelehnt werden. MR- Funktionsuntersuchungen hätten grundsätzlich keinen Wert in der Diagnostik von posttraumatischen Veränderungen des cranio-cervikalen Übergangs. Schlagworte wie „funktionelle cranio-cervikale Myelopathie“ sowie „instabiler Dens“ seien in der Neuroradiologie in keiner Weise etabliert. Die Herleitung einer Kausalität erscheine unabhängig von den zu Unrecht erhobenen Befunden nach einer Zeit von knapp sieben Jahren als unhaltbar.
Prof. Dr. B. hat sich mit dem Bericht von Dr. V. in seinem Gutachten ausführlich auseinandergesetzt und die dortigen Ausführungen nachvollziehbar widerlegt. Der Bericht von Dr. V. kann die Feststellungen der o.g. Gutachten daher nicht durchgreifend in Frage stellen, zumal es sich hierbei lediglich um die Angaben eines den Kläger privat behandelnden Arztes handelt, der zudem alles andere als unumstritten ist (vgl. Spiegel …/2008 „…“). Überdies hat Dr. V. seine Angaben zu der von ihm angenommenen Kausalität der beschriebenen Funktionsdefizite mit dem Dienstunfall in keiner Weise begründet.
Dr. F. führt in seiner Auswertung einer Funktions-Computertomographie des cranio-cervikalen Übergangs vom 5. August 2005 aus, dass diese eine Funktionsstörung in den C2/3-Gelenken und in den Altanto-occipital-Gelenken bei Linksrotation zeige. Im Ergebnis bedeuteten diese Rotationsstörungen, dass eine funktionelle Kopfgelenksstörung vorliege. Diese gingen in aller Regel mit einer komplexen Beschwerdesymptomatik einher, die am besten unter dem Begriff cervikoencephales Syndrom zusammengefasst werde. Überproportional häufig fänden sich funktionelle Kopfgelenksbeschwerden bei Patienten mit chronischen Beschwerden, die im Anschluss an ein HWS-Beschleunigungstrauma aufgetreten seien. Auch im vorliegenden Fall sei ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und der danach eingetretenen Beschwerdesymptomatik anzunehmen.
Prof. Dr. P. hat hierzu ausgeführt, dass das Funktions-CT vom 28. Juli 2005 eine gute Rotationsmöglichkeit bei Links- und Rechtsrotation zeige und die angegebenen Rotationswinkel in etwa den Mittelwerten unter Einbeziehung der Standardabweichung entsprächen. Darüber hinaus ergibt sich aus den Ausführungen von Dr. F. kein kausaler Ursachenzusammenhang mit dem Dienstunfall mit der erforderlichen mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit. Dass funktionelle Kopfgelenksstörungen „überproportional häufig“ bei Patienten mit HWS-Distorsion auftreten sollen, ist hierfür nicht ausreichend. Auch ist der Zusammenhang mit dem Unfall nach den Ausführungen von Dr. F. lediglich „anzunehmen“.
Dr. W., Orthopäde, führt in seinem Schreiben vom 17. November 2005 aus, es hätten sich eine Atlas-C2-Fehlstellung bei Gegenrotation des Atlas bei Komplexinstabilität, Druckschmerz über beiden Kiefergelenken, Muskeltonus deutlich erhöht im Bereich der Gesichts- und oberen/seitlichen Halsmuskulatur gezeigt. Sonographisch habe sich ein Hochstand der 1. Rippe sowie ausgeprägte Myogelosen im HWS-Schulter-Nackenbereich bds. ergeben. Insgesamt hätten sich Strukturunregelmäßigkeiten über C0, C1 und C2 sowie eine Rotationsfehlstellung im C1/2-Gelenk gezeigt.
Tragfähige Aussagen zur Kausalität der o.g. Diagnosen werden in dem Schreiben nicht getroffen. In den gerichtlich und behördlicherseits eingeholten radiologischen Gutachten konnten unfallbedingte Strukturveränderungen an den o.g. Gelenken nicht bestätigt werden.
Dr. K., Facharzt für Diagnostische Radiologie, befundet im Schreiben vom 18. November 2005 eine asymmetrische Position des Dens im Atlantodentalgelenk mit Erweiterung des seitlichen atlantodentalen Abstands links sowie intraligamentäre Signalanhebung der per continuitatem abgrenzbaren Ligg. transversum links und alare links. Fixierte atlantoaxiale Rotation bei insuffizientem Bandheilungsverlauf nach alten (Partial-)rupturen der Ligg. Transversum und alare links. Fehlender Nachweis des Ligamentum apicis dentis, einer kompletten Ruptur entsprechend.
Prof. Dr. B. führt hierzu in seinem Gutachten nachvollziehbar aus, eine leichte Lateraldeviation des Dens im Atlantodental-Gelenk nach rechts lasse sich in den koronaren und axialen Schichten nachvollziehen, so dass der seitliche atlantodentale Abstand links geringgradig erweitert sei. Dieser Befund sei jedoch nicht als pathologisch zu werten. Entsprechende Befunde seien auch bei der Untersuchung von Normalkollektiven beobachtet worden. Dr. K. unterliege jedoch einer Überinterpretation der intraligamentären Signalanhebungen, die sich lediglich sehr diskret abzeichneten und entsprechend der Nomenklatur von K. et al allenfalls als Grad I-Läsionen zu interpretieren seien. Veränderungen des Ligamentum transversum könnten in keiner Weise nachvollzogen werden. Darüber hinaus unternehme er eine unzulässige Differenzierung in ein Ligamentum transversum atlantis links und rechts unter Negierung der Tatsache, dass es sich beim Ligamentum transversum atlantis um eine unpaare Struktur handle. Die fehlende Darstellung des Ligamentum apicis dentis sei durchaus üblich. Somit sei die Diagnose einer kompletten Ruptur keinesfalls zulässig. Entsprechend sei auch die Diagnose einer fixierten atlanto-axialen Rotation nach alten Partialrupturen der o.g. ligamentären Strukturen abzulehnen.
Darüber hinaus wurden von Dr. K. auch keine tragfähigen Aussagen zur Kausalität mit dem Dienstunfall gemacht.
Dr. S., Orthopäde, führt in seinem Schreiben vom 1. August 2005 aus, der Kläger leide an chronischen Schmerzen an der Halswirbelsäule nach einem Verkehrsunfall. Die Schmerzursache sei in den Facettgelenken zu suchen und bedingt durch die inzwischen übererregbar gewordenen kleinen Nervenendungen der Gelenknerven und die plastischen Veränderungen im Rückenmark.
Abgesehen davon, dass neurologische Veränderungen im Rückenmark nicht festgestellt werden konnten, werden von Dr. S. tragfähige Aussagen zur Kausalität mit dem Dienstunfall nicht getroffen.
Prof. Dr. F. führt in seinem Befundbericht vom 2. Mai 2006 aus, dass sich eine asymmetrische Zentrierung des Dens in Bezug auf den Atlasbogen zeige. Erhöhte Signale im Ligamentum alare links. Links Defekt, der ca. 30% des Querschnitts ausmache und durchaus mit einem Z.n. älterem Trauma zu vereinbaren sei. Das Ligamentum transversum atlantis links stelle sich ausgedünnt und elongiert dar. Deutlich schmächtigeres Ligamentum transversum alare rechts. Die densnahen Abschnitte links seien verplumpt i. S. eines Z.n. reparativen Vorgängen. Deutlich ausgedünntes Ligamentum apicis dentis, so dass auch hier Z.n. Traumatisierung anzunehmen sei. Es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem posttraumatischen ligamentären Schaden auszugehen.
Prof. Dr. B. führt in seinem Gutachten hierzu nachvollziehbar aus, dass Prof. Dr. F. aus der leichten Signalerhöhung im Ligamentum alare links unzulässigerweise den Schluss einer Vereinbarkeit mit Zustand nach älterem Trauma ziehe. Die Signalsteigerung entspreche allenfalls einer Grad I-Läsion (s.o.). Der Befund zum Ligamentum tranversum atlantis sei allein anatomisch nicht haltbar, da es sich hierbei um eine unpaare Struktur handle. Einen Ansatz dieses Bandes am Dens gebe es nicht, somit könnten dort auch keine reparativen Vorgänge, Verplumpungen oder ähnliches vorliegen. Auch sei es biomechanisch undenkbar, dass bei einem Trauma lediglich die Hälfte dieses durchgehenden Bandes verletzt werden solle, die andere Hälfte aber keine Verletzungen erleiden solle. Das Ligamentum apicis dentis lasse sich im MRT fast regelhaft nicht darstellen. Die Schlussfolgerung einer Trauma-Folge sei also unzulässig. Die These eines posttraumatischen ligamentären Schadens werde daher für unhaltbar gehalten.
Dr. K. befundet in seinem Bericht vom 27. März 2008 Signalerhöhungen im Ligamentum alare links, die mit einer moderaten Läsion (Grad 1) kompatibel sei. Das Ligamentum transversum sei im Normalbereich. Im Übrigen wurden degenerative Veränderungen der mittleren HWS festgestellt.
Dr. K. bestätigt die Auffassung von Prof. Dr. B., dass die Signalerhöhung im Ligamentum alare links allenfalls einer Grad I-Läsion entsprechen. Der Schluss auf einen Zustand nach älterem Trauma ergibt sich daraus nicht (s.o.). Zur Kausalität mit dem Dienstunfall werden keine Aussagen getroffen.
Das Gutachten von Prof. Dr. S. (Klinik für physikalische Medizin/Klinikum G) vom 14. Juli 2008 diagnostiziert zum Zeitpunkt der gutachterlichen Untersuchung Kopfschmerzen, Cervikalsyndrom mit cervico-cephalen und cervico-encephalen Symptomen, mit segmentalen Funktionsstörungen (Blockierungen) der HWS-Segmente C0/C1/C2 und C4/C5. Nicht bewiesen werden könne ohne vorliegendes Ergebnis der radiologischen und anderen Gutachten, inwiefern strukturelle Schädigungen und damit auch die beschriebenen und bestehenden Schmerzen und Funktionsstörungen auf den Unfall zurückzuführen seien.
Eine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der kausalen Verursachung der diagnostizierten Schäden durch den Dienstunfall ergibt sich hieraus ersichtlich nicht, da die Gutachter selbst ausführen, dass dieser Zusammenhang nicht bewiesen werden konnte.
Prof. Dr. K.(Chirurgische Klinik/Klinikum …) bestätigt in seinem Zusammenhangsgutachten vom 5. Dezember 2008 die Diagnose einer HWS-Beschleunigungsverletzung Grad II nach Quebec Task Force, geht jedoch davon aus, dass die erheblichen vegetativen Beschwerden trotz degenerativer Veränderungen im Halswirbelbereich auf den Unfall zurückzuführen seien. Aufgrund des Einsetzens der erheblichen Beschwerdesymptomatik unmittelbar nach dem Unfall sowie des kontinuierlichen Weiterverlaufs und des vollständigen Fehlens eines sekundären Krankheitsgewinns seien die geklagten Beschwerden als Unfallfolge anzusehen. Trotz des Fehlens von funktionell krankhaften Befunden und von bildgebenden Traumafolgen sei die Beschwerdesymptomatik auf das Unfallgeschehen zurückzuführen. Der Unfallzusammenhang ergebe sich aus der Kombination von Beschwerdefreiheit vor dem Unfall, dem typischen Unfallmechanismus, der verzögert einsetzenden vegetativen Symptomatik und der Unmöglichkeit, die Beschwerden durch andere Erkrankungen, speziell degenerative Veränderungen, zu erklären.
Das Gutachten ist in sich nicht schlüssig. Auf die Ausführungen des Oberlandesgerichts München vom … November 2009 wird verwiesen. Zur Kausalität der Beschwerden mit dem Dienstunfall ist auszuführen, dass die bloße zeitliche Nähe zwischen dem Auftreten der vom Gutachter angenommenen Beschwerden und dem Dienstunfall nicht genügt, um einen ursächlichen Zusammenhang im Rechtssinne zu begründen. Auch dass dem Unfall vergleichbare Einwirkungen oder Vorerkrankungen, die ebenfalls solche Störungen hervorrufen könnten, aus der Anamnese bzw. der Befunderhebung nicht bekannt seien, genügt für den Nachweis eines Kausalzusammenhangs mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Es gibt im beamtenrechtlichen Dienstunfallrecht ebenso wie im Bereich des Arbeitsunfalls (vgl. BSG, U. v. 9.5.2006 – B 2 U 26/04R – juris) keine Beweisregel, dass bei fehlender Alternativursache die dienstunfallbedingte naturwissenschaftliche Ursache auch eine wesentliche Ursache ist, weil dies bei komplexem Krankheitsgeschehen zu einer Beweislastumkehr führen würde. Die anspruchsbegründende Voraussetzung des Ursachenzusammenhangs ist vielmehr positiv festzustellen. Ein derart positiver Nachweis wird in dem Gutachten nicht erbracht. Auch ein kontinuierlicher Weiterverlauf der geklagten Beschwerden, wie von Prof. Dr. K. angenommen, ist beim Kläger nicht ersichtlich. Vielmehr unterlagen diese großen Schwankungen (zunächst Besserung bis 2002, danach wieder Verschlechterung).
d) Schließlich wird das radiologische Gutachten von Prof. Dr. B. auch nicht durch die klägerischen Ausführungen im Schriftsatz vom …. Juli 2010 in Frage gestellt:
Die Behauptung, dass beim Kläger eine Grad II-Läsion der Ligamenta alaria vorliegen sollte, ist nicht nachvollziehbar. Dr. K. selbst, auf den sich der Klägerbevollmächtigte diesbzgl. bezieht, hat in seinem Bericht vom 27. März 2008 Signalerhöhungen im Ligamentum alare links befundet, die mit einer moderaten Läsion kompatibel sei. Eine moderate Läsion ist nach der ebenfalls dort erwähnten Graduierung (moderate – substantial – extensive) Grad I. Dass dies Rückschlüsse auf ein Trauma zuließe, hat Prof. Dr. B. nachvollziehbar ausgeschlossen. Warum die vom Kläger zitierten wissenschaftlichen Arbeiten die Ergebnisse des radiologischen Gutachtens im Fall des Klägers in Frage stellen sollten, ist nicht ersichtlich. Eine Kausalität der Befunde von Dr. K. aus dem Jahr 2008 mit dem Dienstunfall 1997 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist zudem nicht nachgewiesen.
Dass degenerative Veränderungen lange Zeit „stumm“ verlaufen können und gerade keine Beschwerden bereiten, ist dem Gericht aus zahleichen dienstunfallrechtlichen Verfahren hinreichend bekannt. Die Beschwerdefreiheit vor dem Unfall rechtfertigt daher nicht den Schluss, dass degenerative Veränderungen nicht für die Beschwerden des Klägers verantwortlich sein können.
Dass Prof. Dr. B. die Rechtsprechung zur wesentlichen Teilursache nicht bekannt wäre, ist eine bloße Behauptung. Das Gutachten setzt sich jedenfalls mit der Frage der Kausalität schlüssig, ohne Widersprüche oder sonstige erkennbare Mängel auseinander und kommt nachvollziehbar zu dem Ergebnis, dass Körperschäden nicht mit dem erforderlichen Grad an Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückzuführen sind.
Nach alledem steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger keine weiteren Körperschäden auf orthopädisch/radiologischem Gebiet erlitten hat, die sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall des Klägers zurückführen lassen.
3. Körperschäden auf neurochirurgischem Fachgebiet
a) Das vom Beklagten eingeholte neurochirurgische Gutachten von Prof. Dr. W., Klinikum …, vom 16. Dezember 2007 kommt zu dem Ergebnis, dass der Kläger aufgrund des Dienstunfalls eine HWS-Distorsion Grad II nach Erdmann bzw. zumindest Grad III nach Quebec Task Force erlitten habe, wenn man die pathologischen Befunde von Herrn Dr. V. als radiologische Auffälligkeiten mit hineinnehme und die Latenz der Symptome nach dem Trauma von einigen Stunden berücksichtige. Derzeit bestünden noch neuropsychologische Veränderungen wie sie von Dipl.-Psych. M. beschrieben würden. Diese seien lt. Dipl.-Psych. M. ursächlich auf das Unfallereignis zurückzuführen. Aus rein organisch-neurochirurgischer Sicht ergebe sich keine dienstunfallbedingte MdE.
b) Das Gutachten ist in sich nicht schlüssig, soweit darin die Diagnose einer HWS-Distorsion Grad II nach Erdmann bzw. Grad III nach Quebec Task Force gestellt wird. Hierfür wären objektive neurologische Befunde Voraussetzung, z. B. Verminderung der Nervenleitgeschwindigkeit, sensible und motorische Ausfälle. Derartige neurologische Ausfälle wurden jedoch nicht festgestellt (vgl. unten Nr. I.4). Die Diagnostik erfolgte auch nur unter der Bedingung, dass man die pathologischen Befunde von Dr. V. mit hinein nehme. Mit eben diesen radiologischen Befunden von Dr. V. hat sich der radiologische Gutachter Prof. Dr. B. allerdings ausführlich auseinandergesetzt und festgestellt, dass die gesamte Bewertung von Dr. V. abgelehnt werden müsse. Auch Prof. Dr. W. weist in seinem Gutachten darauf hin, dass diese Befunde von den neuroradiologischen Kollegen nicht nachvollzogen werden könnten. Weshalb der Gutachter dessen ungeachtet unter Berufung auf Dr. V. eine HWS-Distorsion höheren Grades diagnostiziert, erschließt sich nicht. Die Aussagen zu neuropsychologischen Veränderungen liegen wiederum außerhalb des Fachgebiets von Prof. Dr. W.. Sie stellen nicht das Ergebnis eigener Begutachtung dar, sondern übernehmen lediglich Angaben von Dipl.-Psych. M. (vgl. hierzu unten Nr. I.5).
c) Über die bereits festgestellte HWS-Distorsion Grad I hinaus ergeben sich aus dem Gutachten daher keine weiteren Körperschäden auf neurochirurgischem Fachgebiet, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückzuführen wären. Solche ergeben sich auch nicht aus anderweitigen, vom Kläger vorgelegten neurochirurgischen Unterlagen.
Dr. M., Facharzt für Neurochirurgie, befundet am 10. August 1998 ein Cervikalsyndrom sowie in seinem Bericht vom 25. Juni 2002 ein Cervikalsyndrom, cerviko-cephale und cerviko-encephale Symptome bei Instabilität C0/C1/C2 nach Autounfall.
Die Diagnose eines Cervikalsyndrom (Halswirbelsyndrom) mit entsprechenden Symptomen sagt jedoch nichts über einen Zusammenhang mit dem Dienstunfall aus. Der bloße anamnestische Hinweis auf die Beschwerdefreiheit vor dem Unfall und das Einsetzen der Beschwerden nach dem Unfall ist für den Nachweis einer Kausalität mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit nicht ausreichend (s.o.). Zudem handelt es sich auch bei Dr. M. um einen privat behandelnden Arzt, der nicht unumstritten ist (vgl. Spiegel …/2008: „…“).
4. Körperschäden auf neurologischem Fachgebiet
a) Das vom Beklagten eingeholte neurologisch-psychiatrische Gutachten von Prof. Dr. Dr. L.W. (Bezirkskrankenhaus …) vom 8. März 2010 kommt zu dem Ergebnis, dass sich eine substantielle traumatische Hirnschädigung, die im weiteren Verlauf zu neuropsychologischen Defiziten führen würde, nicht hinreichend sichern lasse. Der Nachweis einer traumatischen Hirnschädigung könne nach wissenschaftlichem Kenntnisstand anhand bildgebender Befunde oder aufgrund einer Bewusstseinsstörung geführt werden. Beide Nachweise ließen sich nicht führen. Ein im Sommer 1998 durchgeführtes craniales Kernspintomogramm werde als unauffällig beschrieben. Zudem sei weder unmittelbar nach dem Unfall eine längere Bewusstlosigkeit zu eruieren noch seien in den ersten Stunden und Tagen danach Verwirrtheitszustände i. S. e. sog. „Durchgangssyndroms“ aufgetreten. Der Kläger habe zumindest bei früheren Begutachtungen angegeben, sich an alle Details des Unfallereignisses erinnern zu können. Auch die Tatsache, dass er am Unfalltag noch in der Lage war, mit dem PKW annähernd 100 km zu fahren und zumindest kurzzeitig zu unterrichten, spreche entschieden gegen das Vorliegen eines solchen „Durchgangssyndroms“. Nicht zuletzt beschreibe auch der erstuntersuchende Dr. P. keinerlei derartige Auffälligkeiten. Eine traumatische Rückenmarksverletzung lasse sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Traumatische Läsionen des Rückenmarks führten so gut wie immer sofort nach dem Unfallereignis zu neurologischen Ausfällen in Form von Gefühlsstörungen und/oder Lähmungen. Ein derartiges „sensomotorisches Defizit“ sei jedoch ausdrücklich im Erstbefund von Dr. P. verneint. Selten komme es nach schweren Traumen zu sekundären Verschlechterungen durch Einblutungen. Über wenige Tage nach dem Unfall hinaus seien aber derartige Verschlechterungen nicht zu erwarten und die orthopädische Untersuchung 13 Tage nach dem Unfall verneine ausdrücklich neurologische Ausfälle. Auch bzgl. Nerven und Nervenwurzeln gelte, dass sich derartige Läsionen unmittelbar nach dem Trauma bemerkbar machten, längstens innerhalb von 1-2 Tagen. Zwar werde am 21. Oktober 1997 bei einer ersten orthopädischen Untersuchung von einem cervikalen Wurzelreizsyndrom gesprochen. Ein detaillierter Bericht liege jedoch nicht vor. Bei der zweiten orthopädischen Untersuchung acht Tage später seien dann keine weiteren Auffälligkeiten mehr beschrieben, so dass über eine vorübergehende Irritation von Nervenwurzeln bei eindeutig vorbestehenden degenerativen Veränderungen keine bleibende Schädigung zu sichern sei. Über die Diagnose einer HWS-Distorsion I. Grades hinaus sei keine strukturelle Schädigung im geforderten Vollbeweis zu sichern. Eine HWS-Distorsion I. Grades gehe nicht mit einer strukturellen Schädigung einher. Körperschäden auf neurologischem Fachgebiet ließen sich nicht mit der geforderten Wahrscheinlichkeit sichern. Auch der (nachgereichte) Untersuchungsbefund der Landesnervenklinik … vom 18. November 1997 spreche lediglich von leichten diffusen Kopfschmerzen und ungerichteten Schwindelattacken bei unauffälligem neurologischen Status, was als weiterer Beleg für eine zu diesem Zeitpunkt zwar prolongierte, insgesamt jedoch typische Symptomatik nach leichtgradiger HWS-Distorsion anzusehen sei.
Bestätigt werden die Ergebnisse des Gutachtens auch durch das vom Landgericht … eingeholte neurologische Zusatzgutachten von Prof. Dr. B. (Klinikum G) vom 14. Mai 2007. Auch dieses kommt zu dem Ergebnis, dass von neurologischer Seite kein Hinweis für das Vorliegen eines Hirntraumas zu erbringen sei. Die initialen MRT-Untersuchungen der HWS und des cranio-cervikalen Übergangs hätten keine Auffälligkeiten gezeigt. Auch ein MRT des Gehirns habe keine traumatisch bedingten Schäden gezeigt. Es ergäben sich keine Hinweise, dass der Hirnstamm oder das Rückenmark im Bereich des Übergangs zwischen Kopf und Hals oder im Halsbereich geschädigt sein könnte.
b) Das Gericht folgt den überzeugenden und in sich schlüssigen Ausführungen der Gutachten. Die Gutachten vom 8. März 2010 und 14. Mai 2007 sind nachvollziehbar und weisen keine offen erkennbaren Mängel auf. Die Gutachten überzeugen des Weiteren nach Methodik und Durchführung der Erhebungen. Die Gutachter haben die relevanten vorliegenden ärztlichen Befunde und Unterlagen umfassend ausgewertet und im Rahmen der Anamnese die Beschwerden des Klägers ausführlich eruiert. Aufgrund einer persönlichen Untersuchung des Klägers am 8. Februar 2010 bzw. 27. April 2007 haben die Gutachter einen umfassenden Untersuchungsbefund erstellt sowie elektrophysiologische Zusatzuntersuchungen (Elektroencephalographie, Akustisch evozierte Potentiale) durchgeführt. Ihre Folgerungen beruhen sowohl auf eigenen medizinischen Erkenntnissen als auch auf Befunden, die in nachprüfbarer Weise in den Gutachten selbst angegeben sind. Bei der Erstellung der Gutachtens lagen den Gutachter auch die vom Kläger bis dahin vorgelegten privatärztlichen Atteste vor bzw. wurden Prof. Dr. Dr. L.W. auch noch nachgereicht, der diese in einem Nachtrag ebenfalls noch berücksichtigt hat.
An der Sachkunde oder Unparteilichkeit der Gutachter bestehen für die Kammer keine Zweifel. Die Unparteilichkeit des Gutachters Prof. Dr. Dr. L.W. wird auch nicht aus den im Schreiben des Prozessbevollmächtigten vom … März 2010 ausgeführten Gründen in Frage gestellt. Dass der Gutachter seinen Gutachtensauftrag dadurch überschritten hätte, dass er zu psychiatrischen Fragen Stellung bezogen habe, obwohl er nur mit der Erstellung eines neurologischen Gutachtens beauftragt gewesen sei, ist nicht ersichtlich. Im Gegenteil hat der Gutachter eine eingehende psychiatrische Untersuchung gerade nicht durchgeführt (S. 34 des Gutachtens). Dass der Gutachter zu der Möglichkeit neuropsychologischer Folgeschäden Stellung genommen hat, ist nicht zu beanstanden. In dem Gutachtensauftrag des Beklagten vom 21. Oktober 2009 (S. 3) wird der Gutachter nämlich insbesondere um eine Begutachtung gebeten, inwieweit die festgestellten kognitiven Einschränkungen auf eine unfallbedingte neurologische Schädigung zurückgeführt werden können. Die diesbezüglichen Ausführungen sind vom Gutachtensauftrag daher ohne Weiteres umfasst. Insoweit ist auch die Betitelung des Gutachtens zu verstehen. Dass der Gutachter bei Unklarheiten Rücksprache mit dem Auftraggeber des Gutachtens nimmt, ist ebenfalls nicht zu beanstanden und rechtfertigt nicht, an der Unparteilichkeit des Gutachters zu zweifeln, zumal die Klärung nicht zuletzt auf Anregung des Klägers erfolgt ist.
Nach ständiger Rechtsprechung stellen im Verwaltungsverfahren eingeholte Gutachten auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zulässige Beweismittel dar, sofern sie inhaltlich und nach der Person des Sachverständigen den Anforderungen entsprechen, die an ein gerichtliches Gutachten zu stellen sind (BVerwG, B. v. 20. 2.1998 – 2 B 81/97 – juris), was vorliegend der Fall ist. Die von einer Verwaltungsbehörde bestellten Gutachter sind grundsätzlich als objektiv urteilende Gehilfen der das öffentliche Interesse wahrenden Verwaltungsbehörde und nicht als parteiische Sachverständige anzusehen (BVerwG, U. v. 28. 8.1964 – VI C 45.61 – juris). Auch die in einem anderen Gerichtsverfahren gerichtlich eingeholten Gutachten können im verwaltungsgerichtlichen Verfahren verwertet werden (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 98 Rn. 15a).
c) Die Ausführungen der Gutachter werden auch nicht durch privatärztliche neurologische Gutachten bzw. Befunde durchgreifend in Frage gestellt.
Der Konsiliarbefund der Landesnervenklinik … (Neurologische Abteilung) vom 18. November 1997 spricht von ungerichteten Schwindelattacken bei Bewegungen der HWS sowie leichten diffusen Kopfschmerzen bei unauffälligem neurologischen Status.
Prof. Dr. Dr. L.W. hat hierzu überzeugend ausgeführt, dass Ausfälle, die über eine typische Symptomatik nach leichtgradiger HWS-Distorsion hinausgingen und einen auf neurologischem Fachgebiet bestehenden Primärschaden nachweisen ließen, nicht zu erkennen seien.
Am 11. Mai 1998 diagnostizierte Dr. B., Arzt für Neurologie und Psychiatrie, „Z.n. HWS-Beschleunigungstrauma, Ausschluss Kleinhirnbrückenwinkeltumor, Ausschluss cerebrale Durchblutungsstörung, Ausschluss hirnorganisches Psychosyndrom“.
Ein Körperschaden ergibt sich aus diesen Diagnosen nicht.
Im Bericht von Dr. H. und Dr. R. (Kliniken … – Neurologisches Fach- und Rehabilitationskrankenhaus) vom 21. September 1998 werden u. a. ein vertebragener Halbseitenkopfschmerz und eine vertebragene Vertigo diagnostizierten. Hierbei handelt es sich um einen von der Wirbelsäule ausgehenden Kopfschmerz bzw. Schwindel.
Zur Kausalität dieser Diagnosen mit dem Dienstunfall werden keine näheren Ausführungen gemacht. Derartige Störungen gehen jedoch meistens vom 2. Halswirbel aus, ausgelöst durch degenerative Veränderungen. Der neurologische Befund selbst war unauffällig (vgl. S. 3 des Berichts).
Prof. Dr. B., Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, diagnostiziert in seinem neuroorthopädischen Befundbericht vom 20. Januar 2003 u. a. einen Zustand nach Akzelerations-/Dezelerationstrauma der HWS mit oberem Cervikalsyndrom mit vertebragenem Schwindel und vertebragenen Kopfschmerzen, mittlerem Cervikalsyndrom mit Cervicalgie und Schulter-Nacken-Schmerzen. Die anamnestisch fassbaren Beschwerden, der Befund der manuellen Untersuchung und die übrigen Parameter würden mit den bildgebenden Befunden einer Instabilität C1/C2 und einer Läsion des Ligamenta alaria korrelieren. Diese Langzeitsymptome nach einem Schleudertrauma seien durch zahlreiche internationale Verlaufsstudien belegt.
Die Diagnose eines Cervikalsyndrom (Halswirbelsyndrom) mit entsprechenden Symptomen sagt nichts über einen kausalen Zusammenhang mit dem Dienstunfall aus. Derartige Beschwerden können z. B. auch degenerativ bedingt sein. Auch ein Verweis auf Studien, die derartige Beschwerden als Langzeitfolgen eines Schleudertraumas belegen würden, stellt keinen Nachweis dar, dass die Befunde im Fall des Klägers mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückzuführen sind, zumal es sich bei Langzeitfolgen bei einer leichten HWS-Distorsion wie vorliegend nicht um den Regelfall, sondern um Ausnahmefälle handelt. Darüber hinaus ist eine Instabilität der HWS und eine relevante Läsion der Ligamenta alaria von den radiologischen Gutachtern Prof. Dr. B. und Prof. Dr. P. nicht bestätigt worden.
Dr. B. hat am 2. Juli 2003 ein EEG abgeleitet und festgestellt, dass die Befunde besonders bei komplexen Integrationsaufgaben wie Lesen und Rechnen eine Verstärkung der Theta-Frequenzen im frontalen Cortex ergäben. Hieraus sei zu folgern, dass diese Tätigkeiten besonders ermüdend und anstrengend seien. Da sich anamnestisch keine anderen Ereignisse ergäben, sei von einem unfallbedingten Zusammenhang dieser Pathologie auszugehen.
Prof. Dr. B. hat hierzu in seinem Gutachten nachvollziehbar ausgeführt, dass das EEG-Verfahren, mit dem Dr. B. eine Hirnschädigung nachgewiesen habe, nicht anerkannt werden könne. Dr. B. verfüge als Allgemeinarzt nicht über die Qualifikation zur Ableitung oder Auswertung eines EEGs. Das abgeleitete EEG ergebe keine Hinweise auf eine traumatische Hirnschädigung.
Aufgrund einer SPECT-Hirn-Perfusionsszintigraphie diagnostizierte Dr. L. im Schreiben vom 12. August 2004 Perfusionsstörungen in beiden Hirnhemispheren parieto-occipital einschließlich des occipitalen Sehzentrums sowie Perfusionsstörungen in der linken Frontalregion. Es bestehe keine Hypofrontalität, wie sie bei einer endogenen Depression zu diagnostizieren sei.
Abgesehen davon, dass Dr. L. zur Kausalität der festgestellten Perfusionsstörungen mit dem Dienstunfall keine Aussage trifft, hat der Gutachter Prof. Dr. Dr. W. hierzu nachvollziehbar ausgeführt, dass einer Perfusionsuntersuchung (SPECT) Jahre nach dem Unfallereignis zum einen aufgrund des zu großen zeitlichen Abstands und zum anderen aufgrund der mangelnden Spezifität des Verfahrens keine Beweiskraft zukomme. Es gebe umfangreiche Literatur zur Frage von Perfusionsstörungen bei allen möglichen Erkrankungen. Prof. Dr. B. hat in seinem Gutachten ebenfalls ausgeführt, dass die nuklearmedizinische Untersuchung, die Durchblutungsstörungen in praktisch allen Hirnbereichen nachgewiesen haben soll, in Anbetracht der fehlenden Anamnese für ein Hirntrauma (keine Bewusstlosigkeit, keine posttraumatische Verwirrtheit, kein Nachweis eines Hirntraumas im MRT) keinesfalls als Beweis für eine Hirnschädigung anerkannt werden könne.
Die Fachklinik I. (N.) diagnostiziert in ihrem Schreiben vom 4. März 2005 u. a. ein chronisches Cervikalsyndrom, Schleudertrauma der HWS 1997, Tinnitus aurium bds., psychophysische Insomnie.
Aussagen zur Kausalität der Diagnosen mit dem Dienstunfall werden in dem Bericht nicht getroffen.
Mit Schreiben vom 6. April 2005 hat Dr. K. festgestellt, dass die Werte für die neuronenspezifische Enolase (NSE) sowie das Protein S-100 beim Kläger erhöht seien. Dies weise auf eine HWS-Instabilität hin. Beim Kläger sei eine hirnorganische Erkrankung als Folge der HWS-Instabilität aufgetreten und schleichend gingen Hirnschrankenzellen und Nervenzellen zugrunde.
Prof. Dr. Dr. L.W. hat hierzu in seinem Gutachten nachvollziehbar erklärt, auch den als erhöht beschriebenen Werten NSE und S-100 käme keine Beweiskraft zu. Zum einen fänden sich erhöhte Werte bei zahlreichen gutartigen und bösartigen Erkrankungen (NSE und S-100 seien zunächst als Tumormarker eingesetzt worden). Zum anderen würden die Werte nach einer traumatischen Hirnschädigung innerhalb weniger Wochen wieder absinken. Zudem würden die Werte sehr empfindlich reagieren, wenn zwischen Blutentnahme und Laboruntersuchung die Zeit zu lang war.
Der nicht datierte Bericht von Prof. Dr. K. (… Human Brain Institute …, nach Auswertung eines quantitativen EEG zu dem Ergebnis, dass sich unter allen Bedingungen (Augen geöffnet/geschlossen, Go/NoGO task) statistisch signifikante Abweichungen von für eine gesunde Kontrollgruppe errechneten Normalwerten gezeigt hätten.
Dr. B. hat hierzu in seiner Stellungnahme vom 14. März 2016 nachvollziehbar ausgeführt, dass das von ihm durchgeführte EEG ohne Auffälligkeiten gewesen sei. Dr. K. beschäftige sich mit dem quantitativen EEG und deklariere, dass sich hiermit Diagnosen mentaler Störungen objektivieren ließen. Diese Aussagen seien falsch und unhaltbar. Hätte Dr. K. Recht, wären seine Ergebnisse von der wissenschaftlichen Welt längst verifiziert worden und hätten Einzug in die Routinediagnostik gehalten. Seit den 80iger Jahren gebe es weltweit wissenschaftliche Bestrebungen, mit dem EEG und dem daraus abgeleiteten Brain Mapping Biomarker für mentale Störungen zu etablieren. Selbst bei pathologischen Befunden erlaube die nur geringe Spezifizität keine Rückschlüsse auf Krankheitsentitäten. Standardwerke zu evozierten Potentialen und zum Brain Mapping der 80iger und 90iger Jahre seien mittlerweile verschwunden und würden nicht mehr aufgelegt. Die Methoden seien weitgehend durch Untersuchungen der funktionellen Bildgebung abgelöst worden.
Prof. Dr. L., Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, führt in seinem Befund und Gutachten über die Unfallfolgen vom 27. Juni 2010 u. a. aus, dass weder im Bereich des Halses und Nackens noch im Bereich des Gehirns minimale Schäden sicher nachgewiesen oder ausgeschlossen werden könnten. Die craniospinale Übergangsregion sei reich an Rezeptoren, die Verbindungen von Kleinhirn und Labyrinth herstellten. V.a. die obere HWS und die umgebende Muskulatur seien auf diese Weise intensiv in die Gleichgewichtsfunktionen eingebaut, was erkläre, dass auch durch reine HWS-Verletzungen ohne Mitbeteiligung des Gehirns Symptome wie Schwindel, Tinnitus usw. auftreten könnten. Diese träten auch bei Schädigung der unteren HWS auf. Bei Durchsicht der Unterlagen gehe eindeutig hervor, dass der Kläger vor dem Unfall keine wesentlichen Gesundheitsprobleme gehabt habe und als engagierter, einsatzfreudiger Lehrer aufgetreten sei. Seit dem Unfall sei er wie ausgewechselt und benötige permanente Behandlungen. Die Brückensymptome seien zwischen Unfalltag bis heute lückenlos belegt. Es komme einem ärztlichen Kunstfehler gleich zu behaupten, die Arbeitsunfähigkeit stünde nicht im Zusammenhang mit dem Dienstunfall, weil der Kläger praktisch pausenlos in Behandlung gestanden habe und eine Flut von Befundmaterial vorliege, das als beweisend eingestuft werden müsse. Das Gutachten L.W. sei fehlerhaft und unschlüssig, ruhend auf einer Untersuchung, die nicht lege arte sei. Wenn zu klären sei, ob ein Körperteil nachhaltig verletzt wurde, müsse in erster Linie diese Körperregion klinisch untersucht werden. Die Wirbelsäule scheine im Befund kaum auf. Es sei offenbar nicht aufgefallen, dass die gesamte Wirbelsäule pathologisch schon in Ruhehaltung sei, dass die Bewegungseinschränkung die obere und mittlere BWS einbeziehe und auch die Rückenmuskulatur einen Substanzschwund zeige. Die relativ gering ausgebildete Nacken- und Schultermuskulatur stelle eine Inaktivitätsatrophie dar. Jede Begutachtung einer HWS-Verletzung setze voraus, dass man die Beweglichkeit mit Winkelangaben dokumentiere und überprüfe, ob untere Wirbelsäulenabschnitte in die Funktionsbehinderung einbezogen seien. Unverständlich werde das Gutachten auch dadurch, dass eine Gynäkomastie beschrieben werde, die nicht vorhanden sei. Mit EEG und Überprüfung der akustisch evozierten Potentiale sei ein großer Aufwand betrieben worden, obwohl diese Untersuchungen zur Klärung der gegenständlichen Fragestellung nichts beitragen könnten.
Aus den Ausführungen von Prof. Dr. L. geht bereits nicht hervor, welchen weiteren Körperschaden der Kläger auf neurologischem Fachgebiet erlitten haben soll. Dass minimale Schäden im Bereich Hals/Nacken bzw. Gehirn nicht sicher auszuschließen seien, belegt nicht deren Vorhandensein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Der bloße zeitliche Zusammenhang zwischen dem Auftreten der gesundheitlichen Probleme und dem Dienstunfall genügt ebenso wie die in der Folge durchgeführten zahlreichen Behandlungen nicht, um einen ursächlichen Zusammenhang im Rechtssinne zu begründen. Das Gutachten von Prof. Dr. Dr. L.W. wird durch Prof. Dr. L. nicht durchgreifend in Frage gestellt. Prof. Dr. Dr. L.W. hat den Kläger untersucht und dabei auch die Kopfbeweglichkeit überprüft. Zu beachten ist jedoch, dass es sich nicht um eine orthopädische Begutachtung, sondern um eine neurologische Begutachtung gehandelt hat. Warum ein EEG und die Überprüfung der akustisch evozierten Potentiale nichts zur Klärung der Beweisfrage beitragen können, welche Körperschäden der Kläger auf neurologischem Fachgebiet durch den Dienstunfall erlitten hat, ist nicht nachvollziehbar. Die von Prof. Dr. L. bestrittene Feststellung einer Gynäkomastie ist für die weitere neurologische Begutachtung ohne Bedeutung.
d) Schließlich wird das Gutachten von Prof. Dr. Dr. L.W. auch nicht durch die Ausführungen im klägerischen Schriftsatz vom … Juli 2010 durchgreifend in Frage gestellt.
Dass der Kläger eine leichte HWS-Distorsion erlitten hat mit den hierfür gängigen Symptomen, ist unstrittig. Eine Primärverletzung, d. h. ein Nachweis struktureller morphologischer Schäden, die die vom Kläger nach wie vor geklagten Beschwerden erklären könnten, ergibt sich hieraus jedoch nicht. Eine leichte Muskelzerrung wäre hierfür jedenfalls nicht ausreichend. Dass auch banal erscheinende Unfälle zu manifesten oder schwerwiegenden Verletzungen führen können, trifft sicherlich zu, bedeutet jedoch nicht, dass dies ohne entsprechenden morphologischen Nachweis im Fall des Klägers der Fall war. Die initiale klinische Beschwerdesymptomatik hat der Gutachter angesichts des ärztlichen Erstbefundes zutreffend erfasst, der ausführt, dass keine Beschwerden nachweisbar seien. Dass sich der Kläger angesichts des eben erlebten Unfalls für den Schulleiter erkennbar auffällig verhalten hat, rechtfertigt den Schluss auf eine relevante Beschwerdesymptomatik nicht. Neurologisch ist ohnehin wesentlich, dass es im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unfall zu keinen Ausfallerscheinungen gekommen ist. Den Bericht der Landesnervenklinik … hat der Gutachter entgegen der Ausführungen des Klägers nachträglich berücksichtigt, nachdem er ihm zugesandt wurde. Dass es sich nicht unbedingt um Spannungskopfschmerz handeln muss, sondern auch um einen medikamenteninduzierten Kopfschmerz handeln kann, belegt nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass der Kopfschmerz des Klägers ein solcher ist. Auch dass es chronische Schmerzverläufe bei Schleudertraumen auch ohne nachweisbare strukturelle unfallbedingte Läsionen geben kann, belegt nicht, dass die Schmerzen des Klägers kausal auf den Dienstunfall zurückzuführen wären. Durch den Ausschluss anderweitiger Krankheitsursachen, der angesichts degenerativer Veränderungen der HWS des Klägers ohnehin nicht ersichtlich ist, lässt sich im Dienstunfallrecht eine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht begründen. Die zitierten Aussagen zu neuropsychologischen Befunden entsprechen den Ausführungen des Gutachters. Zu den weiteren Befunden (SPECT, digitales EEG etc.) wurde oben bereits Stellung genommen. Bzgl. der weiteren Ausführungen zur Neuropsychologie wird auf Nr. I.6 verwiesen.
5. Körperschäden auf neuropsychologischem Fachgebiet
a) Nach dem vom Beklagten eingeholten neuropsychologischen Gutachten der Prof. Dr. W. und Z. (…-Institut für Psychiatrie) vom 4. März 2009 hätten sich bei den neuropsychologischen Untersuchungen im Bereich Aufmerksamkeit durchweg deutliche Minderleistungen gezeigt. Bei einfachen Reaktionsaufgaben, die eine längerfristige gleichmäßige Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit erforderten, seien Bearbeitungsgeschwindigkeit und Schwankungsbreite des Aufmerksamkeitsniveaus unterdurchschnittlich gewesen. Aufgaben, die eine selektive Reaktion unter zeitkritischen Bedingungen erfordern, seien unterdurchschnittlich schnell, aber mit noch durchschnittlicher Leistungsgüte bearbeitet worden. Aufgaben, die eine Teilung der Aufmerksamkeit erfordern, seien weit unterdurchschnittlich, die selektive Wahrnehmung leicht unterdurchschnittlich gewesen. Im Bereich Lernen/Gedächtnis hätten sich keine Minderleistungen gezeigt. Im Bereich Exekutive Funktionen hätten sich weitgehend unauffällige Ergebnisse gezeigt, sowohl hinsichtlich der kognitiven und verbalen Flexibilität mit Ausnahme einer reduzierten semantischen Wortflüssigkeit. Der Kläger habe in Maßen motiviert und leistungsbereit mitgearbeitet. Wiederholt und demonstrativ habe er auf seine Beeinträchtigungen hingewiesen. Die Belastbarkeit sei reduziert gewesen. Zusammenfassend habe der Kläger auf neuropsychologischem Fachgebiet aufgrund des Dienstunfalls Störungen der Aufmerksamkeit, insbesondere der kognitiven Leistungsgeschwindigkeit, der Daueraufmerksamkeit und der geteilten Aufmerksamkeit erlitten. Diese Störungen seien erstmals im Juli 1998 von den Kliniken … festgestellt worden und im Wesentlichen unverändert bestehen geblieben. Es sei davon auszugehen, dass die beeinträchtigten Aufmerksamkeitsleistungen als Folge des Dienstunfalls auf neuropsychologischem Fachgebiet einzustufen sei. Andere Ursachen, die ebenfalls solche Störungen verursachen könnten, seien aus der Anamnese oder Befunderhebung nicht bekannt und hätten in der aktuellen Untersuchung nicht festgestellt werden können. Auf Vorschäden gebe es auf neuropsychologischem Fachgebiet keine Hinweise. Störungen der Aufmerksamkeit seien nach HWS-Schleudertrauma in der Fachliteratur wiederholt als persistierende funktionelle Folge objektiviert worden. Die dienstunfallbedingte MdE sei mit 30 v. H. zu bewerten. Eine nochmalige neuropsychologische Rehabilitationsbehandlung werde nur zum Erfolg führen können, wenn zunächst das Schmerzsyndrom des Klägers gebessert würde. Der Kläger sei am 1. Juli 2006 aus neuropsychologischer Sicht dienstunfähig gewesen.
In einer ergänzenden Stellungnahme vom 16. April 2009 wurde weiter ausgeführt, dass die festgestellten kognitiven Leistungseinbußen des Klägers bereits im Befundbericht der Kliniken …. vom 7. Juli 1998 beschrieben seien. Die Leistungseinbußen könnten daher weder auf spätere Ereignisse zurückgeführt werden noch seien dem Unfallgeschehen vergleichbare Einwirkungen aus der Anamnese bekannt. Es handle sich somit um Funktionseinbußen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf das Unfallgeschehen zurückzuführen seien. Das Fehlen morphologischer Schäden im Zentralnervensystem spreche nicht gegen die Annahme, dass es sich um objektive Leistungseinbußen handelt, da eine morphologische Schädigung des Gehirns einen gewissen Schweregrad aufweisen müsse, damit diese in bildgebenden Verfahren nachgewiesen werden könne. Die neuropsychologischen Befunde seien als solche gültig und aussagekräftig. Sie bedürften keiner Verifikation durch bildgebende Verfahren. In der wissenschaftlichen Diskussion zur Entstehung kognitiver Leistungseinbußen werde davon ausgegangen, dass jede Form pathologischer Prozesse im Gehirn zu einer allgemeinen Reduzierung der kognitiven Ressourcen führen könne, ohne dass es einer nachweisbaren strukturellen Hirnschädigung bedürfe. Diese Reduzierung der allgemeinen kognitiven Ressourcen führe vor allem zu einer Beeinträchtigung von Aufmerksamkeitsleistungen.
b) Dem Gutachten und Ergänzungsgutachten der Prof. Dr. W. und Z kann das Gericht nicht folgen, da es in sich nicht schlüssig ist. Nach der Leitlinie „Neuropsychologische Begutachtung“ (Zeitschrift für Neuropsychologie, 2015 S. 289 ff.) „beantworten neuropsychologische Gutachten Fragen nach dem Ausmaß von Hirnfunktionsstörungen und möglichen sekundären psychischen Störungen in Folge von Erkrankungen oder Verletzungen des zentralen Nervensystems. […] Neurologische und neurochirurgische Gutachter stellen mit Hilfe neurologischer Untersuchungsverfahren, bildgebender Verfahren und weiterer apparativer Zusatzuntersuchungen den Umfang und das Ausmaß pathologischer Strukturveränderungen des zentralen Nervensystems und deren somatische Folgen fest. Dies dient in der Beweiskette als Nachweis eines schädigenden Ereignisses.“
Vor diesem Hintergrund können die gutachterlichen Aussagen bereits nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit belegen, dass die festgestellten Funktionseinbußen tatsächlich auf einer Verletzung des Gehirns beruhen und damit neuropsychologisch bedingt sind. Denn morphologische Schäden des Gehirns konnten von den neurologischen Gutachtern Prof. Dr. Dr. L.W. und Prof. Dr. B. gerade nicht festgestellt werden (s.o.). Die im Wesentlichen festgestellten Aufmerksamkeitsstörungen können wiederum ihre Ursache auch außerhalb struktureller Hirnschäden haben (vgl. Prof. Dr. Dr. L.W., Dipl.-Psych. M. s.u.) und sind daher nicht zwingend als Folge von Erkrankungen oder Verletzungen des zentralen Nervensystems anzusehen. Zudem ist festzustellen, dass der Kläger lt. Gutachten bei den Testverfahren nur mäßig motiviert mitgewirkt habe, so dass sich zumindest die Frage stellt, ob dies nicht Einfluss auf das Ergebnis gehabt haben könnte.
Abgesehen davon vermögen die gutachterlichen Aussagen aber auch nicht den Kausalzusammenhang zwischen dem Dienstunfall und den behaupteten neuropsychologischen Funktionsstörungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachzuweisen. Der bloße zeitliche Zusammenhang zwischen dem Auftreten der vom Gutachter angenommenen Funktionseinbußen und dem Dienstunfall genügt nicht, um einen ursächlichen Zusammenhang im Rechtssinne zu begründen. Auch dass dem Unfall vergleichbare Einwirkungen oder Vorerkrankungen, die ebenfalls solche Störungen hervorrufen könnten, aus der Anamnese bzw. der Befunderhebung nicht bekannt seien, genügt für den Nachweis eines Kausalzusammenhangs mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Es gibt im beamtenrechtlichen Dienstunfallrecht ebenso wie im Bereich des Arbeitsunfalls (vgl. BSG, U. v. 9.5.2006 – B 2 U 26/04R – juris) keine Beweisregel, dass bei fehlender Alternativursache die dienstunfallbedingte naturwissenschaftliche Ursache auch eine wesentliche Ursache ist, weil dies bei komplexem Krankheitsgeschehen zu einer Beweislastumkehr führen würde. Die anspruchsbegründende Voraussetzung des Ursachenzusammenhangs ist vielmehr positiv festzustellen.
Prof. Dr. Dr. L.W. hat in seinem Gutachten vom 8. März 2010 folglich nachvollziehbar darauf hingewiesen, dass Prof. Dr. W./Z… insbesondere eine klare Diskussion des Primärschadens vermissen lasse, wenn lediglich darauf hingewiesen werde, es handle sich bei den festgestellten kognitiven Leistungseinbußen um typische Funktionsstörungen nach Schleudertraumen und die neuropsychologischen Befunde seien als solche gültig und aussagekräftig und es bedürfe keiner nachweisbaren strukturellen Hirnschädigung. Die Kausalitätsdiskussion erschöpfe sich vor allem darin, dass andere Ursachen, die ebenfalls solche Störungen verursachen könnten, aus der Anamnese und Befunderhebung nicht bekannt seien. Er bleibe jedoch den Beweis schuldig, auf welcher morphologischen Schädigung von Hirnstrukturen – ansonsten wären neurokognitive Defizite nicht zu erklären – dies beruhe. Aufmerksamkeitsstörungen könnten zahlreiche Ursachen haben und seien im Übrigen auch nicht zwingend an das Vorhandensein struktureller Hirnschäden gebunden. Nicht zuletzt wäre auch kaum die Verschlechterung seit 1998 erklärbar. Dies sei diametral zum Verlauf, der nach einer traumatischen Hirnschädigung zu erwarten wäre. Zumindest nach leichteren Hirnschäden komme es im Verlauf weniger Jahre regelmäßig zu Verbesserungen oder die Situation stagniere, verschlechtere sich jedoch nicht. Sekundäre Verschlechterungen seien ausschließlich nach schweren und schwersten Hirntraumen bekannt, wenn degenerative Prozesse der Nervenfasern angestoßen würden. Auch Dr. B. führt in seinem Gutachten vom 22. Juli 2014 aus, dass beim Kläger der positive Nachweis einer Hirnsubstanzschädigung oder der eines Schädel-Hirn-Traumas nicht habe erbracht werden können, daher auch keine neuropsychologischen oder neurokognitiven Auffälligkeiten bestehen könnten.
Zwar wird in den o.g. Leitlinien ausgeführt, dass zu beachten sei, dass erworbene neuropsychologische Funktionsstörungen auch ohne – mit den derzeitigen medizintechnischen Verfahren nachweisbare – morphologische Veränderungen des zentralen Nervensystems möglich sind. Hierauf berufen sich sowohl Prof. Dr. W. als auch Dipl.-Psych. M. (s.u.). Ein Nachweis der Kausalität derartiger Funktionsstörungen mit dem Dienstunfall ist jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erbracht, wenn sich eine kausale morphologische Schädigung des Gehirns durch den Dienstunfall nicht nachweisen lässt, zumal es durchaus weitere Erklärungsansätze für die festgestellten Funktionsstörungen gibt. Prof. Dr. W. führt selbst aus, dass jede Form pathologischer Prozesse im Gehirn zu einer allgemeinen Reduzierung der kognitiven Ressourcen führen könne, ohne dass es einer nachweisbaren strukturellen Hirnschädigung bedürfe. Dass es sich hierbei allein um durch den Dienstunfall ausgelöste pathologische Prozesse handeln soll, lässt sich aber durch den bloßen zeitlichen Zusammenhang und die Anamnese nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit begründen, zumal einerseits nach der o.g. Leitlinie auch Erkrankungen zu neuropsychologischen Funktionsstörungen führen können und anderseits Aufmerksamkeitsstörungen nicht zwingend an das Vorhandensein struktureller Hirnschäden gebunden sind, wie sowohl Prof. Dr. Dr. L.W. als auch Dipl.-Psych. Dr. M. bestätigen. Die Aufmerksamkeitsstörungen könnten demzufolge auch eine andere Ursache als pathologische Vorgänge im Gehirn haben.
Vor diesem Hintergrund hat das Gutachten nicht nachgewiesen, dass der anerkannte Dienstunfall die kognitiven Leistungseinbußen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verursacht hat.
c) Ein Nachweis der Kausalität neuropsychologischer Funktionseinbußen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit lässt sich auch nicht aus den weiteren vom Kläger vorgelegten ärztlichen Berichten und Attesten herleiten.
Die Kliniken …. beurteilen eine neuropsychologische Testung des Klägers vom Juli 1998 in ihrem Bericht vom 21. September 1998 dahingehend, dass der Kläger im Gruppen-Hirnleistungstest insgesamt knapp altersadäquate Leistungen erziele, bei Tempoanforderungen an Konzentration und Aufmerksamkeit seien die Leistungen quantitativ wie qualitativ teilweise unterdurchschnittlich. Der kognitive Leistungsstatus liege deutlich unter den mutmaßlichen Leistungen einer vergleichbaren Person mit Hochschulabschluss. Die Durchführung des Tests sei nur möglich gewesen, weil der Kläger bereit gewesen sei, bis an seine momentanen Leistungsgrenzen heranzugehen. Die überwiegend deutlich verlangsamten Aufmerksamkeitsleistungen, die hohe Varianz der Einzelreaktionen und der symptomatische Leistungsabfall in der 2. Hälfte des Reaktionstests seien Anzeichen einer schwerstgradigen Belastbarkeitsminderung und mit der medizinischen Diagnose gut vereinbar.
Dass die festgestellte Belastbarkeitsminderung mit der medizinischen Diagnose „gut vereinbar“ sei, begründet schon vom Wortlaut her keinen Nachweis einer mit an Sicherheit grenzenden Kausalität mit dem Dienstunfall. Im Übrigen wird im Hinblick auf den nicht nachweisbaren Primärschaden und die Folgen für den Nachweis der Kausalität auf obige Ausführungen verwiesen.
Dr. B. spricht in seinem Schreiben vom 22. Juni 2002 von einer hirnorganischen Wesensänderung mit Antriebsstörungen, Emotions- und Stimmungsstörungen. Im Schreiben vom 19. August 2004 wird ausgeführt, beim Kläger liege ein TBI (traumatic brain injury) vor mit posttraumatischem hirnorganischen Psychosyndrom mit konzentrativer Minderbelastbarkeit und Störung der geteilten Aufmerksamkeit bei linkstemporaler Verlangsamung im EEG und linksseitiger parietooccipitaler Perfusionsstörung im SPECT incl. des Sehzentrums. Die psychomentale Dauerbelastung und Daueraufmerksamkeit sei erheblich beeinträchtigt.
Weder handelt es sich bei Dr. B. aber um einen entsprechenden Facharzt noch werden in dem Schreiben zur Kausalität mit dem Dienstunfall tragfähige Aussagen gemacht.
Prof. Dr. B. diagnostiziert in seinem neuroorthopädischen Befundbericht vom 20. Januar 2003 u. a. ein cervikoencephales Syndrom mit Hirnfunktionsstörungen, Antriebs- und Stimmungsstörungen sowie vegetative Störungen. Diese Langzeitsymptome nach HWS-Schleudertrauma seien durch zahlreiche Verlaufsstudien belegt.
Es ist bereits nicht nachvollziehbar, wie Prof. Dr. B. zu der o.g. Diagnose kommt, da er lediglich eine neuroorthopädische sowie eine neurologische Untersuchung durchgeführt hat und ihm ausweislich des Berichts auch keine Befunde bzgl. Hirnfunktionsstörungen vorlagen. Allein die Anamnese kann eine derartige Diagnose weder begründen noch ist mit dem Hinweis auf Studien, die Hirnfunktionsstörungen als mögliche Langzeitfolge bei HWS-Schleudertrauma belegen sollen, im Falle des Klägers die Kausalität derartiger Funktionsstörungen mit dem Dienstunfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen.
Nach dem neuropsychologischen Bericht der Fachklinik I. (Dipl.-Psych. K.) vom 21. Februar 2005 hätten sich bei der neuropsychologischen Untersuchung des Klägers deutliche und alltagsrelevante Defizite in den Bereichen Aufmerksamkeit (komplexe Aufmerksamkeitsprozesse, Daueraufmerksamkeit, stark verlangsamte kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit) sowie leichte bis mittelgradige Defizite bei der verbalen Merk- und Lernfähigkeit gezeigt. Die psychomentale Dauerbelastbarkeit sei reduziert auf 1,5 Stunden pro Tag.
Zur Kausalität der festgestellten Defizite mit dem Dienstunfall werden weder in dem neuropsychologischen Bericht noch in dem Bericht der Fachklinik I. vom 4. März 2005 tragfähige Aussagen getroffen.
Das von der Regierung von Oberbayern veranlasste neuropsychologische Gutachten von Dipl.-Psych. M. vom 6. Juli 2005 kommt zu dem Ergebnis, dass im Bereich der Aufmerksamkeit z.T. deutliche konzentrative Schwankungen bestünden, die bei reaktionsgesteuerten Aufgaben zu einer Reduktion der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit führe. Des Weiteren sei der Kläger nicht zu einer Teilung der Aufmerksamkeit in der Lage, der rasche Wechsel der Aufmerksamkeit sei ebenfalls reduziert. Eine erhöhte interne Ablenkbarkeit sei zu vermuten. Die selektive Wahrnehmung sei unbeeinträchtigt; eine erhöhte externe Ablenkbarkeit sei nicht beobachtet worden. Bzgl. der kognitiven Dauerbelastbarkeit sei von einer deutlichen Reduktion auszugehen. Bereits nach knapp zwei Stunden testpsychologischer Untersuchung hätten sich deutliche Ermüdungserscheinungen gezeigt. Im Bereich des Gedächtnisses bestünden deutliche Leistungsschwankungen bzgl. der Aufnahme, dem Lernen, und dem Behalten von Informationen. Das Arbeitsgedächtnis sei auf höherem Anforderungsniveau beeinträchtigt. Im Bereich des Planens bestünden deutliche Defizite auf höherem Anforderungsniveau.
Zur Kausalität der festgestellten Defizite mit dem Dienstunfall werden in dem Bericht von Frau Dipl.-Psych. M. vom 6. Juli 2005 keine tragfähige Aussagen getroffen.
In dem vom Kläger in Auftrag gegebenen neuropsychologischen Gutachten vom 11. Juli 2012 führt Frau Dipl.-Psych. M. aus, dass der Zusammenbruch 2002 eine mittelbare Unfallfolge darstelle. Er resultiere v.a. aus einer chronischen, kumulativen Überforderung durch eine erhöhte Anstrengung zur Kompensation der unfallbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Weitere auslösende Bedingungen seien die belastenden Verhandlungen mit der gegnerischen Versicherung sowie das Scheitern der Ehe gewesen. Beide Faktoren seien definitiv auf den Unfall zurückzuführen. Andere mögliche Ursachen des Zusammenbruchs seien weder in den Vorbefunden erwähnt worden noch erscheine ein bisher unbekannter Faktor als Erklärung plausibel. Der Zusammenbruch lasse sich rückwirkend hinreichend erklären, sei aber nicht i. S.e. Zwangsläufigkeit vorhersehbar gewesen. Zustimmen könne man Prof. Dr. Dr. L.W. bzgl. seiner Aussage, dass Aufmerksamkeitsstörungen zahlreiche Ursachen haben können und im Übrigen nicht zwingend an das Vorhandensein struktureller Hirnschäden gebunden seien. Eine mögliche Ursache von Aufmerksamkeitsstörungen seien nämlich chronische Schmerzen, die beim Kläger bestünden. Es liege eine chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren vor. Die durch mehrere neuropsychologische Untersuchungen objektivierten kognitiven Defizite bedürften somit nicht zwingend des Nachweises einer strukturellen Hirnschädigung. Dass sich bei leichteren Schäden die kognitive Leistungsfähigkeit verbessere oder stagniere, aber nicht verschlechtere, sei falsch. Es werde auch darauf hingewiesen, dass den Empfehlungen der Leitlinie zur Begutachtung von gedeckten Schädelhirntraumen im Fall des Klägers nicht gefolgt worden sei. Das erste MRT des Schädels habe erst im Juli 1998, also neun Monate nach dem Unfall, stattgefunden. Dass Maßnahmen, mit denen der Nachweis einer substantiellen Hirnschädigung hätte geführt werden können, nicht zeitnah durchgeführt worden seien, sollte nicht zulasten des Klägers gehen.
Der Nachweis der Kausalität der festgestellten Funktionseinbußen mit dem Dienstunfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ergibt sich aus den Ausführungen von Dipl.-Psych. M. nicht. Die Gutachterin macht Ausführungen dazu, dass die Verschlechterung der Funktionsdefizite im Jahr 2002 entgegen der Ausführungen von Prof. Dr. Dr. L.W. plausibel wäre, da die Auswirkungen der Funktionsdefizite zunächst mit hohem Energieaufwand in Grenzen gehalten worden seien, der aufgrund weiterer kraftraubender Faktoren wie den Verhandlungen mit der Versicherung und dem Scheitern der Ehe 2002 nicht mehr möglich gewesen sei, so dass sich die Funktionsdefizite dann verschlechtert hätten. Anzumerken ist, dass schon nicht nachvollziehbar ist, dass etwa das Scheitern der Ehe allein oder wesentlich auf den Dienstunfall zurückgeführt wird. Auch geht das Gutachten offenbar von einem gedeckten Schädel-Hirn-Trauma aus, das der Kläger nicht erlitten hat. Abgesehen davon werden zur Kausalität der kognitiven Leistungseinbußen mit dem Dienstunfall keine über das Gutachten von Prof. Dr. W./Z… hinausgehenden Aussagen getroffen. Dass es neuropsychologische Defizite auch ohne den Nachweis morphologischer Hirnveränderungen geben mag, hat nicht zur Folge, dass die Funktionseinbußen im Fall des Klägers mit dem erforderlichen Grad an Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückzuführen wären (s.o. unter b). Vielmehr ist auch Dipl.-Psych. M. wie Prof. Dr. Dr. L.W. der Auffassung, dass Aufmerksamkeitsstörungen nicht zwingend an das Vorhandensein struktureller Hirnschäden gebunden seien. Eine mögliche Ursache von Aufmerksamkeitsstörungen seien etwa chronische Schmerzen, die beim Kläger bestünden. Es gibt also auch nach Auffassung der Gutachterin neben einer – nicht nachweisbaren – unfallbedingten Hirnschädigung weitere Ursachen von Aufmerksamkeitsstörungen, die beim Kläger auch nicht auszuschließen sind. Die von der Gutachterin angenommenen chronischen Schmerzen lassen sich zum einen nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit belegen (vgl. Gutachten Dr. B. unten I.6) und zum anderen vor dem Hintergrund nachgewiesener degenerativer Veränderungen der Halswirbelsäule des Klägers nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückführen.
Nach alledem steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger keine weiteren Körperschäden auf neuropsychologischem Gebiet erlitten hat, die sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall des Klägers zurückführen lassen.
6. Körperschäden auf algesiologischem/psychiatrischem Fachgebiet
a) Der Sachverständige Dr. B. (…-klinik) kommt in seinem neurologisch/psychiatrisch/algesiologischen Gutachten vom 22. Juli 2014 zu dem Ergebnis, dass es im Rahmen des Dienstunfalls zu einer leichten HWS-Beschleunigungsverletzung Grad II (Quebec Task Force) gekommen sei. Des Weiteren wurden eine Anpassungsstörung und eine fragliche chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren diagnostiziert. Die Diagnosekriterien einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung seien nicht erfüllt. Man würde als vordergründiges Symptom einen andauernden, schweren und quälenden Schmerz erwarten, der durch einen physiologischen Prozess oder durch eine körperliche Störung nicht vollständig erklärt werden könne. Die Folge sei stets eine beträchtliche persönliche oder medizinische Betreuung oder Zuwendung. Nach Einschätzung des Gutachters leide der Kläger an keinem anhaltenden und quälenden Schmerz. Der bisherige Verlauf sowie die geklagte Beschwerdesymptomatik werfe einige Fragen auf. Ungewöhnlich sei, dass sich die Beschwerdesymptomatik nach HWS-Beschleunigungsverletzung zunächst bessere, so dass der Kläger von 1998 bis 2002 wieder eine Teilzeittätigkeit habe ausüben können, sich nach seiner Verbeamtung sekundär jedoch wieder verschlechtere. Inplausibel erschienen die Angaben zur Beschwerdesymptomatik mit Zunahme der körperlichen Symptome, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen und Tinnitus in ungefederten Zügen, anderseits ihm Nordic Walking keine Probleme bereite. Schwindel und Taumel sei einerseits sehr ausgeprägt, Kopfbeweglichkeit und Beweglichkeit der Augen nur eingeschränkt möglich, andererseits bestehe beim Fahren eines Pkw keine Beeinträchtigung. Freizeitaktivitäten, ein zuletzt gemachter Urlaub in .., sowie das Etablieren einer Partnerschaft vor drei Jahren sprächen ebenfalls gegen eine Beschwerdesymptomatik in dem vom Kläger geschilderten Ausmaß. Aufgrund der vehementen Ablehnung einer Blutentnahme müsse sogar an der Regelhaftigkeit oder überhaupt der Einnahme von Ibuprofen gezweifelt werden. Der Kläger habe als Grund angegeben, Angst vor Nadeln zu haben, lasse sich jedoch in regelmäßigen Abständen im Bereich der HWS thermoagulieren. Kognitive Defizite bestünden nicht. Der Kläger sei außerordentlich wendig und geistig rege, flexibel und schnell, habe sich zwischenzeitlich die HWS-Beschleunigungsverletzung zu einem wesentlichen Lebensinhalt gemacht und auf diesem Gebiet ein Buch herausgegeben. In Bezug auf die bereits psychiatrischerseits diagnostizierte Anpassungsstörung als Zustand von subjektivem Leiden und emotionaler Beeinträchtigung nach einem belastenden Lebensereignis sei anzumerken, dass individuelle Prädisposition oder aber Vulnerabilität eine große Bedeutung beigemessen werden müsse. Oft handele es sich um Angstzustände und depressive Reaktionen. Hier gingen auch alle möglichen unfallunabhängigen psychosozialen Komponenten (Partnerschaftsprobleme, Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Einbußen etc.) ein. Das Unfallereignis selbst sei nicht von einer Schwere gewesen, dass ein bleibender Schaden zu erwarten wäre. Die dienstunfall-assoziierte MdE werde auf 20% für sechs Monate eingeschätzt, danach keine MdE mehr. Es ergäben sich nach Aktenlage keine Hinweise dafür, dass sich der Kläger nicht spätestens nach einem halben Jahr von den Folgen des Unfalls erholt hätte. Es ergäben sich keine Hinweise dafür, dass nicht von einem regelrechten Heilungsverlauf der HWS-Beschleunigungsverletzung auszugehen sei. Eine unfallbedingte Beeinträchtigung des Hör- und Gleichgewichtsorgans habe nicht stattgefunden. Der fehlende Nachweis einer Verletzung des Gehirns schließe konsequenterweise auch jegliche neurokognitive und neuropsychologische Auffälligkeit als unfallassoziierte Folge aus. Die Diagnose einer Anpassungsstörung hat der Sachverständige bei seiner Vernehmung in der mündlichen Verhandlung am 3. Dezember 2015 revidiert. Er habe sich insoweit von der Diagnose im Gutachten von Prof. Dr. N. leiten lassen. Nach ICD-F 43.2 dürfe diese Anpassungsstörung nicht länger als sechs Monate nach dem Ereignis vorliegen, es sei denn es gebe eine depressive Begleitsymptomatik. Eine solche liege beim Kläger nicht vor.
b) Das Gericht folgt den überzeugenden und in sich schlüssigen Ausführungen des Gutachtens. Das Gutachten vom 22. Juli 2014 in Zusammenschau mit den gutachtlichen Stellungnahmen vom 13. Januar 2015 und 14. März 2016 sowie den in der mündlichen Verhandlung am 3. Dezember 2015 gegebenen Erläuterungen ist in sich schlüssig und weist keine offen erkennbaren Mängel auf. Der Sachverständige hat nachvollziehbar erläutert, warum der Kläger an keiner anhaltenden somatoformen Schmerzstörung und keiner Anpassungsstörung leidet. Die als fraglich eingestufte chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren ist bereits nicht mit der erforderlichen mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen. Zudem fehlt es an einem Nachweis der Kausalität mit dem Dienstunfall. Das Gutachten überzeugt nach Methodik und Durchführung der Erhebungen. Der Gutachter hat die relevanten Gutachten und Befunde der beigezogenen Akten umfassend ausgewertet und im Rahmen der Anamnese die Beschwerden des Klägers ausführlich eruiert. Aufgrund einer persönlichen Untersuchung des Klägers hat er des Weiteren einen umfassenden Untersuchungsbefund am 12. Mai 2014 erstellt. Seine Folgerungen beruhen sowohl auf eigenen medizinischen Erkenntnissen als auch auf Befunden, die in nachprüfbarer Weise in dem Gutachten selbst angegeben sind. Bei der Erstellung des Gutachtens lagen dem Gutachter auch die vom Kläger bis dahin vorgelegten relevanten privatärztlichen Atteste vor.
Die gegen das Gutachten vorgebrachten Einwendungen des Klägers können das Gutachten nicht durchgreifend in Frage stellen:
Nr. 3 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Zwar zitierte der Sachverständige das unfallanalytische Gutachten der O. insoweit unrichtig, als er von einer Differenzgeschwindigkeit von 9-11 km/h spricht, wohingegen das Gutachten der O. eine kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung von 9-11 km/h feststellt. Dies führt jedoch im Ergebnis zu keiner anderen Beurteilung, da der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung unter Bezugnahme auf eine wissenschaftliche Untersuchung (R.) ausgeführt hat, dass bis zu einer Differenzgeschwindigkeit von 30 km/h keine strukturellen Verletzungen an der Wirbelsäule entstünden. Im Übrigen sind solche auch nicht nachgewiesen worden (s.o.).
Nr. 4 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Dass der Sachverständige mangels positiven Nachweises einer Hirnsubstanzschädigung oder eines Schädel-Hirn-Traumas neuropsychologische oder neurokognitive Auffälligkeiten als unfallassoziierte Folge ablehnt, ist kein Mangel des Gutachtens, sondern die Konsequenz aus der Kausalitätslehre im Dienstunfallrecht (vgl. oben Nr. 5 b). In seiner ergänzenden Stellungnahme hat der Sachverständige zudem ausgeführt, dass bei fehlender Schädel-Hirn-Verletzung und völlig fehlendem Nachweis morphologischer Befunde, die Aussage in Bezug auf die geltend gemachten Entschädigungsansprüche unverändert Gültigkeit besitze. Mit der vom Kläger zitierten Studie hat sich der Sachverständige in seiner Stellungnahme vom 13. Januar 2015 auseinandergesetzt und nachvollziehbar dargestellt, dass sich die Studie lediglich mit Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas befasst, das der Kläger nachweislich nicht erlitten hat. Zudem vermögen auch die Aussagen der Studie ohne morphologischen Nachweis keine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit des Kausalzusammenhangs der Funktionseinbußen mit dem Dienstunfall zu begründen.
Nr. 5 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Dass in einem Gutachten frühere Befunde und Vorgutachten nur in begrenztem Umfang wiedergegeben werden können, liegt in der Natur der Sache. Ein Mangel ist auch nicht darin zu erkennen, dass Dr. B. die Ausführungen von Prof. Dr. N., dass in Betracht zu ziehen sei, dass die aktuell bestehende psychische Symptomatik keine direkte Folge des Unfalls sein könnte, sondern vielmehr auf die in den letzten Jahren hinzugetretenen psychosozialen Belastungsfaktoren zurückzuführen sei, im Ergebnis dahingehend wiedergegeben hat, dass Prof. Dr. N. einen unfallassoziierten Zusammenhang als nicht wahrscheinlich angesehen hat. Diese Auslegung ist durchaus nachvollziehbar.
Nr. 6 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Es ist nicht zu beanstanden, dass der Sachverständige weiteren Kontakt zum Kläger über den Begutachtungstermin hinaus im Gutachten offenlegt.
Nrn. 2.2, 5.1, 7, 11, 15 und 17 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Schreibfehler bzw. für die Begutachtung irrelevante Ungenauigkeiten (Urlaubsort … oder …/Unfallort … oder …/5 oder 10 Minuten Pause etc.), können wesentliche Mängel des Gutachtens nicht begründen. Darüber hinaus wurden nach Erinnerung des Sachverständigen die Angaben zum Teil tatsächlich wie im Gutachten angegeben gemacht, so dass die Urheberschaft der Ungenauigkeiten z.T. unklar bleibt.
Nr. 8 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Der Sachverständige kann und muss sich bei der Darstellung der Aktenlage auf die aus seiner Sicht für die Begutachtung wesentlichen Befunde beschränken.
Nr. 16 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Dass Passagen nachträglich hinzugefügt worden seien, ist eine bloße Behauptung des Klägers, gegen die sich der Sachverständige glaubhaft verwahrt hat.
Nr. 18 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Zur Dauer der Exploration und der Tatsache, dass hierin zwei lange apparative Untersuchungen gerade nicht enthalten waren, hat der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 13. Januar 2015 unter Verweis auf das Klinikkommunikationssystem ausführlich Stellung genommen. Die Angaben im klägerischen Schriftsatz sind daher nachweislich nicht richtig.
Nr. 21 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Der Sachverständige hat in seiner ergänzenden Stellungnahme hierzu ausgeführt, dass er sich gut erinnern könne, dass der Kläger bei der Begutachtung erklärt habe, dass er finanziell abgesichert sei und es ihm nicht ums Geld gehe. Eine Relevanz für das Ergebnis des Gutachtens ist zudem nicht ersichtlich.
Nr. 22 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Dass der Sachverständige zur Auffassung gelangt ist, dass der Kläger keine alltagsrelevante kognitive Beeinträchtigung habe, stellt keinen Mangel des Gutachtens dar, sondern ist die aufgrund der Begutachtung gewonnene Erkenntnis des Sachverständigen angesichts einer Bewertung der verschiedenen Aktivitäten des Klägers. Angesichts der neuropsychologischen Untersuchungsergebnisse geht das Gericht zwar davon aus, dass beim Kläger wahrscheinlich kognitive Beeinträchtigungen vorliegen bzw. zumindest vorlagen, folgt jedoch dem Sachverständigen darin, dass mangels morphologischer Befunde neuropsychologische Körperschäden ebenso wie eine Kausalität derartiger Schäden mit dem Dienstunfall nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesen sind (s.o.).
Nr. 23 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Hierzu hat der Sachverständige in seiner Stellungnahme vom 14. März 2016 nachvollziehbar erklärt, dass es sich hierbei um Außenseitermethoden mit wissenschaftlich unhaltbaren Hypothesen handle. Selbst bei pathologischen Befunden erlaube die nur geringe Spezifizität des EEG keine Rückschlüsse auf Krankheitsentitäten.
Nr. 24 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Hierzu hat der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 13. Januar 2015 erklärt, dass er sich gut erinnern könne, dass der Kläger die Blutentnahme zur Wirkspiegelanalytik mit der im Gutachten angegebenen Begründung [Angst vor Nadeln] verweigert habe. Dass der Kläger die nunmehrige Begründung für seine Verweigerungshaltung bereits Dr. B. bei der Begutachtung mitgeteilt hätte, ist nicht glaubhaft. Ein Grund, weshalb Dr. B. diesen falsch angeben sollte, ist nicht ersichtlich. Andererseits ist der nunmehr vorgebrachte Grund auch nicht nachvollziehbar. Zum einen hat der Kläger selbst angegeben, am Tag der Begutachtung 800 mg Ibuprofen eingenommen zu haben (S. 20 des Gutachtens). Ein Schmerzmittel Parkermed hat er hingegen nicht als aktuelle Medikation angegeben, so dass er diesbzgl. möglicherweise unvollständige oder fehlerhafte Angaben gemacht hat. Zum anderen ist nicht ersichtlich, wie die Feststellung dieses Schmerzmittels im Blut des Klägers einen nicht weiter namentlich erwähnten Bekannten, der ihm dieses Mittel aus Österreich mitbringen soll, in Schwierigkeiten bringen sollte. Der Kläger wohnt selbst nahe der österreichischen Grenze, so dass er sich dieses Mittel jederzeit auch selbst besorgt haben könnte.
Nr. 26 im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014:
Dem Kläger wird im Gutachten nicht sein Pflichtbewusstsein vorgehalten, sondern allein die Tatsache gewertet, dass ihm trotz des Unfalls noch möglich war, eine Unterrichtsstunde zu halten. Dass er hierbei auch für den Schulleiter erkennbar unter dem Eindruck des eben erlebten Unfalls stand, ist nachvollziehbar, aber für die Wertung wenig relevant. Entscheidend ist, dass keine derart starken Beschwerden vorlagen, die die weitere Autofahrt und das Abhalten einer Unterrichtsstunde ausgeschlossen hätte. Dies wird auch durch den weitgehend beschwerdefreien Erstbefund von Dr. P. bestätigt.
Die übrigen Ausführungen im Schriftsatz vom 18. Dezember 2014 stellen lediglich weitere Ausführungen oder Erläuterungen dar. Mängel des Gutachtens begründen diese nicht.
Aus dem klägerischen Schriftsatz vom … Juni 2015 ergeben sich keine wesentlich neuen Aspekte. Es mag zutreffen, dass es in der Wissenschaft Stimmen gibt, die auch bei HWS-Distorsionen ohne Schädelverletzung traumatische Hirnläsionen für möglich halten und diese ggf. nicht immer bildtechnisch erfassbar sind. Ohne morphologisch nachweisbare Schädigung und angesichts der Tatsache, dass es für die kognitiven Funktionseinbußen auch andere Erklärungsansätze („jeder pathologische Vorgang“ bzw. sogar unabhängig von einer Hirnverletzung) gibt, ist der Nachweis, dass die Funktionseinbußen im Fall des Klägers neuropsychologischer Natur sind und auf den Dienstunfall zurückzuführen sind, nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erbracht. Die bloße Möglichkeit einer derartigen Schädigung, die sich im konkreten Einzelfall jedoch durch nichts nachweisen lässt, ist hierfür nicht ausreichend. Auf die Ausführungen zu den neuropsychologischen Körperschäden wird verwiesen (s.o. Nr. I.5).
Auch hat der Sachverständige entgegen der Ausführungen im Schriftsatz vom 23. Dezember 2015 nicht unterschlagen, dass in der Wissenschaft auch die Auffassung vertreten wird, dass bei allen Schweregraden nach der Quebec-Task-Force Dauerfolgen entstehen könnten, sondern dies in der mündlichen Verhandlung bestätigt. Er hat lediglich diese Auffassung aus seiner Sicht abgelehnt und jedenfalls den Nachweis einer mit an Sicherheit grenzenden Unfallfolge ausgeschlossen. Ein offenkundiger Mangel des Gutachtens ergibt sich hieraus nicht.
An der Sachkunde des Sachverständigen bestehen für die Kammer keine Zweifel. Dr. B. ist Arzt für Neurologie und Psychiatrie sowie für spezielle Schmerztherapie und verfügt daher über die Qualifikation, ein algesiologisches Gutachten zu erstellen. Zudem ist er Chefarzt der Klinik für Neurologie im Krankenhaus … in … und damit auch in der Praxis mit HWS-Schleudertraumen befasst. Die geringe Anzahl an im Literaturverzeichnis des Gutachtens angegebenen Arbeiten vermag die Sachkompetenz des Sachverständigen nicht in Frage zu stellen. Hier ist allein schon aus Praktikabilitätsgründen Zurückhaltung geboten. Auch dass der Sachverständige einmal in seinem Gutachten Wikipedia zitiert, vermag seine Sachkenntnis nicht in Frage zu stellen. Das Zitat bezieht sich lediglich auf die Geschwindigkeit von Autoscootern und fällt daher nicht in den eigenen Fachbereich des Klägers.
Auch dass der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung seine zunächst getroffene Diagnose einer Anpassungsstörung revidiert hat, stellt weder die Glaubwürdigkeit noch die Sachkompetenz des Sachverständigen infrage. Es spricht gerade für die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Sachverständigen, dass er den Mut aufbringt, einen Fehler einzugestehen und diesen zu korrigieren. Die Korrektur ist auch in der Sache nachvollziehbar. Die zeitlichen Einschränkungen bei der Diagnose einer Anpassungsstörung ergeben sich aus der Fachliteratur (vgl. z. B. Dilling/Freyberger, Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen, 5. Aufl. 2010), aber auch aus einschlägigen Leitlinien (AWMF-Register Nr. 051/010). In den Leitlinien für die sozialmedizinische Begutachtung wird ebenfalls ausgeführt, dass die Symptome einer Anpassungsstörung definitionsgemäß nicht länger als sechs Monate anhalten, mit Ausnahme der längeren depressiven Reaktion mit bis zu zwei Jahren Dauer. Selbst die prolongierte Anpassungsstörung ist daher auf zwei Jahre begrenzt.
An der Unparteilichkeit des Sachverständigen bestehen für die Kammer keine Zweifel. Auf den Beschluss des Gerichts vom 7. Juli 2016 wird insoweit verwiesen. Die Unparteilichkeit des Sachverständigen Dr. B. wird darüber hinaus auch nicht aus den im Schreiben des Prozessbevollmächtigten vom … Dezember 2014 ausgeführten Gründen in Frage gestellt. Dass der Sachverständige seinen Gutachtensauftrag überschritten hätte, ist nicht ersichtlich. Vom Gericht wurde ein algesiologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Algesiologie ist ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Erforschung von Schmerzentstehung und Schmerztherapie befasst. Schmerzen können physisch oder psychisch bedingt sein. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass sich der Sachverständige im Rahmen eines algesiologischen Gutachtens sowohl mit möglichen körperlichen als auch psychischen Ursachen von Schmerzen auseinandersetzt.
Zweifel an der neutralen Begutachtung (vgl. Nr. 2.3 im klägerischen Schriftsatz vom … Dezember 2014) entstehen auch nicht dadurch, dass der Sachverständige die intensive Beschäftigung des Klägers mit dem HWS-Schleudertrauma, die Tatsache, dass er als Mitherausgeber ein Buch zu diesem Thema miterarbeitet hat, die Freizeitaktivitäten (Urlaub z. B. in …) sowie das Etablieren einer funktionierenden Partnerschaft dahingehend gewertet hat, dass dies gegen eine Beschwerdesymptomatik in dem vom Kläger geschilderten Ausmaß spricht. Nach der Leitlinie für die ärztliche Begutachtung von Menschen mit chronischen Schmerzen (AWMF-Leitlinien-Register Nr. 030/102 Entwicklungsstufe 2k) ist nämlich im Rahmen einer Konsistenzprüfung der Frage nachzugehen, ob die geklagten Schmerzen und die damit verbundenen Funktionsbeeinträchtigungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestehen. Zweifel am Ausmaß der geklagten Beschwerden können u. a. aufkommen, wenn Diskrepanzen erkennbar sind zwischen schwerer subjektiver Beeinträchtigung und einem weitgehend intakten psychosozialen Funktionsniveau bei der Alltagsbewältigung. Im Rahmen der erforderlichen Anamnese bei der Begutachtung von Schmerzen sind gerade die hier in Rede stehenden Bereiche Familienleben, soziale Kontakte, Freizeitbereich wie Sport, Hobbys, Urlaubsreisen zu erfassen (Nr. 4 der o.g. Leitlinie). Dass der Sachverständige hieraus Rückschlüsse auf die Konsistenz der geklagten Beschwerden zieht, ist folglich nicht zu beanstanden.
Auch dass der Sachverständige eine Blutuntersuchung zur Wirkstoffanalyse durchführen wollte, ist nicht zu beanstanden. Nach der o.g. Leitlinie können Zweifel am Ausmaß der geklagten Beschwerden auch aufkommen, wenn Diskrepanzen erkennbar sind zwischen am Untersuchungstag als eingenommen angegebenen Medikamenten und dem Nachweis der Medikamente im Blutserum. Die Wirkspiegelanalyse ist daher ein zulässiges Instrument zur Plausibilisierung geklagter Beschwerden. Das Ansinnen des Sachverständigen wird auch nicht dadurch infrage gestellt, dass der Klägerbevollmächtigte mit Schriftsatz vom 14. Januar 2016 unter Bezugnahme auf eine Auskunft des Labors Dr. L. & K. gen, … – die allerdings nicht vorgelegt wurde – ausführt, dass die Halbwertszeit zwei bis vier Stunden betrage. Wenn der Patient im unteren Referenzbereich (15-30 mg/l) läge, wäre bei schnellerer Metabolisierung nach acht Stunden kein Spiegel mehr nachweisbar. Der Schluss des Klägerbevollmächtigten, dass sich hieraus ergebe, dass ein Ibuprofenspiegel nicht mehr nachweisbar gewesen wäre, ist nicht nachvollziehbar. Zunächst ist festzuhalten, dass in der AWMF-Leitlinie Ibuprofen als Beispiel eines bestimmbaren Medikamentenspiegels ausgewiesen ist (Tab. 6). Es ist weder ersichtlich, dass der Kläger angesichts einer Einnahme von 800 mg Ibuprofen bei ca. sechs Litern Blut im unteren Referenzbereich liegen sollte noch dass er zu den 5-10% der Bevölkerung gehört, die als „ultrarapid metabolizer“ bezeichnet werden, bei denen die Metabolisierung also schneller als üblich abläuft. Im Übrigen würde sich dann, wenn der Wirkstoffspiegel nicht mehr nachweisbar wäre auch die Frage stellen, ob der Kläger bei tatsächlich starker Schmerzbeeinträchtigung nicht weiteres Ibuprofen zu sich nehmen müsste, um gerade den Wirkstoffspiegel zu halten und dadurch die Schmerzen zu bekämpfen. Unabhängig davon ist die Wertung der Verweigerung einer Wirkstoffanalyse als weiteres Anzeichen dafür, dass Schmerzen im geklagten Ausmaß i. S. einer somatoformen Schmerzstörung nicht bestehen, nicht zu beanstanden, zumal sich die Verweigerung weder angesichts regelmäßiger Nervenverödung durch die Angst vor Nadeln noch durch Sorge um einen Bekannten, der dem Kläger in Deutschland nicht zugelassene Medikamente verschaffen soll (s.o.), nachvollziehbar erklären lässt.
c) Die Ausführungen des Sachverständigen werden auch nicht durch andere Gutachten bzw. Befunde durchgreifend in Frage gestellt.
Prof. Dr. N. führt in seinem Gutachten für das Landgericht … vom 4. September 2007 aus, dass diagnostisch von einer Anpassungsstörung ausgegangen werde. Hierbei handle es sich um Zustände von subjektivem L. und emotionaler Beeinträchtigung, die soziale Funktionen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensphase aufträten. Im Fall des Klägers sei der Unfall als Ursache für die mit einer Einschränkung der Lebensqualität verbundenen Folgen für den Kläger selbst, die gegen seinen Willen erfolgte Pensionierung sowie die Scheidung von seiner Ehefrau als entscheidende Lebensveränderung angesehen worden, in deren Verlauf es zur Erkrankung gekommen sei. Durch die Symptomatik würden die Möglichkeiten, seine Funktion im gesellschaftlichen Leben wahrzunehmen, und die Leistungsfähigkeit schwerwiegend beeinträchtigt. Von einer posttraumatischen Belastungsstörung sei diagnostisch nicht auszugehen. Es sei zu berücksichtigen, dass nicht genau herausgearbeitet habe werden können, wann die im Bericht von Dr. … J. 2003 erwähnten psychischen Symptome und die 2005 anhand einer neuropsychologischen Untersuchung objektivierten kognitiven Defizite erstmals aufgetreten seien. Da der Kläger im Jahr 2000, bereits drei Jahre nach dem Unfall, verbeamtet worden sei, sei in Betracht zu ziehen, dass die aktuell bestehende psychische Symptomatik keine direkte Folge des Unfalls sein könnte, sondern vielmehr auf die in den letzten Jahren hinzu getretenen psychosozialen Belastungsfaktoren zurückzuführen sei.
Aus den Ausführungen des Gutachters ergibt sich nicht, dass der Kläger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund des Unfallereignisses eine Anpassungsstörung erlitten hätte. Der Unfall lag zum Zeitpunkt der Begutachtung bereits 9 ½ Jahre zurück. Eine mit dem Dienstunfall begründete Anpassungsstörung ist, selbst wenn man davon ausgeht, dass eine Anpassungsstörung im Ausnahmefall über sechs Monate hinaus bis zu zwei Jahre andauern kann (s. o.), nicht mehr nachvollziehbar. Dementsprechend hat der Gutachter selbst darauf hingewiesen, dass die Anpassungsstörung auf weiteren psychosozialen Belastungsfaktoren beruhen könnte. Hier käme etwa die 2006 erfolgte Scheidung des Klägers in Betracht. Diese Belastungsfaktoren sind jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückzuführen. Auch wenn die Ehefrau des Klägers sich zum Scheitern der Ehe in dieser Richtung äußert, ist die Trennung eines Paares ein multifaktorielles Geschehen, das nicht dem Dienstherrn zuzurechnen ist.
Dipl.-Psych. M. führt in ihrem neuropsychologischen Gutachten aus, dass von einer leichten depressiven Störung auszugehen sei, die sich reaktiv auf die primären und sekundären Unfallfolgen Dauerschmerzen, Verlust des Arbeitsplatzes und Hobbys, Scheitern der Ehe, Trennung von den Kindern entwickelt habe. Auch Dr. D., Nervenarzt, führt in seinem Schreiben vom 25. Januar 2006 aus, dass der Kläger depressiv geworden sei durch die anhaltenden massiven Beschwerden. Die Depressivität sei unmittelbare Unfallfolge.
Zunächst ist hierzu festzuhalten, dass es sich bei Dipl.-Psych. M. nicht um eine Fachärztin handelt, der das Vorliegen einer Depression feststellen könnte. Dr. D. hat wiederum nicht nachvollziehbar erläutert, wie er zu der Diagnose einer Depression kommt. Abgesehen davon sind weder die Ausführungen von Dipl.-Psych. M. noch von Dr. D. zur Kausalität bei einem multifaktoriellen Geschehen wie einer Depression geeignet, diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festzustellen. Zudem konnten weder Prof. Dr. N. noch der Sachverständige Dr. B. noch Prof. Dr. W./Z. ein depressives Syndrom beim Kläger erkennen.
Dipl.-Psych. M. führt in ihrem neuropsychologischen Gutachten vom 11. Juli 2012 aus, dass ihres Erachtens eine chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (F45.41) vorliege.
Bei Dipl.-Psych. M. handelt es sich allerdings nicht um eine Fachärztin. Dr. B. konnte das Vorliegen einer chronischen Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen („fraglich“).
Prof. Dr. W./Z. stellen in ihrem Gutachten vom 4. März 2009 informatorisch fest, dass der Kläger an einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung leide. Dies ergebe sich im Wesentlichen aus dem Umstand, dass der Kläger glaubhaft an schweren chronischen Schmerzzuständen leide, für die sich kein ausreichendes organisches Korrelat nachweisen lasse. Hierbei handle es sich nicht um Aggravation oder Simulation, sondern um eine genuine psychische Erkrankung, da der Kläger offensichtlich seinen gesamten Lebensstil seinem Schmerzerleben unterordne.
Im Rahmen der von Dr. B. durchgeführten algesiologischen Begutachtung ergaben sich im Gegensatz zum Gutachten der Prof. Dr. W./Z. eine Diskrepanzen zwischen der Beschwerdeschilderung und dem Funktionsniveau bei der Alltagsbewältigung als auch Fragen bzgl. der Medikation. Eine Wirkspiegelanalyse wurde von den o.g. Gutachtern nicht vorgenommen oder versucht. Die als obiter dictum im Gutachten von Prof. Dr. W./Z. angeführte Diagnose kann die ausführliche Begutachtung des Klägers unter Schmerzgesichtspunkten durch Dr. B. nicht infrage stellen.
Prof. Dr. L. Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, kommt in seinem Befund und Gutachten über die Unfallfolgen vom 27. Juni 2010 u. a. zu dem Ergebnis, dass beim Kläger eine unfallkausale somatoforme Schmerzstörung vorliege. Es bestehe ein „Late-Whiplash-Syndrom“, zu dem auch der Befund der SPECT-Hirn-Perfusionsszintigraphie vom 12. August 2004 passe. Aus wissenschaftlichen Arbeiten gehe hervor, dass auch ohne Hirnverletzung somatoforme Schmerzsyndrome mit kognitiven Ausfällen beim Late-Whiplash-Syndrom möglich seien infolge ständiger Stimulierung aufsteigender Schmerzbahnen mit reflektorischer Beeinflussung der Hirndurchblutung. N. betone, dass neuropathische Schmerzsyndrome bzw. CRPS durch Verletzungen und chronische Reizzustände der nervalen Versorgung von Facettengelenken usw. nach Halsschleudertraumen möglich seien.
Es fehlt in dem Gutachten bereits die Erstellung einer exakten Diagnose. Der Begriff einer somatoformen Schmerzstörung findet sich in der ICD-10 nicht. Eine somatoforme Störung ist nach der ICD-10 (F-45) ein Oberbegriff für eine Vielzahl von Störungen (F45.0-F45.9). Eine anhaltende Schmerzstörung wird wiederum in eine „Anhaltende somatoforme Schmerzstörung“ (F 45.40) und eine „Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren“ (F 45.41) unterteilt. An welcher dieser somatoformen Störungen der Kläger genau leiden soll, bleibt unklar. Darüber hinaus sind die Ausführungen von Prof. Dr. L. auch nicht geeignet, die Kausalität einer derartigen Störung mit dem Dienstunfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu belegen. Die bloße Möglichkeit einer derartigen Folge aus wissenschaftlicher Sicht ist hierfür nicht ausreichend. Zur Aussagekraft der Befunde der SPECT-Hirn-Perfusionsszintigraphie hat sich bereits Prof. Dr. Dr. L.W. nachvollziehbar geäußert und diese verneint (s.o. Nr. I.4). Zur Kausalität der „somatoformen Schmerzstörung“ werden darüber hinaus außer dem Klammerzusatz „unfallkausal“ keine weiteren Ausführungen gemacht. Sollten sich die Ausführungen auf S. 13 des Gutachtens auch hierauf beziehen, sind auch diese für einen Nachweis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ausreichend. Prof. Dr. L. führt dabei aus, dass bei Durchsicht der Unterlagen eindeutig hervorgehe, dass der Kläger vor dem Unfall keine wesentlichen Gesundheitsprobleme gehabt habe und als engagierter, einsatzfreudiger Lehrer aufgetreten sei. Seit dem Unfall sei er wie ausgewechselt und benötige permanente Behandlungen. Die Brückensymptome seien zwischen Unfalltag bis heute lückenlos belegt. Es komme einem ärztlichen Kunstfehler gleich zu behaupten, die Arbeitsunfähigkeit stünde nicht im Zusammenhang mit dem Dienstunfall, weil der Kläger praktisch pausenlos in Behandlung gestanden habe und eine Flut von Befundmaterial vorliege, das als beweisend eingestuft werden müsse. Der bloße zeitliche Zusammenhang zwischen dem Auftreten der vom Gutachter angenommenen gesundheitlichen Beschwerden und dem Dienstunfall genügt jedoch gerade nicht, um einen ursächlichen Zusammenhang im Rechtssinne zu begründen (s.o.).
Dr. K., Facharzt für Orthopädie, spezielle Schmerztherapie (Fachklinik …), befundet in seinem Schreiben vom 21. September 2012 ein chronisches Schmerzsyndrom Stadium III nach Gerbershagen bei chronisch hohem Cervikalsyndrom i. S.e. vegetativen Dysregulation bei Z.n. HWS-Distorsion I°. beim Kläger liege zwar ein aus orthopädischer Sicht ausgeheiltes Distorsionstrauma der HWS vor, dieses sei jedoch aus neurologisch-schmerzspezifischer Sicht nach wie vor nicht ausgeheilt. Es bestehe eine ausgeprägte vegetative Dysfunktion bzw. Fehlfunktion auf zentraler Ebene.
Die Kausalität des diagnostizierten chronischen Schmerzsyndroms mit dem Dienstunfall wird in dem Schreiben zwar behauptet, tragfähige Aussagen, die eine Kausalität mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisen könnten, werden in dem Schreiben jedoch nicht gemacht. Im Übrigen haben sich bei der Begutachtung durch Dr. B. greifbare Anhaltspunkte für eine Diskrepanz zwischen der Schilderung des Ausmaßes der Schmerzsymptomatik und den möglicherweise tatsächlich bestehenden Schmerzen ergeben.
Dr. L.W., Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin (Klinikum … diagnostiziert in seinem Gutachten vom 21. März 2016 für das Landgericht … eine chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychologischen Faktoren bei Zustand nach HWS-Beschleunigungstrauma Grad II nach Quebec Task Force und Grad I nach Erdmann. Aufgrund der körperlichen Untersuchung seien anhaltende Schmerzen und funktionelle Begleitsymptome im Kopf- und HWS-Bereich plausibel. Als psychologische Faktoren negativ beeinflussend würden eine Angstsymptomatik mit Alpträumen, Angst-Vermeidungsverhalten bzgl. des Unfallorts, Existenzängste gesehen. Auch von der Primärpersönlichkeit eines besonders pflichtbewussten Menschen könne bereits eine erhöhte Grundspannung angenommen werden. Die Kompensationsmechanismen schienen beim Kläger 2002 aufgebraucht zu sein und zu dem Zusammenbruch geführt zu haben. Im Psychiatrischen Zusatzgutachten sei die Diagnose einer Anpassungsstörung vergeben worden, d. h. ein pathologisches Verhalten bzw. eine anhaltende psychologische Belastung durch den Unfall über das normale Maß hinaus sei vorhanden. Er stehe immer noch unter Stress bzw. einer andauernden körperlichen und psychosozialen Überforderung. Wie im Gutachten von Prof. K. würden die Beschwerden als unfallbedingt eingeordnet. Da ein Beschwerdebeginn kurz nach dem Unfall dokumentiert sei, zuvor Beschwerdefreiheit bestanden habe und die Beschwerden kontinuierlich fortbestünden, seien diese als Folge des Unfalls zu werten, auch wenn bei einer HWS-Distorsion Grad II nach Quebec Task Force eine unfallbedingte Strukturverletzung nicht nachgewiesen werden könne. Dass von radiologischer, neurologischer und HNO-fachärztlicher Seite in MRT-Befunden teilweise beschriebene Strukturschäden nicht sicher als Unfallfolge und damit auch nicht als Erklärung für die vom Kläger beschriebenen funktionellen Beschwerden angesehen werden könnten, sei nicht als Beweis anzusehen, dass die Beschwerden nicht auf den Unfall zurückzuführen seien. Leidel 2008 beschreibe die Herausforderung der Begutachtung für die wenigen chronifizierenden HWS-Distorsion-assoziierten Beschwerden nach leichter Verletzung nach Quebec Task Force I-II ohne eindeutige strukturell-morphologisch nachweisbare unfallbedingte Veränderungen. Als Risikofaktoren für eine Chronifizierung habe von Scholten-Peeters 2003 als einzig hoch signifikanter Faktor eine hohe initiale Schmerzintensität genannt werden können. Von Leidel 2008 zusammengefasst seien streng korrelierende prognostische Faktoren für andauernde Einschränkungen im täglichen Leben eine hohe initiale Schmerzintensität, niedriger Bildungsstand, Überempfindlichkeit gegenüber Kältereizen und Bewegungseinschränkungen der HWS. Der erste und letzte Punkt erscheine beim Kläger gegeben. Kritisch sei Leidel 2008 gegenüber der gängigen Praxis bei der Begutachtung von HWS-Distorsionen, einen Primärschaden als Beleg für die Unfallursache und Beschwerdeauslösung zu fordern. Es bestehe die Notwendigkeit, Einblick in und Verständnis für nicht restlos aufgeklärte Sachverhalte zu gewinnen. Dies stelle bisher noch keinen Standard dar. Die Empfehlungen der DGU und DGOOC erschienen insgesamt nicht schlüssig. Bei der Darstellung struktureller Schäden gebe es Grenzen. Funktionelle Störungen der HWS als Unfallfolge könnten auch ohne – wie beim Kläger – strukturell nachweisbaren Primärschaden auftreten. Diese seien mit der „semiobjektiven“ segmentalen manuellen Funktionsdiagnostik darstellbar. Auch wenn dauerhafte HWS-Störungen nicht die Regel darstellten, sondern selten aufträten, sei in jedem Einzelfall der individuelle Ursachenzusammenhang zwischen erster Verletzungsfolge und chronischem Beschwerdebild kritisch zu prüfen. Zur Sicherung der unfallbedingten Verletzungsfolge gelte das Kausalitätsprinzip: Adäquates Trauma/Primärschaden, typische Beschwerden, Beschwerdefreiheit vor dem Unfallereignis.
Die Ausführungen von Dr. L.W. sind nicht geeignet, eine chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen (nicht psychologischen) Faktoren als Folge des Dienstunfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachzuweisen. Zum einen ist bereits die Methodik des Gutachters nicht schlüssig. Der wissenschaftlichen Begründung ist zu entnehmen, dass sich Dr. L.W. bei seiner Begutachtung offenbar nicht an die als gängig bezeichnete Praxis der Begutachtung von HWS-Distorsionen hält, einen Primärschaden als Beleg für die Unfallursache und Beschwerdeauslösung zu fordern. Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie sowie der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie werden als nicht schlüssig abgelehnt. Vielmehr bestehe die Notwendigkeit, Einblick in und Verständnis für nicht restlos aufgeklärte Sachverhalte zu gewinnen. Störungen sollen daher mit einer – so wörtlich – semiobjektiven segmentalen manuellen Funktionsdiagnostik dargestellt werden. Eine derartige Diagnostik, die sich von der gängigen Praxis und den Empfehlungen der Fachgesellschaften entfernt hat, kann erhebliche Zweifel am Gutachten von Dr. B. nicht begründen. Zudem ist auch nicht nachvollziehbar, dass beim Kläger eine hohe initiale Schmerzintensität oder Bewegungseinschränkungen der HWS festzustellen gewesen wären, die Dr. L.W. als signifikante Faktoren für eine Chronifizierung benennt. Bewegungseinschränkungen der HWS wurden direkt nach dem Unfall weder von Dr. P. („frei beweglich“, „keine Blockaden“) noch durch Dr. S. („Beweglichkeit der HWS ist frei“) fünf Tage nach dem Unfall festgestellt. Zu der von Dr. K. festgestellten eingeschränkten Links-Rechts-Rotation hat der Gutachter Dr. L. erklärt, dass diese unter Berücksichtigung des Alters des Klägers als normal einzustufen sei. Auch initiale starke Schmerzen sind nicht belegt. Dr. P. befundet am Unfalltag, dass derzeit keine Beschwerden nachweisbar seien. Auch Dr. S. spricht lediglich von einer Verspannung der Trapeziusmuskulatur und dass der Kläger über Belastungsbeschwerden klage. Eine hohe initiale Schmerzintensität ist daraus für das Gericht nicht erkennbar. Abgesehen davon werden aber auch keine tragfähigen Aussagen zur Kausalität gemacht. Der bloße zeitliche Zusammenhang zwischen dem Auftreten der vom Gutachter angenommenen Beschwerden, die in der Folge zur Annahme einer chronischen Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren führen sollen, und dem Dienstunfall genügt nicht, um einen ursächlichen Zusammenhang im Rechtssinne zu begründen. Auch dass der Kläger vor dem Unfall beschwerdefrei gewesen sein soll, genügt für den Nachweis eines Kausalzusammenhangs mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Es gibt im beamtenrechtlichen Dienstunfallrecht ebenso wie im Bereich des Arbeitsunfalls (vgl. BSG, U. v. 9.5.2006 – B 2 U 26/04R – juris) keine Beweisregel, dass bei fehlender Alternativursache die dienstunfallbedingte naturwissenschaftliche Ursache auch eine wesentliche Ursache ist, weil dies bei komplexem Krankheitsgeschehen zu einer Beweislastumkehr führen würde. Die anspruchsbegründende Voraussetzung des Ursachenzusammenhangs ist vielmehr positiv festzustellen. Angesichts fehlender unfallassoziierter struktureller morphologischer Befunde wird ein derartiger Zusammenhang aufgrund der grundsätzlichen Geeignetheit des Unfallmechanismus, der typischen Beschwerden und der zeitlichen Korrelation vorliegend letztlich nur vermutet. Ein positiver Nachweis der Kausalität, geschweige denn einer Kausalität mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wird gerade nicht erbracht, zumal es sich nach eigenen Angaben von Dr. L.W. bei chronifizierten Beschwerden nach einer beim Kläger vorliegenden leichten HWS-Distorsion gerade nicht um den Regelfall, sondern um seltene Ausnahmefälle handelt.
Im Ergebnis sind weitere Körperschäden, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall des Klägers zurückzuführen sind, nicht gegeben.
II.
Der Kläger hat gegen den Beklagten keinen Anspruch auf Unfallausgleich als Folge des bei dem Dienstunfall vom 16. Oktober 1997 erlittenen Körperschadens.
Gem. Art. 52 Abs. 1 Satz 1 BayBeamtVG erhält ein Beamter, der infolge eines Dienstunfalls in der Erwerbsfähigkeit länger als sechs Monate um mindestens 25 von Hundert beschränkt ist, neben der Besoldung einen Unfallausgleich in Höhe der Grundrente nach § 31 Abs. 1 bis 4 BVG, solange dieser Zustand andauert. Eine unfallunabhängige Minderung der Erwerbsfähigkeit bleibt außer Betracht, Art. 52 Abs. 2 Satz 2 BayBeamtVG. Die Vorschriften stimmen inhaltlich mit den bis 31. Dezember 2010 geltenden Normen des § 35 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG überein. Gem. § 35 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG in der seit dem Dienstunfall unverändert gültigen Fassung erhält ein verletzter Beamter, der infolge des Dienstunfalles in seiner Erwerbsfähigkeit länger als sechs Monate wesentlich beschränkt ist, neben den Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder dem Ruhegehalt Unfallausgleich, solange dieser Zustand andauert. Wesentlich ist eine Minderung der Erwerbsfähigkeit, wenn sie wenigstens 25 v. H. beträgt. Dies folgt aus der Verweisung in § 35 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG auf § 31 Bundesversorgungsgesetz (Weinbrenner in Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, Beamtenversorgungsrecht, § 35 Rn. 36).
Die Minderung der Erwerbsfähigkeit (im Folgenden: MdE) ist nach der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben zu beurteilen. Dabei handelt es sich um einen Rechtsbegriff, der der vollen verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. Erwerbsfähigkeit ist die Kompetenz des Verletzten, sich unter Nutzung der Arbeitsgelegenheiten, die sich ihm abstrakt im gesamten Bereich des Erwerbslebens bieten, einen Erwerb zu verschaffen. Auf den bisherigen Beruf oder die bisherige Tätigkeit wird nicht abgestellt. Es kommt nicht auf die individuellen Verhältnisse, also die persönlichen Kenntnisse oder die geistigen, körperlichen, psychischen und sozialen Fähigkeiten an. Die Festsetzung der MdE im Versorgungsrecht folgt den unfallversicherungsrechtlichen Anforderungen. Sie richtet sich auch dort nach den verminderten Arbeitsmöglichkeiten auf dem Gesamtgebiet des Erwerbslebens, die sich aus der Beeinträchtigung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens ergeben (vgl. § 56 Abs. 2 Satz 1 SGB VII). Voraussetzung ist ein Vergleich der vor und nach dem Dienstunfall bestehenden individuellen Erwerbsfähigkeit.
Für das Vorliegen eines Dienstunfalls ist grundsätzlich der volle Beweis zu erbringen. Dieser ist nur dann erfüllt, wenn der Nachweis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erbracht ist (BVerwG vom 7. 2. 1989, Az. 2 B 179/88, juris; v. 24. 3. 2006, Az. 3 ZB 05.431, juris). Dies gilt sowohl für das Vorliegen eines behaupteten Körperschadens als auch für den Kausalzusammenhang mit dem Dienstunfallgeschehen. Bleibt nach Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten im Rahmen der Amtsermittlungspflicht offen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, was auch für die Frage der Kausalität gilt, trifft die materielle Beweislast den Kläger, da im Dienstunfallrecht die allgemeinen Beweisgrundsätze gelten. Im Bereich des Unfallausgleichs gelten ebenfalls die allgemeinen Beweisgrundsätze (vgl. VG Augsburg, U. v. 21.2.2013, Au 2 K 11.1459). Derjenige, der aus einer Norm eine ihm günstige Rechtsfolge ableitet, trägt die materielle Beweislast, wenn das Gericht in Erfüllung seiner Pflicht zur umfassenden Aufklärung des Sachverhalts (§ 86 Abs. 1 VwGO) das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen zu seiner vollen Überzeugungsgewissheit („mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“) weder feststellen noch ausschließen kann – „non liquet“ und wenn sich aus der materiellen Anspruchsnorm nichts Abweichendes ergibt (BVerwG, U. v. 28. 4. 2011 – 2 C 55.09 – ZBR 2012, 38).
Der Grad der MdE ist aufgrund eines ärztlichen Gutachtens zu ermitteln. Dabei bilden allgemeine Erfahrungssätze, in Tabellen und Empfehlungen enthaltene Richtwerte, also antizipierte Sachverständigengutachten, in der Regel die Basis für die Bewertung der MdE durch den Sachverständigen. Die konkrete Bewertung muss jedoch stets auf die Besonderheiten der MdE des betroffenen Beamten abstellen. Entscheidend ist, dass der Sachverständige bei seiner dienstunfallrechtlichen Bewertung als Maßstab die körperliche Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben zugrunde legt (OVG NRW, B. v. 25. 8. 2011 – 3 A 3339/08, juris; BayVGH, B. v. 1. 2. 2013 – 3 ZB 11.1166, juris; Bauer in: Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, BeamtVG, § 35, Erl. 7.1).
In Anwendung dieser Maßstäbe ist das Gericht auf der Grundlage der vorliegenden Gutachten zu der Überzeugung gelangt, dass beim Kläger für den hier maßgeblichen Zeitraum ab dem 16. Oktober 1997 eine dienstunfallbedingte MdE von allenfalls 20 v. H. für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten vorlag. Dies ergibt sich aus dem amtsärztlichen Schlussgutachten vom 11. Januar 1999 von Dr. B., Arzt für Chirurgie, ebenso wie aus den Gutachten von Prof. Dr. Dr. L.W., Prof. Dr. M. und dem Gutachten von Dr. B. sowie dessen Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung.
Auszugehen ist dabei von der als dienstunfallbedingtem Körperschaden anerkannten HWS-Distorsion Grad I. Weitere Körperschäden müssen außer Betracht bleiben, da diese – so sie vorliegen sollten – nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückzuführen sind (s. o. Nr. I).
Aus dem amtsärztlichen Schlussgutachten vom 11. Januar 1999 ergibt sich eine dienstunfallbedingte MdE von 20 v. H. ab 16. Oktober 1997, von 10 v. H. ab 17. Januar 1998 und 0 v. H. ab 13. Februar 1999 (Bl. 66 ff. der BA). Zwar ergeben sich aus der ursprünglichen Fassung (Bl. 55 ff. der BA) andere Werte, nämlich 20 v. H. ab 16. Oktober 1997, 100 v. H. ab 1. Januar 1998, 20 v. H. ab 29. Juli 1998 und 0 v. H. ab 13. Februar 1999. Diese Werte sind jedoch insofern unschlüssig, da der Anstieg der MdE von 20 v. H. auf 100 v. H. und deren Rückgang auf 20 v. H. nach wenigen Monaten unter Berücksichtigung des Krankheitsverlaufs in keiner Weise schlüssig erklärbar ist. Daher wurde in der endgültigen Fassung eine Korrektur dieser offensichtlich fehlerhaften Angaben vorgenommen. Dr. B. hat in seinem Gutachten eine dienstunfallassoziierte MdE von 20 v. H. für sechs Monate angenommen. Ebenso konnten Prof. Dr. Dr. L.W. in seinem Gutachten vom 8. März 2010 auf neurologischem Fachgebiet und Prof. Dr. M. auf HNO-fachärztlichem Gebiet keine MdE feststellen. Selbst Prof. Dr. W. hat in seinem Gutachten vom 16. Dezember 2007 trotz der nicht schlüssigen Annahme einer HWS-Distorsion Grad III nach Quebec Task Force aus rein neurochirurgischer Sicht keine unfallbedingte MdE feststellen können.
Sämtliche o.g. Gutachter sind sich darin einig, dass beim Kläger zu keinem Zeitpunkt eine dienstunfallbedingte MdE von mindestens 25 v. H. vorlag. Dies ist schlüssig und nachvollziehbar und entspricht bei einer HWS-Distorsion Grad I nach Erdmann bzw. Grad II nach Quebec Task Force auch den in Tabellen und Empfehlungen enthaltenen Richtwerten (vgl. z. B. Rompe/Erlenkämper, Begutachtung der Haltungs- und Bewegungsorgane, 5. Aufl. 2009; Schönberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 8. Aufl. 2010; Widder/Gaidzik, Begutachtung in der Neurologie, 2. Aufl. 2011).
Zwar mag es – wie der Kläger ausführlich vorträgt – Ausnahmeverläufe mit chronifizierten Beschwerden geben, möglicherweise auch bei leichten HWS-Distorsionen, auch wenn dies in der Wissenschaft umstritten zu sein scheint. Die bloße Möglichkeit derart abweichender Heilungsverläufe ersetzt jedoch nicht den Nachweis eines derartigen Verlaufs im zu beurteilenden Fall. Trotz zahlreicher Gutachten und einer umfangreichen Aktenlage konnte nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werde, dass im vorliegenden Fall ein derartiger Ausnahmeverlauf vorliegt und somit die vom Kläger geklagten Beschwerden auf den Dienstunfall und die hierbei erlittene HWS-Distorsion Grad I zurückzuführen wären. Dr. B. hat vielmehr in seinem Gutachten unter Berücksichtigung des vorliegenden Einzelfalls ausgeführt, dass keine Hinweise dafür sprechen würden, dass sich der Kläger nicht spätestens nach einem halben Jahr von den Folgen des Unfalls erholt hätte. Dies wird bestätigt durch das Gutachten des O. vom 2. April 2012, in dem ausgeführt wird, dass sich auf orthopädischem Fachgebiet keine sicheren Hinweise dafür finden ließen, dass im Fall des Klägers nicht von einem regelrechten Heilungsverlauf auszugehen sei. Aufgrund radiologischer Befunde lässt sich eine unfallbedingte Schädigung der Halswirbelsäule und damit ein möglicher atypischer Verlauf nicht belegen (vgl. Gutachten von Prof. Dr. B. und Prof. Dr. P.). Eine unfallbedingte Beeinträchtigung des Hör- und Gleichgewichtsorgans hat ausweislich des HNO-fachärztlichen Gutachtens von Prof. Dr. M. ebenfalls nicht stattgefunden. Auf neurologischem Gebiet sind nach den Gutachten von Prof. Dr. B. und Prof. Dr. Dr. L.W. keinerlei strukturelle Hirnschäden nachweisbar. Auf algesiologischem bzw. psychiatrischem Fachgebiet lassen sich nach dem Gutachten von Dr. B. ebenfalls keine Folgen des Dienstunfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit belegen.
Zwar haben die Prof. Dr. W. und Z. in ihrem Gutachten neuropsychologische Folgen des Dienstunfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bejaht sowie die dienstunfallbedingte MdE auf neuropsychologischem Fachgebiet mit 30 v. H. bewertet. Diesen Ausführungen kann jedoch nicht gefolgt werden, da neuropsychologische, d. h. durch Erkrankungen oder Verletzungen des zentralen Nervensystems hervorgerufene, Funktionseinbußen sowie deren kausaler Zusammenhang mit dem Dienstunfall und der hierbei erlittenen HWS-Distorsion angesichts einer nicht erwiesenen strukturellen, unfallbedingten Hirnschädigung nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wurden. Zwar mag es sein, dass derartige Funktionseinbußen auch ohne erkennbare morphologische Schädigung bestehen können. Ein positiver Nachweis mit dem erforderlichen Grad an Wahrscheinlichkeit, dass dies beim Kläger der Fall ist, ist nicht erbracht worden. Auf die obigen Ausführungen in Nr. I.5 wird insofern verwiesen.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Gutachten von Prof. Dr. L. Prof. Dr. L. kommt in seinem Gutachten vom 27. Juni 2010 zwar zu der Einschätzung, dass die Tatsache, dass der Kläger gegen seinen Willen pensioniert wurde, was ein pathologisches Leistungsdefizit von mind. 50 v. H. voraussetze, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dafür spreche, dass die tatsächliche unfallkausale Beeinträchtigung mindestens bei 50 v. H. liege. Dabei seien im Gutachten Prof. Dr. W./Z. der schwerwiegende Wirbelsäulenbefund nicht bewertet worden. Die sich daraus ergebenden Einschränkungen infolge der posttraumatischen Veränderungen an der Wirbelsäule und dem muskulären Streckapparat seien mangels Überschneidungen mit dem Vorgutachten W./Z. zu addieren und betrügen ebenfalls 30 v. H.
Die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit lässt entgegen der Ausführungen von Prof. Dr. L.allerdings keine Rückschlüsse darauf zu, dass die Leistungsminderung, die zur Ruhestandsversetzung geführt hat, infolge des Dienstunfalls eingetreten ist. Denn die Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit setzt anders als die Gewährung des Unfallausgleichs keine Kausalität der gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit dem Dienstunfall voraus (Weinbrenner in Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, Beamtenversorgungsrecht, § 35 Rn. 25). Darüber hinaus genügen der bloße zeitliche Zusammenhang zwischen dem Auftreten der gesundheitlichen Probleme und dem Dienstunfall ebenso wie die in der Folge durchgeführten zahlreichen Behandlungen oder die Beschwerdefreiheit vor dem Unfall nicht, um einen ursächlichen Zusammenhang der geklagten Beschwerden mit dem Dienstunfall und der dabei erlittenen HWS-Distorsion Grad I im Rechtssinne mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu begründen (s.o.). Posttraumatische Veränderung der Wirbelsäule konnten gerade nicht mit dem erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad nachgewiesen werden.
Prof. Dr. W. hat in seinem Gutachten zwar die unfallbedingte MdE unter Einbeziehung der Befunde und Beschreibung von Dipl.-Psych. M. mit mindestens 50 v. H. angegeben. In seinem neurochirurgischen Fachgebiet hat er jedoch keine MdE feststellen können. Die Befunde von Dipl.-Psych. M. sind wiederum nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall zurückzuführen, so dass der Verweis von Prof. Dr. W. hierauf nicht zu einer höheren dienstunfallbedingten MdE zu führen vermag.
Auch Prof. Dr. K. und Dr. L.W. sehen in ihren Gutachten die geklagten Beschwerden des Klägers zwar als unfallkausal an. Die Gutachten sind allerdings nicht schlüssig und können einen Kausalzusammenhang der Beschwerden des Klägers mit dem Dienstunfall und der hierbei erlittenen HWS-Distorsion Grad I i. S.e. atypischen Verlaufs nicht ansatzweise, zumal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, begründen (s.o. Nr. I.2 und I.6).
Dr. B. schätzt die MdE des Klägers in seinem Schreiben vom 22. Juni 2002 zwar aufgrund einer hirnorganischen Wesensveränderung mit Antriebsstörungen, Emotions- und Stimmungsstörungen sowie psychoreaktiven Störungen auf 80 v. H. ein. Dr. B. ist jedoch kein Facharzt, der derartige psychische Störungen feststellen könnte. Neuropsychologische oder psychiatrische Störungen sind gerade nicht auf den Dienstunfall mit der notwendigen mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit festzustellen (s.o.).
In den Gesundheitszeugnissen der medizinischen Untersuchungsstelle (MUS) der Regierung von Oberbayern vom 12. September 2003 (Dr. … J.) und vom 21. September 2004 (Dr. … O.) wiederum werden lediglich die geklagten Beschwerden des Klägers wiedergegeben, ohne zur Kausalität mit dem Dienstunfall und der hierbei erlittenen HWS-Distorsion tragfähige Aussagen zu treffen. Auch im Gesundheitszeugnis vom 17. August 2005 (Dr. L.) werden hierzu keine tragfähigen Aussagen („Beschwerden können mitverursacht sein durch Instabilität im Bereich des Übergangs zwischen Kopf und Wirbelsäule, u.U. als Folge eines Auffahrunfalls 1997“). Eine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Kausalität ergibt sich hieraus nicht, zumal eine Instabilität des cranio-cervikalen Übergangs von den radiologischen Gutachtern Prof. Dr. B. und Prof. Dr. P.) gerade nicht bestätigt werden konnte (s.o. Nr. I.2).
Eine andere rechtliche Beurteilung ergibt sich schließlich auch nicht aus dem Umstand, dass das Versorgungsamt mit Bescheid vom 15. August 2002 einen beim Kläger vorliegenden Grad der Behinderung (GdB) von 40 v. H. anerkannt hat. Der Beklagte ist an die Feststellungen des Versorgungsamtes nicht gebunden, da bei der Ermittlung des GdB abweichende Feststellungskriterien zugrunde gelegt werden und auch nicht unfallbedingte Körperschäden miteinbezogen werden können (vgl. BVerwG, U. v. 21.9.2000, ZBR 2001,251).
Mangels Nachweises eines atypischen Verlaufs der HWS-Distorsion ist vorliegend von einem regelrechten Heilungsverlauf auszugehen mit der Folge, dass eine dienstunfallbedingte MdE von mindestens 25 v. H. zu keinem Zeitpunkt anzunehmen ist. Ein Anspruch auf Unfallausgleich besteht daher nicht.
III.
Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Gewährung von Unfallruhegehalt.
Gem. Art. 53 BayBeamtVG erhält ein Beamter, der wegen dauernder Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalls in den Ruhestand versetzt wird, Unfallruhegehalt. Diese Voraussetzung ist nicht gegeben, da der Kläger nicht aufgrund des bestandskräftig unfallbedingt anerkannten Körperschadens (HWS-Distorsion Grad I) in den Ruhestand versetzt wurde. Die Beschwerden des Klägers, die zur Dienstunfähigkeit geführt haben und z. B. in den Gesundheitszeugnissen der MUS beschrieben sind, sind gerade nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Dienstunfall und die hierbei erlittene HWS-Distorsion Grad I zurückzuführen (s.o. Nrn. I und II.). Vielmehr ist von einer regelrechten Ausheilung der HWS-Distorsion Grad I nach sechs Monaten, spätestens nach gut einem Jahr nach dem Dienstunfall am 16. Oktober 1997 auszugehen (s.o. II.). Die Ruhestandsversetzung erfolgte erst zum 1. Juli 2006.
IV.
Beweisanträge
1. Nach der mündlichen Verhandlung am 3. Dezember 2015, in der keine Beweisanträge gestellt wurden, hat der Kläger im nachgelassenen Schriftsatz vom … Dezember 2015 folgende Anträge gestellt:
a) „Das Gutachten von Dr. B. vom 22. Juli 2014, seine gutachterliche Stellungnahme vom 13. Januar 2015 und das Sitzungsprotokoll vom 3. Dezember 2015 Frau Dipl.-Psych. M., Herrn Prof. Dr. N. sowie den Professoren Dr. W. und Z. zuzuleiten mit der Bitte, hierzu aus ihrem Fachgebiet Stellung zu nehmen.“
Der Antrag wird abgelehnt. Ein Beweisantrag i. S. v. § 86 Abs. 2 VwGO muss erkennen lassen, dass durch die Ausschöpfung der Beweismittel das Bestehen oder Nichtbestehen einer konkreten Tatsache nachgewiesen werden soll. Ein Antrag, der diesen inhaltlichen Anforderungen nicht genügt, stellt lediglich eine Anregung an das Gericht dar, eine weitere Aufklärung des Sachverhalts vorzunehmen (Beweisermittlungsantrag). Die Ablehnung derartiger Beweisanregungen ist daran zu messen, ob das Tatsachengericht seine Sachaufklärungspflicht nach § 86 Abs. 1 VwGO verletzt hat (st. Rspr., BVerwG, B. v. 25.1.1988 – 7 CB 81.87 – Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 196 S. 14); BVerwG, B. v. 19.5.2016 – 6B 1/16 – juris). Es handelt sich vorliegend nicht um einen Beweisantrag i. S. d. § 86 Abs. 2 VwGO, da sich der Antrag nicht auf eine konkrete und individualisierte Tatsache bezieht, die unter Beweis gestellt werden soll. Bezweckt werden soll offenbar eine Meinungsäußerung der drei genannten Ärzte und Psychologen zu dem Gutachten und den Äußerungen von Dr. B.. Diese Bewertung obliegt jedoch dem Gericht. Angesichts des in sich schlüssigen und ohne offensichtliche Mängel erstellten Gutachtens von Dr. B. drängt sich die Einholung weiterer gutachterlicher Stellungnahmen hierzu auch nicht auf.
b) Hilfsweise wurde beantragt, ein weiteres neurologisch-psychiatrisches Gutachten von einem anderen Sachverständigen gem. §§ 98 VwGO, 412 ZPO einzuholen.
Der Antrag wird abgelehnt. Es liegen bereits neurologische Gutachten von Prof. Dr. Dr. L.W. und Prof. Dr. B. sowie ein neurologisch/psychiatrisch/algesiologisches Gutachten von Dr. B. vor. Sämtliche Gutachten sind in sich schlüssig und weisen keine offenkundigen Mängel oder Widersprüche auf. An der Sachkunde und Unparteilichkeit der Gutachter bestehen keine Zweifel. Das Gericht erachtet daher keines dieser Gutachten als ungenügend. Vor diesem Hintergrund ist die Einholung eines weiteren neurologisch-psychiatrischen Gutachtens gem. § 98 VwGO i. V. m. § 412 ZPO nicht veranlasst.
2. Mit Schriftsatz vom … April 2016 hat der Kläger beantragt, Herrn Dr. L.W. zu beauftragen, ein Ergänzungsgutachten zu fertigen und ihm aufzugeben, die Frage zu beantworten, ob er die Kausalität auch nach dem im Beamtenversorgungsrecht geltenden Beweismaßstab bejaht.
Der Antrag wird abgelehnt. Es handelt sich um keinen Beweisantrag i. S. d. § 86 Abs. 2 VwGO, da der juristisch vertretene Kläger schon keine bestimmte Tatsache unter Beweis gestellt hat. Vielmehr handelt es sich um eine bloße Beweisanregung. Selbst wenn man davon ausginge, dass der Kläger zum Beweis der Tatsache, dass ein Kausalzusammenhang zwischen den geklagten Beschwerden des Klägers mit dem Dienstunfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit besteht, die Einholung eines Zusatzgutachtens des Sachverständigen Dr. L.W. beantragen wollte, würde es sich hierbei um einen bloßen Ausforschungsbeweisantrag handeln. Denn für die unter Beweis gestellte Behauptung gibt es nicht einmal eine gewisse Mindestwahrscheinlichkeit. Mit der Frage der Kausalität haben sich bereits zahlreiche Gutachter auf verschiedensten fachärztlichen Gebieten befasst, ohne dass diese die Kausalität auch nur ansatzweise positiv mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätten begründen können (s.o.). Auch Dr. L.W. selbst hat sich in seinem Gutachten bereits ausführlich zur Frage der Kausalität geäußert und die Umstände dargelegt, aus denen er die Kausalität herleitet. Diese Herleitung ist jedoch in keiner Weise geeignet, eine Kausalität, geschweige denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zu begründen. Zudem überzeugt das Gutachten auch nicht von seinem wissenschaftlichen Ansatz und weist offenkundige Fehler auf (s.o. Nr. I.6), so dass auch eine auf dieser Basis fußende Zusatzbegutachtung als nicht haltbar einzustufen wäre.
Eine weitere Begutachtung drängt sich dem Gericht angesichts der bereits vorliegenden Gutachten auch nicht auf.
V.
Die Klagen waren nach alledem mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.
VI.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 ff. ZPO.
Rechtsmittelbelehrung:
Nach §§ 124, 124 a Abs. 4 VwGO können die Beteiligten die Zulassung der Berufung gegen dieses Urteil innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
beantragen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen. Dem Antrag sollen vier Abschriften beigefügt werden.
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof,
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder
Postanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach
einzureichen, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist.
Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Rechtslehrern mit Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4 und 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen.
Beschluss:
Der Streitwert wird auf Euro 36.634,40 festgesetzt (§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz – GKG -).
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes Euro 200,- übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
einzulegen.
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.
Der Beschwerdeschrift eines Beteiligten sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.