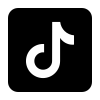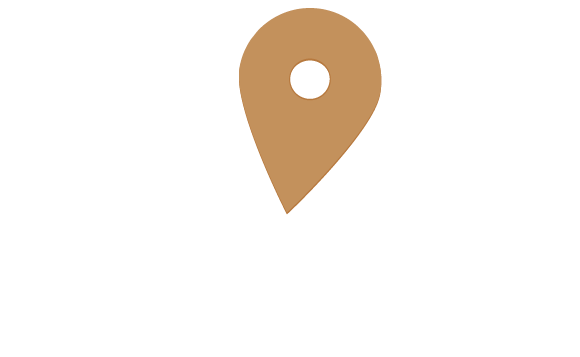Aktenzeichen 2 L 16/20
§ 9 Abs 1 Nr 7 StrlSchV 2001
§ 9 Abs 1 Nr 9 StrlSchV 2001
§ 113 Abs 1 S 4 VwGO
§ 10 VwVfG
Leitsatz
1. Das auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gestützte Fortsetzungsfeststellungsinteresse nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO entfällt nicht dadurch, dass über eine beim Zivilgericht anhängig gemachte Schadenersatzklage bereits erstinstanzlich entschieden ist, solange das Urteil des Zivilgerichts noch nicht rechtskräftig ist.(Rn.62)
2. Die sog. Kollegialgerichtsrichtlinie gilt u.a. dann nicht, wenn das Kollegialgericht bereits in seinem rechtlichen Ausgangspunkt von einer verfehlten Betrachtungsweise ausgegangen ist.(Rn.65)
3. Die „Zuverlässigkeit des Antragstellers“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV 2001 betrifft nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse einer den Genehmigungsantrag stellenden juristischen Person.(Rn.70)
4. Die Genehmigungsvoraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV 2001 verlangt keine Sicherheit gegen ein Insolvenzrisiko des Antragstellers. Gefordert ist vielmehr, dass eine den Anforderungen der AtDeckV genügende Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist.(Rn.82)
5. Die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadenersatzverpflichtungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV 2001 ist in der Regel erst dann getroffen, wenn die Behörde die Deckungsvorsorge festgesetzt hat und der Antragsteller einen entsprechenden Versicherungsvertrag vorgelegt wird. Diese fehlende Genehmigungsvoraussetzung kann aber durch eine Nebenbestimmung sichergestellt werden, nach der von der Genehmigung erst nach Festsetzung der Deckungsvorsorge und Vorlage eines entsprechenden Versicherungsvertrages Gebrauch gemacht werden darf.(Rn.105)
6. Öffentliche Interessen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 9 StrlSchV 2001 sind solche, die einen strahlenschutzrechtlichen bzw. sicherheitsspezifischen, insbesondere die Umwelt betreffenden Bezug haben, aber nicht bereits in den übrigen Nummern des § 9 Abs. 1 StrlSchV 2001 berücksichtigt sind.(Rn.117)
7. Die Behörde ist zur „Aussetzung“ eines Verwaltungsverfahrens auf der Grundlage von § 10 VwVfG ohne die Zustimmung des Antragstellers mit Blick auf eine ausstehende Entscheidung in einem anderen Verfahren jedenfalls dann nicht befugt, wenn diese Entscheidung nicht alsbald zu erwarten steht.(Rn.140)
Verfahrensgang
vorgehend VG Halle (Saale), 19. November 2019, 8 A 1/18 HAL, Urteil
Tenor
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Halle – 8. Kammer – vom 19. November 2019 geändert.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet gewesen ist, der Klägerin die mit Schreiben vom 6. November 2015 beantragte Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen nach den §§ 7, 9 der Strahlenschutzverordnung zu erteilen.
Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen.
Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 vom Hundert des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die Beteiligten streiten über die Frage, ob der Beklagte verpflichtet gewesen ist, der Klägerin eine Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen zu erteilen.
Unter Datum vom 6. November 2015 beantragte die Klägerin beim Beklagten die Erteilung einer Genehmigung nach § 7 der Strahlenschutzverordnung in der Fassung vom 20. Juli 2001 (StrlSchV 2001) zum Umgang mit radioaktiven Stoffen in einer bereits vorhandenen Lagerhalle auf dem im Chemiepark B. gelegenen Grundstück der Gemarkung (G.), Flur A, Flurstück … (R-Straße, Geb. …). Das Grundstück befindet sich in einem durch Bebauungsplan Nr. 6 Areal B/Teil 2 der Stadt B. festgesetzten Industriegebiet. Nach ihren Angaben im Genehmigungsantrag hat sich die Klägerin darauf spezialisiert, bundesweit anfallende schwach radioaktive Reststoffe aus Medizin, Industrie und Forschung vom Anwender zu übernehmen und diese Reststoffe durch Dekontamination, Shreddern und Pressen aufzuarbeiten mit dem vorrangigen Ziel der Freigabe nach § 29 StrlSchV 2001. Der nicht freigabefähige Anteil dieser schwach radioaktiven Stoffe werde mit dem Ziel, endlagerechte Abfallgebinde herzustellen, konditioniert. Zu ihrem Leistungsspektrum gehöre auch die Zwischenlagerung von radioaktiven Reststoffen während der einzelnen Konditionierungsschritte und von fertig konditionierten Abfallgebinden (K.-container) bis zur möglichen Einlagerung in das Endlager Schacht K.. Diese Tätigkeiten führe sie derzeit an den Standorten A-Stadt (Verarbeitung und Konditionierung der Reststoffe und Abfälle) und L-Stadt (Zwischenlagerung) in Rahmen einer Genehmigung nach § 15 StrlSchV durch. Inhaberin der Umgangsgenehmigung nach § 7 StrlSchV für diese Standorte sei ihre Tochterfirma, die E.-GmbH (nachfolgend: EZN). Im Rahmen der Verarbeitung übernehme sie, die Klägerin, keine radioaktiven Reststoffe oder Abfälle von Abfallerzeugern in ihr Eigentum, was rechtlich auch nicht zulässig wäre. Radioaktive Abfälle gingen von den Ablieferpflichtigen in das Eigentum der nach § 9a Abs. 3 AtG eingerichteten Laborsammelstellen über. Historisch bedingt sei auch sie berechtigt, bestimmte schwach radioaktive Reststoffe von Abfallverursachern in ihr Eigentum zu übernehmen. Diese Reststoffe würden über einen Freigabeprozess aus dem atomrechtlichen Zuständigkeitsbereich entlassen. Sei dies nicht möglich, werde der radioaktive Abfall entsprechend der Bedingungen für die Endlagerung radioaktiver Abfälle konditioniert. Danach würden die endlagergerecht verpackten Gebinde von der EZN an die Landessammelstelle Niedersachen abgegeben. Eigentümer dieser Gebinde sei nach Abgabe das Land Niedersachsen. Zu ihren Kunden zählten neben der EZN auch Landessammelstellen, die oftmals nicht über die erforderlichen Kapazitäten verfügten, um alle Be- und Verarbeitungsschritte im Rahmen des Konditionierungsverfahrens selber durchzuführen. Die wachsenden Anforderungen an die Verarbeitung der Reststoffe, die Freigabeverfahren und die Dokumentation ließen sich platzmäßig nicht an den derzeitigen Standorten in A-Stadt oder L-Stadt realisieren. Aus diesem Grund beabsichtige sie, bestimmte Tätigkeiten an einem neuen Standort zu konzentrieren. Am neuen Standort sollten insbesondere die Verfahren zur Bereitstellung und Verarbeitung potenziell freigebbarer Reststoffe konzentriert werden, am Standort A-Stadt die Verfahren im Rahmen der Abfallkonditionierung. In einer ersten Phase solle zunächst die Bereitstellung der Reststoffgebinde bis zur weiteren Verarbeitung an einem anderen Standort umgesetzt werden. Damit sollten die derzeit genutzten Bereitstellungsorte (z.B. am Standort L-Stadt) entlastet werden. In einer zweiten Phase, die einem gesonderten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleibe, sei die Homogenisierung und automatische Sortierung von schwach radioaktiven Reststoffen geplant. In beiden Phasen finde kein Eigentumsübergang statt. Vor diesem Hintergrund beantrage sie am Standort B-Stadt eine Genehmigung zur Bereitstellung von schwach radioaktiven Reststoffen für eine begrenzte Lagerzeit von maximal fünf Jahren pro Reststoffgebinde. Sofern notwendig erfolge eine Zwischenlagerung sowie die Bereitstellung höher aktiver Gebinde auch zukünftig ausschließlich im Lager L-Stadt, für welches eine unbefristete Genehmigung zur Lagerung von Aktivitäten bestehe, die die hier beantragte Aktivität um den Faktor 10.000 übersteige.
Dem Genehmigungsantrag beigefügt war als Anlage 11 eine Erklärung der A-Versicherungs-AG vom 5. November 2015 dass sie sich im Anschluss an den bereits bestehenden Versicherungsschutz für den genehmigten Umgang mit radioaktiven Stoffen gemäß § 7 StrlSchV (2001) in den Standorten A-Stadt und L-Stadt bereiterkläre, für den geplanten neuen Standort in B-Stadt ebenfalls die erforderliche Deckungsvorsorgeversicherung bereitzustellen. Die Deckungsvorsorge für den geplanten neuen Standort in B-Stadt werde im Rahmen einer eigenständigen Strahlenhaftpflichtversicherung bereitgestellt, sobald ihr die endgültigen Genehmigungsunterlagen vorlägen und die Klägerin mit ihren dann angebotenen Bedingungen und Konditionen einverstanden sei.
Am 21. April 2016 reichte die Klägerin den Genehmigungsantrag in einer etwas geänderten Fassung ein.
Am 22. September 2016 erteilte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld der Klägerin die Baugenehmigung zur Umnutzung der Lagerhalle zur Bereitstellung schwach radioaktiver Reststoffe zur weiteren Verarbeitung.
Mit Schreiben vom 27. Juni 2017 teilte der Beklagte der Klägerin mit, dass beabsichtigt sei, den Antrag auf Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen abzulehnen. Zur Begründung hieß es im Wesentlichen, der Bewilligung stünden überwiegende öffentliche Interessen entgegen. § 9 Abs. 1 Nr. 9 StrSchV 2001 räume insoweit den Umweltauswirkungen eine besondere Bedeutung ein. Das öffentliche Interesse erschöpfe sich jedoch nicht hierin. Zu berücksichtigen sei danach, dass die Ausgestaltung einer solchen Genehmigung ernstzunehmende Schwierigkeiten hinsichtlich der objektiven Abgrenzung zwischen radioaktiven Reststoffen und radioaktiven Abfällen bereite. So sei er, der Beklagte, lediglich für die Erteilung von Genehmigungen zum Umgang mit radioaktiven Stoffen, die keine radioaktiven Abfälle seien, zuständig. In einer Genehmigung nach § 7 Abs. 1 StrlSchV 2001 seien deshalb Auflagen zu erteilen, die Umgang, Lagerung etc. von radioaktiven Abfällen von vornherein ausschließen würden. Der bisher einzig genannte Anlieferer, die Firma EZN, besitze jedoch Genehmigungen, sowohl mit radioaktiven Reststoffen als auch mit radioaktiven Abfällen deutschlandweit befugt umzugehen. Eine gegebenenfalls falsche Deklaration zur Bereitstellungslagerung angelieferter radioaktiver Stoffe in geschlossenen Gebinden sei für die Aufsichtsbehörde jedoch nicht erkennbar und objektivierbar. Eine Unterscheidung sei nicht anhand von radioaktiven Eigenschaften der zu lagernden Stoffe möglich, sondern folge nach § 9a Abs. 1 Satz 1 AtG dem Kriterium, ob diese Stoffe schadlos zu verwerten oder geordnet zu beseitigen seien. Dies sei der Aufsichtsbehörde im Einzelfall nicht bekannt und auch nicht objektivierbar. Eine Genehmigungsauflage zum Ausschluss radioaktiver Abfälle könnte nicht überprüft und nicht durchgesetzt werden. Das sei verwaltungsrechtlich unzulässig. Für eine Erweiterung der Genehmigung auf Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle besitze er keine Zuständigkeit. Ein zweiter Grund für die Versagung des öffentlichen Interesses an dem beantragten Umgang liege in den Insolvenzrisiken der Klägerin und der EZN begründet. Sachsen-Anhalt betreibe keine eigene Landessammelstelle, sondern bediene sich unter Nutzung von § 9a Abs. 3 Satz 2 AtG eines Anlehnungsvertrages an die Landessammelstelle in Sachsen. Laut aktueller Kostenordnung der Landessammelstelle des Freistaates Sachsen für radioaktive Abfälle würden sich die Kosten auf 8.000 bis 15.000 € pro Gebinde belaufen, abhängig von der Gebindegröße. Multipliziert mit dem Inhalt eines auch nur halbvollen Lagers im beantragten Umfang würden im Insolvenzfall auf das Land Sachsen-Anhalt Entsorgungskosten zukommen, die das Angebot aus einem Schreiben der Klägerin vom 16. November 2016 bei weitem übersteigen würden. Ein dritter Grund, der dem öffentlichen Interesse eines solchen Lagers in Sachsen-Anhalt entgegenstehe, bestehe darin, dass Sachsen-Anhalt bisher über kein derartiges oder ähnliches Lager verfüge. Damit bestehe ein grundsätzliches Risiko, dass ein neuer Schwerpunkt von Demonstrationen von „Kernkraftgegnern“ am vorgesehenen Standort eines solchen Bereitstellungslagers entstehe bzw. entsprechende Aktivitäten sich dorthin verschieben würden. Für Sachsen-Anhalt bedeute das ein zusätzliches Vorhalten von Ordnungskräften, was wiederum mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre. Auf der Nutzenseite für das öffentliche Interesse Sachsen-Anhalts stehe dagegen recht wenig. Mit zusätzlichen Steuereinnahmen aus der Tätigkeit der Klägerin und der EZN sei nicht zu rechnen, da sich die Firmensitze in Niedersachsen befänden. Eventuelle zusätzliche Einnahmen durch den Hallenvermieter würden als gering bewertet bzw. seien durch andere Mieter kompensierbar. Neue Arbeitsplätze würden zwar zweifelsfrei entstehen, allerdings nicht in erheblicher Anzahl, da es sich nicht um einen Produktionsstandort, sondern um ein reines Lager handeln solle. In einer Gesamtschau würden bei pflichtgemäßem Ermessen der Gesamtsituation die Tatsachen überwiegen, die dem öffentlichen Interesse Sachsen-Anhalts an einem solchen Bereitstellungslager für radioaktive Reststoffe eher entgegenstehen würden.
Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz teilte dem Beklagten mit Schreiben vom 6. Juli 2017 mit, dass die Klägerin für ein in L., Ortsteil L-Stadt (Landkreis Nienburg) gelegenes Lager für radioaktive Stoffe am 27. November 2013 einen Antrag auf Übertragung einer der EZN erteilten Genehmigung vom 29. Dezember 2008 zum Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen gemäß § 7 StrlSchV 2001 auf die Klägerin beantragt habe. Diesen Antrag habe das inzwischen zuständige Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz abgelehnt. Die hierfür unter anderem erforderliche Genehmigungsvoraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV 2001 liege nicht vor, weil aufgrund der schlechten finanziellen Situation der Klägerin Bedenken gegen die wirtschaftliche Zuverlässigkeit der Firma bestünden. Gegen diese Entscheidung vom 24. März 2017 habe die Klägerin beim Verwaltungsgericht Braunschweig Klage erhoben.
Der Beklagte teilte daraufhin der Klägerin mit Schreiben vom 24. Juli 2017 mit, dass das Verwaltungsverfahren nach § 10 VwVfG ausgesetzt werde. Wegen der Ähnlichkeit der beantragten Verwaltungstatbestände in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt in Verbindung der Rechtshängigkeit des Verfahrens beim Verwaltungsgericht Braunschweig habe er sich dafür entschieden, das Ergebnis dieses Rechtsstreits abzuwarten, um die ordnungsgemäße Rechtsanwendung in dem in Rede stehenden Fall zu gewährleisten. Diese Entscheidung basiere auch auf einer Betrachtung der Gründe, die in Niedersachsen zur Ablehnung der begehrten Genehmigungsübertragung und in Sachsen-Anhalt bisher zur Erwägung eines Ablehnungsbescheides hinsichtlich einer neuen Umgangsgenehmigung geführt hätten.
Mit Schreiben des Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 28. August 2017 teilte diese daraufhin dem Beklagten zunächst mit, dass ein Aussetzen des Verfahrens nicht in Betracht komme, und bat um eine zeitnahe Entscheidung über ihren Antrag.
Am 18. September 2017 hat die Klägerin (Untätigkeits-)Klage erhoben, mit der sie zunächst die Verpflichtung des Beklagten zur Erteilung der beantragten Genehmigung nach § 7 StrlSchV 2001 begehrt hat. Zu Begründung hat sie u.a. ausgeführt: Die Absicht des Beklagten, eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Braunschweig abwarten zu wollen, die mit dem Genehmigungsverfahren zwischen den hier am Verwaltungsverfahren Beteiligten nichts zu tun habe, sei kein sachlicher Grund für ein Zuwarten im Sinne von § 75 VwGO. Der Beklagte wäre verpflichtet gewesen, eine Entscheidung zu treffen, lehne dies aber eindeutig und endgültig unter Verweis auf § 10 VwVfG ab. Gründe für eine Aussetzung lägen jedoch nicht vor.
Nachdem die Geschäftsführung des Chemieparks B. mit Schreiben vom 18. Oktober 2017 und 9. November 2017 mitgeteilt hatte, dass die Verhandlungen mit der Klägerin über den Kauf eines Grundstückes im Chemiepark B. für die geplante Anlage abgebrochen würden, nachdem die Klägerin über die unerwarteten Schwierigkeiten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den Standort berichtet habe, hat die Klägerin ihr Begehren auf eine Fortfestsetzungsfeststellungsklage umgestellt und zu deren Begründung weiter ausgeführt:
Der Umstand, dass der Beklagte bislang noch keinen Verwaltungsakt erlassen habe, stehe der Statthaftigkeit des Fortsetzungsfeststellungsantrages nicht entgegen. Gerade in Verpflichtungssituationen wie hier gehe es um die Feststellung, dass der Beklagte zum Erlass eines bestimmten Verwaltungsakts verpflichtet gewesen sei. Die von ihr erhobene Untätigkeitsklage sei im Zeitpunkt der Erledigung zulässig gewesen. Insbesondere habe im Zeitpunkt der Klageerhebung kein sachlicher Grund vorgelegen, der eine Überschreitung der in § 75 VwGO vorgesehenen 3-Monatsfrist gerechtfertigt hätte. Zwar könne angesichts der unstreitig komplexen Regelungsmaterie und des Umfangs des Genehmigungsverfahrens die Frist zu einer Entscheidung im Fall des klägerseitigen Antrags durchaus länger als drei Monate bemessen seien. Darauf komme es vorliegend jedoch nicht an. Selbst wenn man das Vorliegen der prüffähigen Unterlagen nach dem Vortrag des Beklagten vom 18. April 2017 zugrunde lege oder sogar die ausdrückliche Mitteilung des Beklagten vom 13. Juli 2017 für maßgeblich erachten wollte, sei spätestens am 13. Oktober 2017 die 3-Monatsfrist des § 75 VwGO abgelaufen gewesen. Für den Ablauf der 3-Monatsfrist komme es nicht auf die Klageerhebung, sondern auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung an. Für die Untätigkeit habe es auch keinen zureichenden Grund gegeben. Ein solcher stelle insbesondere nicht die am Verwaltungsgericht Braunschweig anhängige Klage dar. Auch aus der Perspektive des Beklagten sei zum Zeitpunkt seiner Aussetzungsentscheidung klar gewesen, dass über den Genehmigungsantrag mindestens ein weiteres Jahr nicht entschieden werden würde. Der Beklagte habe nicht absehen können, ob das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig überhaupt mit einer Sachentscheidung enden würde. Eine solche habe es dann auch nicht gegeben. Hätte der Beklagte ihr die Möglichkeit gegeben, zu der Aussetzungsentscheidung zuvor Stellung zu nehmen, hätten Missverständnisse vermieden werden können. Der Beklagte habe weder selbst Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Klägerin bei ihr eingeholt noch ihr die Gelegenheit gegeben, durch Patronatserklärungen, Bürgschaften und anderen Sicherungsmitteln eine für den Beklagten tragbare Situation herzustellen.
Die Klage sei auch im Übrigen zulässig. Insbesondere habe sie ein berechtigtes Interesse an der Feststellung in Fortsetzung der bisherigen Klage. So bestehe zum einem Wiederholungsgefahr. Der in Streit stehende Genehmigungsantrag zeige, dass sie einen Standort im Zuständigkeitsbereich des Beklagten betreiben wolle und ein neues Genehmigungsverfahren – wenn möglich – anstrengen werden. Es sei zu befürchten, dass auch zukünftige Anträge mit gleichen Erwägungen erneut abgelehnt werden. Darüber hinaus bestehe ein Präjudizinteresse. Sie strebe eine Schadensersatzklage gegen den Beklagten an. Mit der Verzögerung des Verfahrens durch Untätigkeit und der Aussetzung des Verwaltungsverfahrens habe der Beklagte Amtspflichten verletzt, was dazu geführt habe, dass ihre Aufwendungen wertlos geworden seien und bei ihr Schäden entstanden seien. Der Beklagte hätte ihren Antrag positiv bescheiden müssen. Ein Ermessen habe ihm nicht zugestanden. In dem anzustrebenden Amtshaftungsverfahren nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG werde sie zunächst die hohen Planungsaufwendungen für die Erstellung der Antragsunterlagen und die Durchführung des Genehmigungsverfahrens sowie die entgangenen Gewinne als Schaden gegenüber dem Beklagten geltend machen. Die völlig missglückte Aussetzungsentscheidung des Beklagten sei der nachweisbare Anlass gewesen, der im Verhältnis von ihr, der Klägerin, zum Chemiepark B. zu so großen Unsicherheiten geführt habe, dass ihr das Grundstück nicht mehr vorgehalten werden sollte. Der Geschäftsführer des Chemieparks habe ihr gegenüber ausdrücklich mitgeteilt, dass die Aufhebung der Reservierung aufgrund der Aussetzungsentscheidung des Beklagten erfolgt sei. Selbst wenn der Genehmigungsantrag durch den Beklagten abgelehnt worden wäre, wäre man in der Lage gewesen, dem Geschäftsführer des Chemieparks im Einzelnen aufzuzeigen, mit welchen verwaltungsgerichtlichen Instrumenten in welchem zeitlichen Korridor eine Genehmigung hätte erstritten werden können. Für den juristischen Laien sei es aber überhaupt nicht einzuschätzen, wie mit einer Aussetzungsentscheidung einer Behörde umzugehen sei. Da die Aussetzung eines Antragsverfahrens praktisch in der Verwaltungstätigkeit auch nicht vorkomme, weil sie nahezu immer unzulässig sei, sei das Misstrauen des Chemieparkbetreibers derart groß gewesen, dass man sich trotz eingehender Bemühungen von Seiten der Klägerin dazu entschlossen habe, die Reservierung aufzuheben. Mit dieser Entscheidung sei es ihr, der Klägerin, unmöglich gemacht worden, ihre Planungskosten durch den späteren Betrieb der avisierten Anlage zu amortisieren. Sämtliche Aufwendungen seien damit vergeblich gewesen.
Die Klage sei auch begründet. Sie habe einen Anspruch auf Erteilung der beantragten Genehmigung gehabt. Die Genehmigungsvoraussetzungen hätten vorgelegen. Soweit der Beklagte darauf hingewiesen habe, dass eine Abgrenzung von radioaktiven Reststoffen und radioaktiven Abfällen nicht möglich und für die Behörde nicht leistbar sei, sei dies kein Grund für eine Ablehnung der Genehmigung. Die Abgrenzung von radioaktiven Reststoffen und radioaktiven Abfällen sei aus der StrlSchV und dem AtG abzuleiten. Für die Überwachungsbehörden bestehe bei der Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen in bestimmten Fällen auch die Herausforderung, beispielsweise bei den lagernden oder in Produktionsprozess anfallenden Substanzen im Einzelnen festzustellen, ob es sich um Abfall handele oder nicht. Dies rechtfertige aber nicht die Ablehnung eines Genehmigungsantrages. Es sei Aufgabe der zuständigen Behörde, ihren Überwachungspflichten nachzukommen und Mitarbeiter entsprechend zu schulen und ein Überwachungsprogramm aufzustellen bzw. dieses von dem Anlagenbetreiber einzufordern. Soweit sie beantragt habe, nur radioaktive Reststoffe anzunehmen und zu lagern, habe sie diese Verpflichtung einzuhalten. Dabei sei durch eine eingehende Dokumentation der Herkunft und des Inhalts der Fässer auch durch Auslegung der Begriffe „Reststoff“ und „Abfall“ auch für die Behörde möglich zu ermitteln, ob es sich um einen radioaktiven Reststoff oder um radioaktiven Abfall handele. So müsse, wie im allgemeinen Abfallrecht auch, für die einzelnen Stoffe geprüft werden, ob eine Wiederverwendung, Aufbereitung oder Ähnliches möglich sei oder ob eine Endlagerung zwingend erforderlich sei, so dass nach § 9a Abs. 1 Satz 1 AtG von einem radioaktiven Abfall auszugehen sei. Es sei für sie nicht erkennbar, warum diese Prüfung für die Behörde nicht zu leisten sein solle, wenn vergleichbare Auslegungsfragen zum alltäglichen Aufgabenspektrum der allgemeinen Abfallbehörden zählten. Die Abgrenzungsschwierigkeit sei jedenfalls kein tragfähiger Umstand, einen Genehmigungsantrag abzulehnen. Die Klägerin könne allenfalls durch Nebenbestimmungen dazu verpflichtet werden, ein Überwachungsregime einzurichten oder Dokumentationspflichten zu erfüllen, die den Überwachungsaufwand des Beklagten erleichtern könnten. Der Beklagte sei darauf beschränkt zu prüfen, ob die geltenden Gesetze eingehalten würden, insbesondere die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 9 StrlSchV erfüllt seien.
Soweit der Beklagte darauf hinweise, dass ein gewisses Insolvenzrisiko der Klägerin bestehe und im Fall der Insolvenz erhebliche Entsorgungskosten auf das Land zukommen könnten, rechtfertige auch dies eine Ablehnung der Genehmigung nicht. Was ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angehe, sei zunächst anzuführen, dass die EZN eine hundertprozentige Tochter der Klägerin sei. Zwischen den Beteiligten bestehe ein Gewinnabführungsvertrag der EZN zugunsten der Klägerin. Die EZN betreibe im Land Niedersachsen mit einer Umgangsgenehmigung Einrichtungen, die mit der geplanten Einrichtung in B-Stadt vergleichbar seien. Dass die EZN in wirtschaftlicher Hinsicht fähig sei, die beiden von ihr gehaltenen Lager ordnungsgemäß zu betreiben, stehe dabei überhaupt nicht in Frage. Die Ablehnung der Übertragung der Genehmigung von der EZN auf die Klägerin in Niedersachsen sei lediglich vor dem Hintergrund erfolgt, dass die wirtschaftliche Situation der Klägerin auf der Grundlage des Geschäftsjahres 2015 als schlecht bewertet worden sei, weil in diesem Jahr hohe Rückstellungen hätten gebildet werden müssen. Erst nach Ablehnung der Genehmigungsübertragung unter Hinweis auf den Jahresabschluss 2015 sei ihr Jahresabschluss für das Jahr 2016 erstellt worden, wonach bereits ein Gewinn erwirtschaftet worden sei. Vor diesem Hintergrund sei in dem Verfahren der Genehmigungsübertragung vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig ihr Antrag neu zu bewerten. Dies finde gerade in Abstimmung mit dem Land Niedersachsen statt. Könne es mithin allein um eine Bewertung der wirtschaftlichen Situation der Klägerin gehen, sei darauf hinzuweisen, dass zwei Patronatserklärungen existierten, die zu einer ergänzenden finanziellen Absicherung der Klägerin durch die EZN erstellt worden seien. Eine solche Erklärung bestehe sowohl für das Zwischenlager in L-Stadt als auch bereits für das geplante Lager in B-Stadt. Darüber hinaus sei darauf hinzuweisen, dass sämtliche bei ihr in B-Stadt zu lagernden Stoffe im Eigentum der EZN stehen würden. Sollte die Klägerin mithin tatsächlich insolvent werden, so würden nach allgemeinen ordnungsrechtlichen und abfallrechtlichen Gesichtspunkten die EZN als Eigentümerin der Abfälle in die Entsorgungspflicht einrücken und könnte ohne weiteres zur Entsorgung herangezogen werden. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage eines Risikos der Insolvenz der Klägerin überhaupt nicht, jedenfalls nicht bezogen auf die Entsorgungskosten. Die Entsorgungskosten würden nicht dem Land, sondern dem Abfalleigentümer zufallen. Eigentümer sei aber die EZN, deren wirtschaftliche Zuverlässigkeit nicht in Abrede gestellt werde. Zudem müsse der vom Beklagten angegebenen Betrag der Entsorgungskosten vor dem Hintergrund des tatsächlichen Risikos entsprechend deutlich reduziert werden. Soweit der Beklagte gleichwohl Zweifel an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Klägerin habe, hätte er dies über Nebenbestimmungen regeln können, in denen beispielsweise über die Vorlage einer Patronatserklärung eine finanzielle Absicherung hätte verlangt werden können. Schließlich hätte sie auch eine entsprechende Bankbürgschaft oder auch Versicherungen beibringen können. Diese Möglichkeiten habe der Beklagten gar nicht in Betracht gezogen.
Die Erwägung des Beklagten, dass bei Genehmigung eines Lagers möglicherweise Demonstrationen von Atomkraftgegnern stattfinden würden und dies nicht gewollt sei, sei schließlich politischer und nicht rechtlicher Natur.
Die Klägerin hat beantragt,
festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet gewesen ist, ihr die mit Schreiben vom 6. November 2015 beantragte Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen nach den §§ 7, 9 StrlSchV 2001 zu erteilen.
Der Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Er hat vorgetragen: Die Fortsetzungsfeststellungsklage sei schon nicht statthaft, weil auch die ursprünglich erhobene Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO unzulässig gewesen sei. Über den Antrag der Klägerin auf Vornahme des begehrten Verwaltungsaktes sei nicht ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden. Im Juli 2017 sei im Rahmen des Verwaltungsverfahrens eine neue Situation bekannt geworden, die Bedenken gegen die wirtschaftliche Zuverlässigkeit der Klägerin betroffen hätte. Diesbezüglich sei eine Klage der Klägerin beim Verwaltungsgericht Braunschweig anhängig gewesen. Wegen der Ähnlichkeit der beantragten Verwaltungstatbestände in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt habe er sich dafür entschieden, das Ergebnis des Rechtsstreits in Niedersachsen abzuwarten, um die ordnungsgemäße Rechtsanwendung in dem in Rede stehenden Fall zu gewährleisten. Diese Entscheidung habe auch auf einer Betrachtung der Gründe basiert, die in Niedersachsen zur tatsächlichen Genehmigungsübertragung und in Sachsen-Anhalt bisher zum Ergehen eines Ablehnungsbescheides hinsichtlich einer neuen Umgangsgenehmigung geführt hätten. Diese Anhängigkeit eines Musterprozesses, dessen baldige Entscheidung zu erwarten gewesen sei, sei als zureichender Grund anerkannt. Der angegriffene abschlägige Bescheid des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz umfasse im Kern den gleichen Sachverhalt wie in dem hier in Rede stehenden Genehmigungsverfahren. Zudem sei eine Klärung der Rechtsproblematik erwartet worden, wann sonstige radioaktive Stoffe und wann radioaktive Abfälle vorliegen. Mit Nichtwissen werde bestritten, dass das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig derzeit förmlich ruhe und es gar keine Sachentscheidung geben werde. Vor dem Bekanntwerden der geänderten Verhältnisse sei es ihm nicht möglich gewesen, über den Antrag zu entscheiden, da ihm die Genehmigungsunterlagen bis zum 18. April 2017 nicht in abschließend prüffähiger Form vorgelegen hätten. Unvollständige Antragsunterlagen würden wiederum ein Zuwarten rechtfertigen. Die Fortsetzungsfeststellungsklage sei auch deshalb nicht statthaft, weil die hier zu klärenden Fragen im Rahmen des beabsichtigten Schadenersatzprozesses vom Zivilgericht geklärt werden könnten. Der Klägerin fehle es darüber hinaus am Rechtsschutzbedürfnis. Insbesondere sei keine Wiederholungsgefahr gegeben. Zum einen habe er noch gar keinen Verwaltungsakt erlassen. Zum anderen sei nicht erkennbar, dass einem in der Zukunft liegenden möglichen Antrag der Klägerin im Wesentlichen unveränderte, tatsächliche und rechtliche Umstände zugrunde gelegt werden könnten. Es sei nicht ersichtlich, dass der unwahrscheinliche Fall eintrete, dass der Klägerin erneut ein Grundstück im Chemiepark B. als Umgangsort zur Verfügung gestellt werde. Des Weiteren würden bei einer zukünftigen Antragstellung der Klägerin nicht die gleichen rechtlichen Umstände zugrunde gelegt werden. Zum einen werde ein alsbaldiger Ausgang des gerichtlichen Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig erwartet, so dass der Abschluss dieses Musterprozesses künftig keine Verfahrensvoraussetzung mehr sein könne. Zum anderen bedinge das zum 31. Dezember 2018 in Kraft tretende Strahlenschutzgesetz und die darauf gestützte neue Strahlenschutzverordnung, dass veränderte rechtliche Umstände bei der Antragsbearbeitung zugrunde gelegt werden müssten. Zudem müsse wegen der Ortsgebundenheit des Antrages nach §§ 7, 9 StrlSchV ein völlig neuer Antrag gestellt werden, der folglich mit einer neuen Prüfung und Einzelfallentscheidung einherginge. Auch das Präjudizinteresse sei nicht gegeben. Die Klägerin behaupte bisher lediglich, eine Schadensersatzklage gegen ihn anzustreben und etwaige Schäden geltend machen zu wollen. Ungeachtet dessen sei der möglicherweise beabsichtigte Schadensersatzprozess offensichtlich aussichtslos. Denn die Amtshaftungsklage sei von vornherein nicht erfolgversprechend. Es fehle jedenfalls an einem Verschulden im Sinn der § 839 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 34 Satz 1 GG. Der Entschluss der für den Beklagten handelnden Amtsträger, die Entscheidung bezüglich des streitgegenständlichen Genehmigungsverfahrens bis zum Abschluss des anhängigen Musterprozesses auszusetzen, sei zumindest vertretbar gewesen. Ein Verwaltungsverfahren sei zwar grundsätzlich nicht gegen den Willen des Antragstellers auszusetzen. Jedoch seien Ausnahmen von diesem Grundsatz zulässig, wenn es – wie hier – auf Grundlage einer unmittelbaren Vorgreiflichkeit oder vergleichbaren Erwägungen geboten sei. Darüber hinaus fehle es an der erforderlichen haftungsbegründenden Kausalität zwischen der behaupteten Rechtsverletzung und dem behaupteten Schaden. So werde bestritten, dass der Klägerin durch die Aussetzungsentscheidung überhaupt ein Schaden entstanden sei, den sie ihm gegenüber geltend machen könne, und dass eine haftungsbegründende Kausalität zwischen der Aussetzungsbescheidung und dem behaupteten Schaden bestehe. Schließlich habe er vor der Aussetzung dazu tendiert, den Genehmigungsantrag abzulehnen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Chemiepark B. GmbH nicht auch infolge eines ablehnenden Bescheides die Aufhebung der Reservierung vorgenommen hätte. Weiterhin liege keine Entscheidungsreife vor, da eine Vielzahl der Genehmigungsvoraussetzungen fehlen würde. Dies betreffe insbesondere die mangelnde Insolvenzsicherung; insoweit habe die Klägerin lediglich einen Betrag von 50.000,00 € angeboten. Von der Patronatserklärung vom 11. Juli 2017 habe er schließlich erstmalig durch die Übersendung ihm zunächst nicht zur Verfügung gestellter Anlagen zur Klageschrift durch das Gericht am 7. Februar 2018 erfahren. Danach könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Patronatserklärung bereits vor dem erledigenden Ereignis bei ihm eingegangen sei. Insbesondere sei die erforderliche Vorsorge für den Insolvenzfall zum Zeitpunkt der Aussetzung des Verwaltungsverfahrens noch nicht nachgewiesen worden. Der Antrag auf Genehmigung nach § 7 StrlSchV sei auch aus weiteren, wenn auch möglicherweise noch ausräumbaren Gründen, im Zeitpunkt der Aussetzung des Verfahrens jedenfalls noch nicht entscheidungsreif gewesen. So sei vorgesehen, dass die Firma EZN Kunde der Klägerin werde. Fraglich sei daher, welche Regelungen die EZN und die Klägerin im Innenverhältnis getroffen hätten, um zu gewährleisten, dass das Umgehungsverbot gemäß § 79 StrlSchV eingehalten werde. Daneben hätten der Genehmigung weitere überwiegende Interessen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 9 StrlSchV entgegengestanden. Dies betreffe die objektive Nichtabgrenzbarkeit zwischen sonstigen radioaktiven Stoffen und Abfällen, die einen Verwaltungsvollzug unmöglich mache. Des Weiteren beantrage die Klägerin, radioaktive Stoffe bis zu einer maximalen Gesamtaktivität in Höhe des 10 7 – fachen der Freigrenzen gemäß Tabelle 1 Spalte 2 Anlage 2 zur StrlSchV als Summe des Vielfachen der Freigrenzen der einzelnen Radionuklide einzulagern. Diese Nuklide müssten einzeln benannt werden. Soweit die Klägerin Gebinde Dritter einlagern wolle, müsse sie noch darlegen, wie deren Nuklide und Aktivitäten von ihr dokumentiert würden. Fraglich sei auch, wo die Zulässigkeitsabschätzung erfolge, ob diese Gebinde in G-Stadt eingelagert werden könnten. Ferner habe die Klägerin noch nicht angeboten sicherzustellen, dass der jeweilige Eigentümer der Fässer außen und festverbunden an diesen kenntlich gemacht sei. Zudem sei nicht ersichtlich, welche Schwächungsfaktoren die Klägerin bei der Abschätzung von Dosisleistungen gemäß Anlage 5 des Genehmigungsantrages vom 15. April 2016 zugrunde gelegt habe. Außerdem bedürfe die Beschreibung des Sammelsystems einer weiteren Konkretisierung, zum Beispiel im Hinblick auf Sortierungen sowie Art und Weise der Befüllung der Fässer mit radioaktiven Reststoffen und der Zusammenlagerung von unterschiedlichen Nukliden oder im Hinblick auf die Chargierung der Fässer. Weiterhin sei für Ortsdosisleistungsmessungen die Feststellung eines sinnvollen Nullwerts notwendig. Schließlich bedürfe es noch einer Verpflichtung der Klägerin zur Kennzeichnung von Stapelbehältern, die getrennt die jeweils zulässige Nutzlast und Auflast ausweisen würden.
Mit dem angegriffenen Urteil vom 19. November 2019 hat das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen und zu Begründung ausgeführt:
Die Klage sei zwar zulässig. Die Fortsetzungsfeststellungklage sei die statthafte Klageart. Das ursprüngliche Begehren der Klägerin, den Beklagten zu verpflichten, ihr die mit Schreiben vom 6. November 2015 beantragte Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen nach den §§ 7, 9 StrlSchV zu erteilen, habe sich mit der Aufkündigung der Zusammenarbeit durch den Chemiepark B. und damit dem Wegfall des für die beantragte Tätigkeit erforderlichen Raumes erledigt. Der Klägerin könne insoweit nicht entgegengehalten werden, dass im Zeitpunkt der Erledigung noch kein Verwaltungsakt vorgelegen habe, der für rechtswidrig erklärt werden könne. Gegenstand der Verpflichtungsklage nach § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO – auch in Form einer Untätigkeitsklage – sei die Frage, ob die Ablehnung oder Unterlassung des beantragten Verwaltungsaktes rechtswidrig gewesen sei. Dies dürfe nicht so verstanden werden, dass die inzidente Feststellung der Rechtswidrigkeit eines ablehnenden Bescheides notwendige Voraussetzung und damit notwendiger, wenn auch unausgesprochener Bestandteil der im Verpflichtungsfall beantragten gerichtlichen Entscheidung sei. Bestandteil des Streitgegenstandes der Verpflichtungsklage sei nicht die Feststellung, dass der Verwaltungsakt in dem die Ablehnung nach außen Gestalt gefunden habe, rechtswidrig sei, sondern die Feststellung, dass die Weigerung der Behörde in dem für das Verpflichtungsbegehren entscheidenden Zeitpunkt, den beantragten Verwaltungsakt zu erlassen, die Rechtsordnung verletze. Gegenstand der Fortsetzungsfeststellungsklage ist daher regelmäßig auch nicht die Frage, ob ein beantragter unterlassener Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen sei, sondern vielmehr die Frage, ob die Ablehnung oder Unterlassung des beantragten Verwaltungsaktes im maßgeblichen Zeitraum des Eintrittes des erledigenden Ereignisses rechtswidrig gewesen sei.
Der Statthaftigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage stehe ebenso wenig eine etwaige Unzulässigkeit der zunächst erhobenen Untätigkeitsklage entgegen. Die Klägerin habe die Untätigkeitsklage bei dem erkennenden Gericht jedenfalls nach Ablauf der in § 75 Satz 2 VwGO geregelten Sperrfrist von drei Monaten erhoben. Dies habe zur Folge, dass das Gericht die Klage nicht wegen verfrühter Erhebung als unzulässig hätte abweisen können, und zwar selbst dann nicht, wenn es einen zureichenden Grund im Sinne des § 75 Satz 3 VwGO für die Verzögerung gegeben hätte. Wäre das Gericht zu der Entscheidung gelangt, dass für die Verzögerung der Entscheidung der Behörde ein zureichender Grund vorgelegen habe, so hätte das Gericht daraus allenfalls die Schlussfolgerung ziehen können, dem Beklagten eine angemessene Nachfrist zur Entscheidung zu setzen. Ob die von dem Beklagten verfügte Aussetzung des Genehmigungsverfahrens rechtmäßig erfolgt sei, könne vor diesem Hintergrund für die Zulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage dahingestellt bleiben.
Das im Rahmen von § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO analog erforderliche Fortsetzungsfeststellungsinteresse der Klägerin sei gegeben. Es könne zwar nicht aus einer Wiederholungsgefahr hergeleitet werden. Dabei könne offenbleiben, ob die maßgeblichen rechtlichen und tatsächlichen Umstände vorliegend im Wesentlichen unverändert geblieben seien, obgleich eine Genehmigung der von der Klägerin beantragten Art nach dem Inkrafttreten Strahlenschutzgesetzes vom 27. Juni 2017 am 31. Dezember 2018 auf einer anderen Rechtsgrundlage als noch zum Zeitpunkt des Eintrittes des erledigenden Ereignisses erfolgen müsste. Es sei bereits deshalb ungewiss, ob in Zukunft noch einmal die gleichen tatsächlichen Verhältnisse eintreten werden, wie im Zeitpunkt des Eintritts des erledigenden Ereignisses, weil nicht hinreichend sicher abzusehen sei, dass in Zukunft wieder eine vergleichbare Genehmigung durch die Klägerin bei dem Beklagten beantragt werden könnte. Derzeit liege bei dem Beklagten kein entsprechender Antrag vor. Eine solche Prognose lasse sich auch nicht treffen. Die Ausführungen der Klägerin hierzu erschöpften sich in ihrem Vorbringen, weiterhin auf der Suche nach geeigneten Grundstücken für ein vergleichbares Vorhaben zu sein. Ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse der Klägerin bestehe jedenfalls mit Blick auf die von ihr dargelegte Absicht, gegen den Beklagten einen Schadensersatzanspruch wegen pflichtwidrigen schuldhaften Verhaltens geltend machen zu wollen. Es könne davon ausgegangen werden, dass ein Amtshaftungsprozess mit hinreichender Sicherheit zu erwarten sei. Die Klägerin habe hierzu konkret vorgetragen, und zwar zur Art der geltend zu machenden Ansprüche wie auch zur geltend zu machenden Schadenshöhe. Es sei auch nicht von vornherein ausgeschlossen, dass eine mögliche Feststellung, dass die Klägerin im Zeitpunkt des Eintrittes der Erledigung einen Anspruch auf Erteilung der begehrten strahlenschutzrechtlichen Genehmigung gehabt habe, Auswirkungen auf einen geltend gemachten Schadensersatzanspruch – dem Grunde oder der Höhe nach – haben könnte. Insbesondere sei nicht offensichtlich, dass der von der Klägerin geltend gemachte Schaden nicht jedenfalls teilweise kausal auf der hier streitigen Nichterteilung der begehrten Genehmigung beruhe. Zur Beantwortung der Frage, ob die Amtspflichtverletzung den behaupteten Schaden verursacht habe, sei nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu prüfen, welchen Verlauf die Dinge bei pflichtgemäßem Verhalten des Amtsträgers genommen hätten und wie sich in dem Fall die Vermögenslage des Verletzten darstellen würde. Die Klägerin sehe als Amtspflichtverletzung in erster Linie die zögerliche Bearbeitung ihres Genehmigungsantrages. Als Schaden mache sie Kosten geltend, die ihr im Zusammenhang mit der Beantragung der Genehmigung entstanden seien, ferner entgangenen Gewinn. Die Frage, ob überhaupt ein Anspruch auf Erteilung der streitgegenständlichen Genehmigung bestanden habe, hätte dabei auch Auswirkungen auf die Beantwortung der Frage, ob die von der Klägerin geltend gemachte zögerliche Bearbeitung ihres Antrages kausal für den eingetretenen Schaden gewesen sei. Schließlich sei die beabsichtigte Geltendmachung eines Amtshaftungsanspruchs auch nicht offensichtlich aussichtslos. Es könne insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass das für einen Amtshaftungsanspruch erforderliche Verschulden offensichtlich fehle. Das Vorbringen des Beklagten, ein Schadensersatzanspruch sei ausgeschlossen, weil die Klägerin es unterlassen habe, den Schaden z.B. durch vorherigen Abschluss eines Miet- oder Kaufvertrages für das Grundstück im Chemiepark B. abzuwenden, greife bereits deshalb nicht, weil die Klägerin nicht den Schaden aus dem Verlust des Grundstücks geltend mache, sondern den Schaden aus der Nichterteilung der Genehmigung. Sofern der Beklagte darüber hinaus die Voraussetzungen für das Bestehen eines Amtshaftungsanspruches in Frage stelle, führe dies jedenfalls nicht zur offensichtlichen Aussichtslosigkeit einer entsprechenden Klage.
Die Fortsetzungsfeststellungsklage sei jedoch nicht begründet. Die Klägerin habe im Zeitpunkt des Eintrittes des erledigenden Ereignisses, d.h. spätestens mit der Aufkündigung der Reservierung des Grundstückes im Chemiepark B. am 9. November 2017, keinen Anspruch auf Erteilung der begehrten Genehmigung nach § 7 StrlSchV gehabt, da die insoweit maßgeblichen Voraussetzungen des § 9 StrlSchV nicht vorgelegen hätten.
Soweit der Beklagte in seinem Anhörungsschreiben vom 26. Juli 2017 entgegenstehende überwiegende Interessen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 9 StrlSchV angeführt habe, weil er sich nicht in der Lage gesehen habe, die Aufsicht über die Anlage der Klägerin fachgerecht durchzuführen, und ferner auf drohende politische Proteste verwiesen habe, wende die Klägerin allerdings zutreffend ein, dass diese Bedenken keine überwiegenden öffentlichen Interessen im Sinne dieser Vorschrift begründen könnten. Eine möglicherweise nicht ausreichende personelle und sachliche Ausstattung des Beklagten zur Erfüllung der ihm mit § 6 der Zuständigkeitsverordnung für das Atom- und Strahlenschutzrecht (At-ZustVO) vom 27. August 2002 übertragenen Zuständigkeit für bestimmte Genehmigungen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen liege im Verantwortungsbereich der zuständigen Behörde und sei von dieser sicherzustellen. Auch die Möglichkeit von Protesten an sich könne der Klägerin bei einem Bestehen der Anspruchsvoraussetzungen nicht entgegengehalten werden. Nicht zu überzeugen vermöge auch der Vortrag des Beklagten, es fehle an der Genehmigungsvoraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 8 StrlSchV, weil die Klägerin zum maßgeblichen Zeitpunkt keine, ihr die Abwehr von Störmaßnahmen oder sonstigen Einwirkungen Dritter berechtigende rechtliche Verfügungsgewalt über das Grundstück in Form eines dinglichen Rechts oder eines Miet- bzw. Pachtvertrages gehabt habe, sondern lediglich eine Reservierung. Bis zur Beendigung der Reservierung des Grundstückes durch den Chemiepark B. hätten keinerlei Anhaltspunkte dafür bestanden, dass der beabsichtigte Grundstückskauf nicht realisierbar sei. Vor diesem Hintergrund hätte eine Genehmigung auch ohne weiteres mit der Bedingung verbunden werden können, dass die Klägerin sich die rechtliche Verfügungsgewalt über das Grundstück zu verschaffen habe.
Allerdings habe der Genehmigungsfähigkeit der beantragten strahlenschutzrechtlichen Genehmigung im Zeitpunkt des Eintrittes des erledigenden Ereignisses der Umstand entgegengestanden, dass (jedenfalls noch) begründete Zweifel an der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit der Klägerin im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV bestanden hätten. Auch der Nachweis der erforderlichen Vorsorge für die Erfüllung möglicher gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV sei nicht erbracht gewesen.
Bei der Überprüfung der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit gehe es um die Frage, ob der Antragsteller über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, um das Unternehmen ordnungsgemäß zu betreiben. Dazu gehöre es auch, dass das Unternehmen wirtschaftlich in der Lage sei, die aus der Genehmigung und den gesetzlichen Vorschriften resultierenden Verpflichtungen langfristig zu erfüllen. Dabei seien auch die wirtschaftlichen Risiken des Unternehmens zu betrachten. Die Prüfung diene nicht dazu, die wirtschaftlichen Verhältnisse in allen Einzelheiten zu überprüfen und zu bestätigen. Maßgeblich sei vielmehr, ob im Einzelfall Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die wirtschaftliche Zuverlässigkeit des Antragstellers ergeben.
Ausweislich der im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses vorliegenden Unterlagen hätten zwar keine Anhaltspunkte vorgelegen, die grundsätzliche Bedenken an der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit der Klägerin begründen könnten. Allerdings habe die Klägerin zum damaligen Zeitpunkt über eine vergleichsweise schwache Bonität verfügt. So habe sie zwar ausweislich des Jahresabschlusses 2016 in diesem Jahr erstmals einen Jahresüberschuss in Höhe von 285.234,58 € erwirtschaftet, während im Jahr 2015 wegen erforderlicher Rückstellungen insoweit noch ein Fehlbetrag in Höhe von 4.265.622,33 € zu verzeichnen gewesen sei. Allerdings heiße es im Prognosebericht des Jahresabschlussberichtes 2016 auch, dass der Geschäftsverlauf der klägerischen Gesellschaft aufgrund der projektbezogen angebotenen Dienstleistungen hohen Schwankungen unterliege. Für das Jahr 2017 sei mit einem etwas höheren Umsatz als im Vorjahr gerechnet worden. Gleichwohl sei aufgrund einer deutlich geringeren Gewinnabführung der EZN an die Klägerin im Jahr 2017 damit zu rechnen, dass die Klägerin höchstwahrscheinlich einen Fehlbetrag ausweisen werde. Vor diesem Hintergrund hätten zum Zeitpunkt des Eintrittes des erledigenden Ereignisses jedenfalls Bedenken gegen die wirtschaftliche Zuverlässigkeit der Klägerin bestanden.
Es könne offenbleiben, ob diese Bedenken mit der Patronatserklärung der EZN vom 11. Juli 2017 zur Absicherung künftiger Verpflichtungen der Klägerin im Zusammenhang mit dem Betrieb des Lagers in B-Stadt als ausgeräumt angesehen werden könnten. Denn diese Erklärung sei dem Gericht erst mit Schreiben vom 13. Dezember 2017 übermittelt worden. Sie habe der Kammer im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses nicht vorgelegen, so dass auch unter Berücksichtigung dieser Erklärung die Genehmigungsvoraussetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV zu diesem Zeitpunkt nicht vorgelegen habe. Insofern handele es sich auch nicht um einen Fall der Spruchreife, die ggf. auch nachträglich durch das Gericht im Rahmen der Fortsetzungsfeststellungsklage herzustellen wäre. Der Beklagte habe bereits mit Schreiben vom 27. Oktober 2016 angefragt, ob die Bereitschaft der Klägerin bestünde, für den Insolvenzfall eine Sicherheit nachzuweisen, um die gegebenenfalls erforderliche Rückführung des Lagergutes/Auflösung des Lagers zu gewährleisten. Die Klägerin habe daraufhin erklärt, dass sich die von ihr ermittelten Kosten für eine mögliche Rückführung auf ca. 50.000 € beliefen. Hierfür sei sie bereit, eine entsprechende Garantie für ihren Insolvenzfall beizubringen. Eine Patronatserklärung habe die Klägerin jedoch bis zu dem genannten Zeitpunkt nicht vorgelegt. Insoweit handele es sich nicht um Unterlagen, die das Gericht im Wege ergänzender Ermittlungen beiziehen müsse. Vielmehr sei im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses davon auszugehen gewesen, dass die angeforderte Patronatserklärung nicht vorgelegt worden sei bzw. habe vorgelegt werden können.
Ohne Erfolg wende die Klägerin schließlich ein, dass etwaigen Bedenken gegen ihre wirtschaftliche Zuverlässigkeit auch in Form von Bedingungen und Auflagen im Rahmen der Genehmigung hätte begegnet werden können. Die Vorschrift des § 36 Abs. 1 VwVfG könne nicht als allgemeine Ermächtigung der Behörden angesehen werden, nach Ermessen von der Erfüllung oder genauerer Prüfung zwingender Genehmigungsvoraussetzungen usw. abzusehen und sich stattdessen mit Nebenbedingungen zufrieden zu geben, die sicherstellen, dass in Zukunft diese Voraussetzungen erfüllt werden. Insbesondere dürfe die Behörde wesentliche Voraussetzungen des infrage stehenden Verwaltungsakts nicht auf Nebenbestimmungen „abschieben“ und damit letztlich offenlassen. Um eine solche wesentliche Voraussetzung handele es sich auch bei der Frage der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV.
Darüber hinaus sei auch der Nachweis der erforderlichen Vorsorge für die Erfüllung möglicher Schadenersatzverpflichtungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV im Zeitpunkt des Eintritts des erledigenden Ereignisses nicht erbracht gewesen. Die von der Klägerin angebotene Sicherheit in Höhe von 50.000,00 € würde nicht ansatzweise ausreichen, um im Insolvenzfall auf das Land Sachsen-Anhalt zukommende Entsorgungskosten abzusichern. Die Kammer lege insoweit die mit Schreiben vom 25. Mai 2016 vorgenommene Schätzung des Landesamtes für Umweltschutz zugrunde, der die Klägerin bislang nicht substantiiert entgegengetreten sei. Danach lägen die möglicherweise anfallenden Entsorgungskosten mit bis zu 10 Mio. € bei 10.000 zu entsorgenden Fässern weitaus höher als die von der Klägerin prognostizierten Kosten. Das Landesamt für Umweltschutz habe im Schreiben vom 25. Mai 2016 ausgeführt, es erscheine der Aspekt problematisch, dass die Klägerin nicht Eigentümerin der Reststoffe sei, die Entsorgungsverantwortung also der EZN obliege, die aber im Insolvenzfall noch eine Reihe weiterer radioaktiver Stoffe außerhalb Sachsen-Anhalts zu entsorgen hätte. Somit könne der Fall eintreten, dass dann die eventuell zur Verfügung stehenden Mittel aus der Insolvenzmasse und der Deckungsvorsorge anderweitig verwendet werden. Deshalb sei es notwendig, dass im Insolvenzfall speziell für den Standort B-Stadt eine ausreichend hohe Summe zur Begleichung der dann entstehenden Kosten zur Verfügung stehe. Eine solche Sicherung habe im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses nicht vorgelegen. Sie könne insbesondere nicht mit der Vorlage der Patronatserklärung der EZN durch die Klägerin als erbracht angesehen werden.
Die vom Senat zugelassene Berufung hat die Klägerin wie folgt begründet:
Zum Sachverhalt sei klarzustellen, dass in dem von ihr geplanten Lager, für das sie beim Beklagten eine Umgangsgenehmigung beantragt habe, ausschließlich radioaktive Reststoffe Dritter gelagert werden sollten. Im Wesentlichen habe das Lager als Ersatzlagerstätte für das Lager der EZN in L-Stadt (Niedersachsen) dienen sollen. Das Eigentum an diesen Stoffen habe also nicht auf sie, die Klägerin, übergehen, sondern bei diesen Dritten verbleiben sollen. Kosten für eine etwaige Entsorgung im Insolvenzfall wären also von vornherein nur bezüglich des Betriebs des Lagers bzw. für die Rückführung der Rückstände zu den Eigentümern entstanden. Diese Eigentümer (das Land Niedersachsen oder die EZN) wären für die Entsorgung verantwortlich und Kostenträger gewesen. Die Kosten des Betriebs dieses neuen Lagers wären nicht mit einem relevanten wirtschaftlichen Risiko verbunden gewesen. Sie hätten sich auf die Energie- und Überwachungskosten beschränkt, soweit das Lager weiterbetrieben worden wäre. Es hätten sich nach der Betriebskostenaufstellung lediglich 135.000 € Kosten für den Lagerbetrieb im Jahr ergeben. Angesichts der erheblichen Liquidität der Klägerin Ende 2016 in Höhe von ca. 1,093 Mio. € Finanzmitteln bei Kreditinstituten, die sich aus den dem Verwaltungsgericht vorgelegten Bilanzen ergeben hätten, könne von einem wirtschaftlichen Risiko oder gar einer Unzuverlässigkeit ersichtlich nicht einmal im Ansatz ausgegangen werden. Alternativ bei einer sofortigen Räumung des Lagers wären Kosten des Rücktransports zu den Eigentümern oder zur Sammelstelle in Höhe von 50.000 € angefallen, die ebenfalls die Eigentümer der Stoffe zu tragen gehabt hätten. Im Falle der Erteilung der Genehmigung zugunsten der Klägerin in B-Stadt hätte diese die Nutzung des bisherigen Standortes L-Stadt (wo die Klägerin den Betrieb führe, die EZN aber die Genehmigung halte) als Bereitstellungslager aufgegeben und sämtliche dieser Kategorie zuzuordnenden und im Eigentum der EZN stehenden Fässer nach B-Stadt oder A-Stadt verbracht. Die dadurch in L-Stadt freigewordene Fläche von 1.223 m2 wäre an Dritte vermietet worden. Das Lager L-Stadt werde zu zwei unterschiedlichen Zwecken verwendet: Einerseits erfolge hier die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen, die zur Einlagerung in das zu schaffende Endlager „K.“ vorgesehen seien und im Eigentum des Landes Niedersachsen stünden. Zum anderen werde das Lager als Bereitstellungslager für radioaktive Reststoffe verwendet, d. h. Materialien, die nur geringe Mengen radioaktiver Stoffe enthielten und entweder direkt oder nach Weiterverarbeitung zum überwiegenden Teil wieder in den normalen Abfallkreislauf überführt werden könnten. Diese stünden im Eigentum der EZN. Die beiden genannten Kategorien unterschieden sich dabei sowohl hinsichtlich ihrer Aktivität als auch hinsichtlich ihrer Lagerdauer erheblich. Während die radioaktiven Abfälle des Landes Niedersachsen für mehrere Jahrzehnte im Lager verblieben und ein erhebliches Radioaktivitätsinventar besäßen, seien die Reststoffe der EZN nur wenige Monate bis Jahre im Bereitstellungslager und wiesen eine Aktivität auf, die im Mittel um den Faktor einhundert kleiner sei als die Aktivität der zwischengelagerten radioaktiven Abfälle. Eine Zwischenlagerung im Sinne des Strahlenschutzrechts erfolge dabei in L-Stadt ausschließlich für Abfälle, die sich in der Entsorgungsverantwortung des Landes Niedersachsen befänden. Bedingt durch die verzögerte Eröffnung des Endlagers „K.“ für schwach- und mittelaktive radioaktive Abfälle sei die Lagerdauer der radioaktiven Abfälle deutlich länger als zum Zeitpunkt der Einlagerung prognostiziert. Mit dieser unvorhergesehen langen Lagerdauer komme es jedoch nun, nach einigen Jahrzehnten, zu Korrosionsproblemen. Dies betreffe insbesondere die im Auftrag des Landes Niedersachsen gelagerten 1.484 Gebinde aus den siebziger Jahren. Das Land Niedersachsen sei aus diesem Grunde ausdrücklich und stark daran interessiert gewesen, diese Gebinde besser zugänglich zu lagern. Diese Fässer hätten auf Wunsch des Landes als Mieter mit Abstand auf einer größeren Fläche aufgestellt werden sollen, um auf diese Weise auf auftretende Probleme besser reagieren zu können. Der primär verfolgte Ansatz zur Umsetzung dieser Zielstellung des Landes Niedersachsen sei der Neubau einer weiteren Lagerhalle auf dem Gelände des Lagers in L-Stadt gewesen. Das Neubauvorhaben sei jedoch an der mangelnden Zustimmung der Eigentümerin des Grundstücks in L-Stadt gescheitert. Damit habe sich der Bedarf des Landes nach zusätzlicher Lagerfläche aber keinesfalls erledigt. Vielmehr hätten sich seitdem die Parteien in Gesprächen über eine alternative Lösung zur Schaffung zusätzlicher Lagerfläche für das Land Niedersachsen durch die Klägerin befunden. Eine großzügigere Lagerung der genannten 1.484 Gebinde des Landes Niedersachsen habe sich auch auf eine andere Weise erreichen lassen können, nämlich durch die vollständige Auslagerung des Fasskontingents der EZN aus dem Lager L-Stadt mit seinen deutlich geringeren Aktivitäten und Lagerdauern (und damit auch geringeren Anforderungen an einen anderen Standort) würde ausreichend Fläche frei, um die Fässer des Landes in L-Stadt mit ausreichendem Abstand zueinander lagern zu können. In diesem Szenario würde das Lager in L-Stadt ausschließlich als Zwischenlager des Landes Niedersachsen genutzt. Genau dieses Ziel habe die Klägerin (und mittelbar das Land Niedersachsen) also mit dem Standort B-Stadt verfolgt. Im Falle einer Insolvenz oder sonst erforderlich werdender Sicherheiten wirtschaftlicher Liquidität der Klägerin wäre also zu berücksichtigen, dass hier die von der Klägerin zugesagten Sicherungen für die Rückführungskosten zur EZN ausreichend wären, um ein Entsorgungsrisiko finanziell abzusichern. Die Kosten einer Rückführung würden auf Grundlage der Kosten für einen Transport von bis zu 10.000 Fässern (so der Beklagte und das Verwaltungsgericht) von B-Stadt nach A-Stadt kalkuliert. Die einfache Entfernung zwischen beiden Standorten betrage 192 km und somit 384 km. Die typischen Transportkosten für LKW Transporte lägen bei 1 € pro km. Mit einem Transport könnten 144 Fässer gefahren wären, es wären also max. 69 Transporte erforderlich. Damit ergäben sich Transportkosten in Höhe von 26.496 €. Zur Berücksichtigung von Be- und Entladung sei dieser Wert großzügig aufgerundet und mit 50.000 € annähernd verdoppelt worden. Damit treffe bereits der faktische Ausgangspunkt des Verwaltungsgerichts nicht zu, wenn es bei der Insolvenzabsicherung Bezug zu den Rückführungskosten nehme. Weitere Kostenanforderungen habe der Beklagte aber gegenüber der Klägerin nie angebracht, sondern offenbar allein intern kalkuliert. Alternativ könnten die Betriebskosten vor Ort für einen Übergangszeitraum berücksichtigt werden. Kosten in Höhe von 10 Mio. € wären aber aus unterschiedlichen Gründen niemals relevant geworden. Weder ein wirkliches wirtschaftliches „Risiko“ noch die Tragfähigkeit der Berechnungen des Beklagten oder auch die wirtschaftliche Lage der Klägerin habe das Verwaltungsgericht aufgeklärt und tragfähig ermittelt.
Zwischenzeitlich habe das Landgericht Braunschweig mit Grundurteil vom 25. Februar 2021 (7 O 7269/19) festgestellt, dass der Klägerin dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch in dieser Sache zustehe.
Zuzustimmen sei dem Verwaltungsgericht darin, dass (jedenfalls) ein Präjudizinteresse vorgelegen habe. Eine kurze Zeit nach Klageerhebung eintretende Erledigung führe nicht zum Wegfall dieses Interesses. Gegen das Fortbestehen dieses Interesses könne auch nicht eingewandt werden, ein Kollegialgericht habe eine Amtspflichtverletzung nicht erkannt, was zur Unzulässigkeit einer Amtshaftungsklage und dem Wegfall des Präjudizinteresse führe. Zum einen habe das Verwaltungsgericht das Verhalten der Amtswalter in keiner Weise für rechtmäßig erklärt. Es habe sich nicht mit der Frage befasst, ob die Genehmigung hätte erteilt werden müssen oder nicht, sondern nur mit der Frage, ob zum Zeitpunkt der Erledigung die Genehmigungsvoraussetzungen vorgelegen haben oder nicht. Ferner habe es sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Genehmigungsvoraussetzungen von der Klägerin hätten erfüllt werden können oder nicht. Unabhängig davon werfe die Klägerin den Amtswaltern des Beklagten als Amtspflichtverletzung im Rahmen der Amtshaftungsklage nicht in erster Linie die Verweigerung der Genehmigung, sondern die Verzögerung des Genehmigungsverfahrens vor. Auf diese Verzögerung beziehe sich folgerichtig auch das notwendige Verschulden. Zu der Frage der Verzögerung habe sich allerdings das Verwaltungsgericht überhaupt nicht geäußert, so dass in dieser Hinsicht auch das Verschulden nicht entfallen könne. Dass die Kollegialgerichtsrichtlinie auf Fälle der verzögerten Bearbeitung von Sachverhalten schon gar keine Anwendung finden könne, ergebe sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Die Frage nach der Verpflichtung zur Erteilung der Genehmigung im Zeitpunkt der Erledigung sei in einem Amtshaftungsverfahren lediglich eine Kausalitätsfrage. Es stelle sich im Amtshaftungsprozess im Rahmen der Kausalität die Frage, ob das beklagte Land einwenden könne, bei einer sachgerecht nicht verzögerten Bearbeitung des Genehmigungsantrages wäre durch die zuständige Behörde eine Ablehnung erteilt worden und diese Ablehnung wäre rechtmäßig gewesen, so dass der Schaden bei der Klägerin nicht oder jedenfalls nicht in vollem Umfang eingetreten wäre. Hierbei gehe es nicht um Fragen des Verschuldens, sondern nur um objektivrechtliche Fragen hinsichtlich der Genehmigungserteilung. Die Maßgaben der Kollegialgerichtsrichtlinie griffen im vorliegenden Fall ohnehin nicht, weil sie an den Umstand anknüpften, dass das Kollegialgericht den in Rede stehenden Sachverhalt zutreffend und umfassend erkannt und ermittelt habe. Das Kollegialgericht dürfe nicht von falschen oder von unzutreffend oder unvollständig ermittelten Tatsachen ausgegangen sein. Die Kollegialgerichtsrichtlinie greife nicht ein, wenn die Annahme des Kollegialgerichts, die Amtshandlung sei rechtmäßig gewesen, auf einer unzureichenden tatsächlichen oder rechtlichen Beurteilungsgrundlage beruhe. Das sei etwa dann der Fall, wenn das Gericht infolge unzureichender Tatsachenfeststellung von einem anderen Sachverhalt als dem, vor den der Beamte gestellt war, ausgegangen sei, das Gericht den festgestellten Sachverhalt nicht sorgfältig und erschöpfend gewürdigt habe, etwa für die Beurteilung des Falles wesentliche Gesichtspunkte unberücksichtigt gelassen habe, das Gericht sich bereits in seinem Ausgangspunkt von einer rechtlich oder sachlich verfehlten Betrachtungsweise nicht habe freimachen können oder wenn es eine gesetzliche Bestimmung „handgreiflich falsch“ ausgelegt habe. Dies alles treffe auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu. Es sei offensichtlich, dass es an zahlreichen Stellen versäumt habe, weitere Unterlagen anzufordern und im Rahmen der Amtsermittlung weitere Aufklärung zu leisten. Dies gelte vor allem zu etwaigen Entsorgungskosten, Betriebskosten und zu der wirtschaftlichen Lage der Klägerin. Die Auffassung des Verwaltungsgerichts sei im Übrigen objektiv unvertretbar, die Urteilsbegründung sei außerdem in sich unschlüssig und widersprüchlich. Auch das Landgericht Braunschweig sei in dem zitierten Urteil vom 21. Februar 2021 zutreffend zu der Auffassung gelangt, dass sich das beklagte Land Sachsen-Anhalt für den Beklagten nicht auf die Kollegialitätsrichtlinie berufen könne: Es sei zu beachten, dass ein besonders strenger Maßstab für oberste Landesbehörden im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren gelte, so dass auf dieser Ebene eine besonders gründliche Prüfung möglich und zu verlangen sei. Daraus folge, dass die allgemeine Richtlinie, wonach das Verschulden eines Amtsträgers grundsätzlich dann entfalle, wenn ein rechtskundigeres Kollegialgericht sein Verhalten als rechtmäßig beurteile, nicht anzuwenden sei. Auch wenn vorliegend mit dem Beklagten keine „oberste“ Landesbehörde, sondern nur eine „obere“, der „obersten“ Landesbehörde direkt untergeordnete Landesbehörde gehandelt habe, sei auch von dieser ein derartiger Prüfungsmaßstab zu erwarten.
Die Klage sei auch begründet. Nach der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts blieben zwei Argumente, die gegen die Pflicht zur Erteilung der Genehmigung sprächen. Dabei gehe es um die Frage nach der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit der Klägerin und um den Nachweis der Deckungsvorsorge. Alle übrigen Argumente des Beklagten hätten sowohl das Verwaltungsgericht als auch mittlerweile das Landgericht Braunschweig verworfen.
Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts und des Beklagten sei das Kriterium einer wirtschaftlichen Zuverlässigkeit bereits kein Tatbestandsmerkmal der Genehmigungserteilung nach § 9 Abs. 1 StrlSchV 2001 gewesen. Danach sei die Genehmigung zu erteilen, wenn keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführungsberechtigten ergeben, und, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der Antragsteller die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt. Damit komme es grundsätzlich auf die Zuverlässigkeit des Antragstellers an, der aber in jedem Fall eine natürliche Person sein müsse. Dies ergebe sich daraus, dass im Zweifel der gesetzliche Vertreter oder die zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigte Person zuverlässig sein müsse. Da die Klägerin selbst eine GmbH sei, müsste insoweit der Geschäftsführer die erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrISchV 2001 besitzen. Der Beklagte habe im Rahmen seiner Prüfung aber nicht auf den Geschäftsführer der Klägerin abgestellt, sondern vielmehr auf diese selbst als juristische Person und damit auf die falsche Person. Auch aus der Begründung der im Jahr 2001 neu gefassten StrISchV, mit welcher die Richtlinien 96/29/EURATOM und 97/43/EURATOM in deutsches Recht umgesetzt worden seien, lasse sich keine erforderliche (wirtschaftliche) Zuverlässigkeit einer juristischen Person entnehmen. Vielmehr sei entscheidend, ob die natürliche Person, die die juristische Person nach außen hin vertrete, die Gewähr dafür biete, die Einhaltung der Vorschriften zum Umgang mit radioaktiven Stoffen zu gewährleisten. Dasselbe Ergebnis folge auch aus einer historischen Auslegung: Wie in der StrISchV 2001 habe es auch in der StrISchV 1976 und StrlSchV 1989 Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang gegeben. Die Formulierung im jeweiligen § 6 Abs. 1 Nr. 1 sei wortgleich gewesen mit der Formulierung in § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV 2001. Der unbestimmte Begriff der Zuverlässigkeit sei ebenfalls dahingehend zu verstehen gewesen, dass bei den genannten Personen der Umgang mit radioaktiven Stoffen im Einklang mit den Strahlenschutzvorschriften gewährleistet sei. Die Unzuverlässigkeit müsse folglich gerade im Hinblick auf die Beachtung der Strahlenschutzvorschriften bestehen. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn der Betreffende bereits gegen Strahlenschutzvorschriften verstoßen habe. Dagegen lasse sich die Zuverlässigkeit nicht ohne weiteres verneinen, wenn jemand gegen Vorschriften verstoßen habe, die in keiner Beziehung zum Strahlenschutz stünden, wie zum Beispiel bei einer Steuerhinterziehung. Zwar könnten auch mehrere Vorstrafen etwa wegen Steuerhinterziehung u. U. ein Indiz für eine Gesetzen gegenüber negative Einstellung sein, die den Betreffenden auch in Bezug auf die Einhaltung von Strahlenschutzvorschriften als nicht zuverlässig erscheinen lasse. Hierbei sei aber ebenfalls auf eine natürliche Person im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung abzustellen gewesen.
Auch der Umstand, dass seit der Reform des Strahlenschutzrechts eine Sicherheitsleistung gefordert werden könne, belege, dass zuvor die Aspekte der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht Teil der Genehmigungsanforderungen gewesen sein könne. Andernfalls wäre dieser Reformschritt überflüssig gewesen. Die Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen ergäbe sich für die Klägerin heute aus § 13 StrISchG. Dort seien die tatbestandlichen Merkmale aufgeführt, die zuvor in § 9 StrISchV 2001 geregelt gewesen seien. Auch hier finde sich weiterhin die Forderung der Zuverlässigkeit des Antragstellers, was im Genehmigungs- und Gewerberecht typischerweise der Fall sei. Entsprechend fänden sich Regelungen im Gewerberecht, im Immissionsschutzrecht, im Abfallrecht, im Deponierecht, im Bergrecht usw. Es finde sich nunmehr in § 13 Abs. 7 StrISchG aber auch die ausdrückliche Möglichkeit, dass die zuständige Behörde von dem Inhaber eine Genehmigung nach § 12 StrISchG eine Sicherheitsleistung für die Beseitigung für die aus dem Umgang stammenden radioaktiven Stoffe verlangen könne. Dies solle nicht gelten, wenn Genehmigungsinhaber der Bund, ein oder mehrere Länder oder ein Dritter sei, der vom Bund, einem oder mehreren Ländern oder vom Bund gemeinsam mit einem oder mehreren Ländern vollständig finanziert werde. Die Möglichkeit der Forderung einer Sicherheitsleistung zur Insolvenzabsicherung bzw. zur Absicherung von Nachsorgeverpflichtungen ergebe sich nunmehr erstmals und ausdrücklich über § 13 Abs. 7 StrISchG. Diese Vorschrift sei nicht von Beginn an im Gesetzgebungsverfahren zur Überarbeitung des Strahlenschutzrechts vorgesehen gewesen, sondern erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens eingeführt worden. Zur Begründung werde in den Gesetzgebungsunterlagen ausgeführt: Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen bestehe im Falle der Insolvenz des Genehmigungsinhabers das Risiko, dass radioaktive Stoffe (radioaktive Abfälle) zurückgelassen werden. Die vorgesehene Regelung sei dringend angezeigt, um unter anderem die gesetzlich bestehende Verpflichtung zur kostenpflichtigen Abgabe von radioaktiven Abfällen an eine Landessammelstelle sicherzustellen. Ohne entsprechende Absicherung fielen bei einer Insolvenz die zum Teil erheblichen Kosten der Übernahme in die Landessammelstelle sowie ggf. Kosten für Verpackung, Transport, Dekontamination, Messungen etc. den öffentlichen Haushalten zur Last (dem betroffenen Land bzw. dem Bund im Rahmen der Zweckausgabenerstattung). Entsprechende Fälle seien in der Vergangenheit bereits eingetreten und mündeten in Rechtsstreitigkeiten zwischen Land und Bund hinsichtlich der Kostentragung. Die vorgesehene Regelung sei im Bereich des Strahlenschutzes ebenso angezeigt wie im Bereich konventioneller Abfälle. Vergleichbare Regelungen für konventionelle Abfälle bzw. Deponien existierten in § 36 Absatz 3 KrWG und in § 17 Absatz 4a BImSchG. Die Regelung solle nur für Genehmigungsinhaber gelten, die mit überdurchschnittlichen Mengen von radioaktiven Stoffen umgehen wie zum Beispiel Firmen, die radioaktive Stoffe konditionierten oder in größerem Umfang lagerten, nicht hingegen für Krankenhäuser; Labore etc., soweit der Umgang eine bestimmte Aktivitätsgrenze nicht überschreite. Das Nähere dazu sei in einer Rechtsverordnung festzulegen. Vom Anwendungsbereich der Norm sollten Zwischenlager für sonstige radioaktive Abfälle ausgenommen werden, deren Genehmigungen nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung des Übergangs der Finanzierungs- und Handlungspflichten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle der Betreiber von Kernkraftwerken (Entsorgungsübergangsgesetz) auf einen vom Bund mit der Wahrnehmung der Zwischenlagerung beauftragten Dritten übertragen worden seien. Hier sei eine Sicherheitsleistung nicht erforderlich, da sich die radioaktiven Abfälle bereits in der Verantwortung des Bundes befänden und eine Abgabe der Stoffe an ein Bundesendlager sichergestellt sei. Durch die Ausgestaltung als Ermessensvorschrift sei sichergestellt, dass Behörden von der Forderung einer Sicherheitsleistung absehen können, wenn eine solche nicht angemessen sei. Dies betreffe zum Beispiel diejenigen Fälle, in denen Dritte als Genehmigungsinhaber die Landessammelstelle oder eine andere Einrichtung für den Bund oder ein Land betreiben. In diesen Konstellationen befänden sich die Abfälle bereits in der Verantwortung der öffentlichen Hand und es bestehe kein Bedarf, die kostenpflichtige Abgabe an die Landessammelstelle u. a. finanziell abzusichern. Dies gelte auch, wenn die Einrichtung vollumfänglich von der öffentlichen Hand (z.B. EU, Bund und Land) zuwendungsfinanziert sei. Aus der Gesetzgebungshistorie folge also, dass der Gesetzgeber die Notwendigkeit gesehen habe, im neuen Strahlenschutzrecht eine dezidierte Befugnis zur Nachsorgeverpflichtung vorzusehen. Man habe sich nach der Gesetzesbegründung an den Vorgaben für konventionelle Abfälle und Deponien nach den §§ 36 Abs. 3 KrWG und § 17 Abs. 4 BImSchG orientieren wollen. Ausdrücklich ausgenommen werden sollten diejenigen Betriebe, die als Dritte für öffentliche Körperschaften Lagerflächen zur Verfügung stellen, was insbesondere am Unternehmensstandort der EZN in L-Stadt der Fall sei, wo zu einem erheblichen Anteil Abfälle des Landes Niedersachen gelagert würden. Wenn also nach dem neuen Strahlenschutzrecht ausdrücklich eine Ermächtigungsgrundlage habe geschaffen werden müssen, welche die Anforderung einer Sicherheitsleistung für die Nachsorgeverpflichtung zulasse, könne daraus der Rückschluss gezogen werden, dass die Frage der Nachsorge und insofern der Absicherung von wirtschaftlichen Fragen gerade nicht Bestandteil der auch heute noch aufzufindenden Vorschrift zur allgemeinen Zuverlässigkeit des Antragstellers gewesen sei.
Der Klägerin habe auch nicht entgegengehalten werden können, dass sie allein aufgrund eines einmaligen bilanziellen Fehlbetrages wirtschaftlich unzuverlässig geworden oder gewesen sei. Die Auffassung des Verwaltungsgerichts lasse sich auch nicht mit diesen Erwägungen im Ergebnis halten. Andernfalls müssten täglich hunderten großen und mittleren Unternehmen die Gewerbeerlaubnisse entzogen werden. Der allgemeine gewerberechtliche Begriff der wirtschaftlichen (Un-)Zuverlässigkeit sei mit Zurückhaltung zu gebrauchen. Es gälten strenge Maßstäbe. Die Annahme der Unzuverlässigkeit sei nur in äußersten Grenzfällen berechtigt und umfasse im Wesentlichen Fälle, in denen ein Gewerbetreibender in gänzlich ungeordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe. Das bedeute, dass auch eine „schwache“ Bonität der Klägerin allein keine wirtschaftliche Unzuverlässigkeit begründen würde, sondern erst strukturelle und massive Schwächen dauerhafter Zahlungsunfähigkeit usw. dies rechtfertigen könnten. In diesem Fall wäre ihr im Übrigen die Gewerbeerlaubnis zu entziehen. Daraus folge, dass sich der Begriff der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit auf die Zahlungsunfähigkeit bzgl. des avisierten Betriebs beziehe. Dieser sei aber gesichert, was selbst vom Beklagten nicht bestritten werde. Wolle man aber dennoch eine Absicherung zu Gunsten der Allgemeinheit zulassen, so müsste diese, da es um konkrete Kosten der Entsorgung und Insolvenzabsicherung gehe, über eine Sicherheitsleistung oder sonstige Absicherung als Nebenbestimmung der Klägerin abverlangt werden. Als milderes Mittel hätte dies vor einer Versagung der Genehmigung in Betracht gezogen werden müssen. Auch hierzu habe das Landgericht Braunschweig überzeugende Ausführungen gemacht. Im Übrigen könne von einer wirtschaftlichen Unzuverlässigkeit nicht ausgegangen werden, weil das Verwaltungsgericht etwaige Kosten einer Entsorgung gar nicht richtig ermittelt habe. Unterstelle man, dass die Absicherung des Insolvenzrisikos der Klägerin ein Belang wäre, der über die Voraussetzung des § 9 Abs. 1 StrISchV 2001 habe gefordert werden dürfen, so wäre dies zunächst vorrangig über eine Nebenbestimmung von der Beklagten zu verfügen und schließlich hinreichend bestimmt nach Form, Höhe und Grund darzulegen gewesen. Zudem würdige das Verwaltungsgericht die rechtliche Beziehung und die wirtschaftliche Potenz der Klägerin und ihres Tochterunternehmens, der EZN, nicht korrekt. Es konstruiere ein wirtschaftliches Risiko, welches in dieser Form nicht bestehe und unterstelle weiterhin fehlerhaft, dass selbst im Insolvenzfall mit einem Entsorgungsrisiko in Höhe von 10 Mio. € die öffentliche Hand für die Kosten der Entsorgung aufkommen müsste. Außerdem sei eine Absicherung auch über die EZN nicht möglich, weil diese im Insolvenzfall eigene Entsorgungspflichten habe, für die sie aufzukommen hätte. Das Verwaltungsgericht lege interne Berechnungen des Beklagten vom 25. Mai 2016 zugrunde und behaupte Kosten in Höhe von 10 Mio. €. Das sei nicht nachvollziehbar: Erstens hätten die lagernden Fässer auch nach Auffassung des Beklagten und des Verwaltungsgerichts im Eigentum der EZN gestanden, so dass dieses Unternehmen im Falle der Insolvenz der Klägerin entsorgungspflichtig geworden wäre und bei diesem Unternehmen die Kosten der Entsorgung angefallen wären. Zweitens seien die Grundlagen der Kalkulation unzutreffend und widersprächen den Berechnungen und Angaben des Beklagten im (späteren) Anhörungsschreiben vom 27. Juni 2017. Hierin werde von Kosten abhängig von dem Inhalt der Fässer gesprochen und sodann von einem Multiplikator von 8.000 € bis 15.000 € pro Gebinde. In dem Schreiben vom 25. Mai 2016 gehe der Beklagte pauschal von Kosten in Höhe von 300 € pro Fass aus. Das Verwaltungsgericht habe diese Widersprüche nicht aufgeklärt. Drittens sei die Berechnung vom 25. Mai 2016 auch in der Sache nicht richtig. Schon die Transportkosten seien mit 400.000 € viel zu hoch angesetzt. Viertens habe das Verwaltungsgericht nicht hinterfragt, dass der Beklagte nach Erstellung der internen Rechnung (10 Mio. €) die Klägerin mit Schreiben vom 27. Oktober 2016 nur um Garantie für Kosten der Rückführung und nicht für die Entsorgung gebeten habe. Fünftens seien die berechneten Entsorgungskosten zu hoch angesetzt. Nach der im Berufungszulassungsverfahren vorgelegten Kostenschätzung der EZN ergebe sich, dass die realistische Lagermenge bei 6.000 Fässern gelegen hätte, so dass sich nur Entsorgungskosten in Höhe von ca. 4 Mio. € ergeben hätten. Selbst bei einer extrem konservativen Annahme einer Lagerung von 10.000 Fässern und einer Rückführung der Fässer wären Kosten in Höhe von maximal 6,7 Mio. € entstanden. Das Verwaltungsgericht gehe zu Unrecht davon aus, dass im Falle einer Insolvenz der Klägerin die EZN mit den eigenen Entsorgungskosten für andere Standorte belastet wäre und es möglicherweise keine Finanzmittel aus der Deckungsvorsorge oder aus dem Kapital des Unternehmens übrigblieben, um die in B-Stadt zu lagernden Stoffe ordnungsgemäß zu entsorgen. Es übersehe, dass die Verpflichtungen der EZN aus dem Betrieb eigener Lager weitgehend identisch sei mit dem Entsorgungsrisiko der Klägerin in B-Stadt, da das Außenlager der EZN in L-Stadt weitgehend aufgelöst werden solle. Der Standort in B-Stadt habe in wesentlichen Bereichen an diese Stelle treten sollen. Wie auch das Verwaltungsgericht Halle in seiner Entscheidung ausdrücklich annehme, sollten die bei der Klägerin in B-Stadt lagernden Gebinde im Eigentum der EZN stehen, denn es sollte um Gebinde gehen, die derzeit in L-Stadt und A-Stadt lagerten. Das gegenwärtige Entsorgungsrisiko der EZN für die Standorte A-Stadt und L-Stadt umfasse also das Entsorgungsrisiko von B-Stadt bereits. Das Entsorgungsrisiko sei bilanziell in Form von Rückstellungen bei der Klägerin und der EZN bezüglich der eigenen an den bisherigen Standorten lagernden Gebinde eingestellt. Es belaufe sich insgesamt auf 14.680.727,74 Mio. € (Zeitpunkt des vollständigen Antrags). Ausgenommen seien die Gebinde, die im Eigentum des Landes Niedersachsen stünden und im Insolvenzfall wieder an das Land zurückfallen würden. In diesen knapp 14,7 Mio. € seien die in B-Stadt zu lagern beabsichtigten Gebinde bereits enthalten, so dass mit diesem Betrag das gesamte Entsorgungsrisiko beider Gesellschaften für sämtliche Gebinde an allen Standorten beschrieben sei. Aus einer Bestätigung des Wirtschaftsprüfungsgesellschaft K. ergebe sich, dass im Falle der Insolvenz ein Entsorgungsrisiko durch das bei den Gesellschaften vorhandene Vermögen in Höhe von 14,7 Mio. € abgedeckt wäre, wovon wiederum alle Risiken aller Standorte einschließlich B-Stadt umfasst seien. Das Verwaltungsgericht hätte auch berücksichtigen müssen, dass die EZN die Tochtergesellschaft der Klägerin sei und zwischen den Unternehmen ein Gewinnabführungsvertrag bestehe. Die bei der EZN erwirtschafteten Gewinne würden also an die Klägerin abgeführt. Die EZN erwirtschafte ausweislich der vorgelegten Bilanzen einen jährlichen Umsatz in Höhe von etwa 15.000.000,00 € und Erträge zwischen 2 bis 3 Mio. € jährlich. Der Wert des Unternehmens (EZN), berechnet über die sogenannte DCF-Methode, betrage heute über 38 Mio. €. Im Falle einer Insolvenz der Klägerin würde die EZN Teil der Insolvenzmasse der Klägerin werden, so dass die Klägerin das Unternehmen EZN veräußern könnte und voraussichtlich dafür einen Wert in Höhe von etwa 38 Mio. € erwirtschaften könnte. Die vom Beklagten und dem Verwaltungsgericht angeführten 10 Mio. € Entsorgungskosten zuzüglich sonstiger Entsorgungsrisiken der EZN seien daher für die Klägerin ohne Weiteres auch im Insolvenzfalle zu tragen. Ein Risiko, dass Verantwortlichkeiten der Klägerin im Insolvenzfalle nicht erfüllt werden könnten, sei daher von vorneherein nicht festzustellen. Es komme hinzu, dass im Fall der Insolvenz der Klägerin für die öffentliche Hand auch aus Rechtsgründen kein Risiko bestünde. Denn bei einer Insolvenz der Klägerin könnte und würde der Insolvenzverwalter oder die zuständige Behörde den Abfallerzeuger bzw. Eigentümer der Abfälle zur Entsorgung heranziehen. Insoweit würde zunächst einmal die EZN herangezogen werden, die – wie oben dargestellt – wirtschaftlich ohne weiteres in der Lage wäre, die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Der zuständigen Behörde stünden also über den gesamten Zeitraum des Betriebs und auch zur Zeit der Nachsorge ohnehin mit der Klägerin und der EZN zwei Unternehmen als Pflichtige zur Seite, auf die sie zurückgreifen könne. Ein Risiko, dass die öffentliche Hand die Kosten zu tragen hätte, sei nicht realistisch und vom Verwaltungsgericht auch nicht plausibel dargelegt.
Ebenso wenig überzeugten die Ausführungen des Beklagten und des Verwaltungsgerichts zu der angeblichen fehlenden Deckungsvorsorge. Der gesetzliche Tatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrISchV 2001 verlange die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung möglicher gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen. Inwiefern sich aus dem Insolvenzfall Schadensersatzverpflichtungen ergeben sollen, die auf gesetzlicher Grundlage beruhen, habe das Verwaltungsgericht nicht erörtert. Diese Deckungsvorsorge orientiere sich an den Vorgaben des Atomrechts. Es gehe dabei nicht um die Absicherung eines Insolvenzrisikos. Die Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung (AtDeckV) nehme ausdrücklich Bezug auf die Bestimmung des § 13 AtG. Dieser sei überschrieben mit „Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadenersatzverpflichtungen“. Es liege offen zu Tage, dass § 13 AtG denselben Regelungsgehalt habe wie § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrISchV 2001. Beide beträfen die Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadenersatzverpflichtungen. Umfang und Art dieser Vorsorgeleistung regle dann entweder direkt oder mittelbar für das Strahlenschutzrecht die AtDeckV. Nach dieser Verordnung sei eine Versicherungsbestätigung zum Nachweis der Deckungsvorsorge zu leisten. Auf dieser Grundlage werde von den Antragstellern der Nachweis einer Deckungsvorsorge verlangt. Dass es sich hierbei um ein einheitliches Verständnis auch des Beklagten selbst handele und insofern die tatbestandlichen Voraussetzungen vom Verwaltungsgericht verkannt würden, ergebe sich bereits aus der E-Mail des Beklagten an die Klägerin vom 30. Juli 2015, in welcher ein Mitarbeiter des Beklagten der Klägerin verschiedene Unterlagen für einen Genehmigungsantrag nach § 7 StrISchV 2001 übermittelt habe. In einer Anforderungsliste werde ein Schreiben des Versicherers als Nachweis der Deckungsvorsorge verlangt. Gleiches werde mit direktem Bezug zu § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrISchV 2001 in der Mustergenehmigung verlangt. Diesen Forderungen entsprechend habe die Klägerin einen Genehmigungsantrag vorgelegt, mit dem auch die Bestätigung der A-Versicherung zur Übernahme der Deckungsvorsorgeversicherung beigebracht worden sei. In der Anlage 11 zu dem Genehmigungsantrag finde sich das Schreiben der A-Versicherungs-AG vom 5. November 2015, in dem ausdrücklich bestätigt werde, dass für den Standort B-Stadt die erforderliche Deckungsvorsorgeversicherung bereitgestellt werde und die Deckungsvorsorge für den geplanten neuen Standort in B-Stadt im Rahmen einer eigenständigen Strahlenhaftpflichtversicherung bereitgestellt werde, sobald der Versicherungsgesellschaft die endgültigen Genehmigungsunterlagen vorliegen. Zu keinem Zeitpunkt habe es zwischen der Klägerin und dem Beklagten eine Auseinandersetzung darüber gegeben, dass diese Deckungsvorsorgebestätigung für den Nachweis der Verpflichtungen aus § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrISchV 2001 nicht genügen würde. Soweit der Beklagte die Auffassung vertrete, die Klägerin habe mit der A-Versicherung noch keinen Versicherungsvertrag geschlossen, sondern lediglich eine Zusage hierüber beigebracht, verdeutliche dies wiederum das Fehlverständnis des Beklagten bezüglich der Anforderungen des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrISchV 2001. Die konkret geforderte Höhe der Deckungsvorsorge werde erst in der Genehmigung oder durch gesonderten Bescheid ausgewiesen. Hierbei bestehe ein Ermessen der zuständigen Behörde dergestalt, dass die Versicherung bezogen auf den geforderten Betrag auch erst dann abgeschlossen werde und werden könne, wenn die Genehmigung erteilt sei. Erstens könne die Klägerin vorher noch gar nicht wissen, wie hoch die behördlicherseits geforderte Versicherungssumme sein werde. Zweitens könne es der Klägerin nicht zugemutet werden, eine Versicherung kostenpflichtig abzuschließen, wenngleich sie noch gar keine Genehmigung habe. Drittens könne eine Versicherung keine Tätigkeit versichern, wenn deren Umfang noch nicht durch Bescheid geklärt sei. Insofern könne der Beklagte auch diesbezüglich nach oder mit Genehmigungserteilung durch Nebenbestimmung anordnen, dass die Deckungsvorsorgeversicherung in geforderter Höhe abzuschließen sei, bevor der Betrieb aufgenommen werden dürfe. Auch diesen Aspekt habe das Landgericht Braunschweig so gesehen.
Die Klägerin beantragt,
das angefochtene Urteil zu ändern und festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet gewesen ist, die von ihr mit Schreiben vom 6. November 2015 beantragte Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen nach den §§ 7, 9 StrlSchV 2001 zu erteilen.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er trägt vor: Die Fortsetzungsfeststellungsklage sei bereits unzulässig.
Es fehle an einem Präjudizinteresse zur Vorbereitung eines Amtshaftungsanspruchs. Ein solcher Anspruch bestehe mangels Verschuldens offensichtlich nicht.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts Braunschweig könne sich das dort beklagte Land aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichts auf die Kollegialgerichtsrichtlinie berufen. Es könne nicht darauf Bezug genommen werden, dass die Kollegialgerichtsrichtlinie nicht gelte, wenn ein strenger Maßstab für oberste Landesbehörden im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren eingreife. Denn es gehe weder um eine atomrechtliche Genehmigung noch um ein Handeln einer obersten Landesbehörde. Bei dem Beklagten handele es sich nicht um eine „zentrale Dienststelle“ im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Kollegialitätsrichtlinie, von der anzunehmen sei, dass sie ihre Entscheidung in ruhiger Abwägung aller Gesichtspunkte und unter Benutzung allen einschlägigen Materials treffen könne. Die Entscheidung über eine strahlenschutzrechtliche Genehmigung stelle auch keine „grundsätzliche Maßnahme“ dar, sondern eine Einzelfallentscheidung. Beim Strahlenschutzrecht handele es sich um eine Materie, deren Bestimmungen den Sachbearbeitern des Beklagten nicht aus täglicher Befassung vertraut gewesen seien. Die Mitarbeiter des Beklagten verfügten im Vergleich zum Kollegialgericht bzw. zum Verwaltungsgericht Halle nicht über überlegene Beurteilungsmöglichkeiten. Bei der Bearbeitung strahlenschutzrechtlicher Anträge handele es sich beim Beklagten um ein abgelegenes Gebiet des Technikrechts. Der Antrag der Klägerin sei in der Abteilung Arbeitsschutz, Gewerbeaufsicht Ost bearbeitet worden. Es handele sich in seiner Spezifik (Zwischenlagerung) sonstiger radioaktiver Stoffe um den einzigen Antrag dieser Art in Sachsen-Anhalt seit 1990. Soweit die Klägerin behaupte, das Verwaltungsgericht habe den Sachverhalt nicht richtig ermittelt, sei von falschen oder unvollständigen Tatsachen oder von einem anderen Sachverhalt als die Beamten ausgegangen und habe den Sachverhalt nicht erschöpfend gewürdigt oder wesentliche Gesichtspunkte unberücksichtigt gelassen, belasse sie es bei pauschalen Behauptungen ohne konkrete Subsumtion. Die Klägerin könne angesichts des Schreibens vom 27. Juni 2017 nicht ernsthaft behaupten, zur Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht angehört worden zu sein, zumal sie die Patronatserklärung vom 13. Dezember 2017 selbst in das Verfahren eingeführt habe und somit Aufklärungsbedarf gesehen habe. Fragen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit seien u.a. bereits in dem außergerichtlichen Schreiben vom 27. Juni 2017 thematisiert worden. Aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts ergebe sich, dass die Mitarbeiter des Beklagten nicht pflichtwidrig und schuldhaft gehandelt hätten, da die Klägerin keinen Anspruch auf Erteilung der beantragten Genehmigung gehabt habe. Das Abstellen der Klägerin auf ein bloß verzögertes Handeln, über welches das Verwaltungsgericht nicht entschieden habe, gehe fehl, da es der Klägerin nicht um irgendein Verwaltungshandeln, sondern um eine Erlaubniserteilung gegangen sei.
Die Fortsetzungsfeststellungsklage sei auch unbegründet. Die Genehmigungsvoraussetzungen hätten nicht vorgelegen.
Die Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gehöre zu den Voraussetzungen der Erteilung der strahlenschutzrechtlichen Genehmigung. Es sei von Bedeutung, ob das Unternehmen über ausreichende Mittel verfüge, um das Unternehmen ordnungsgemäß zu betreiben. Bei der strahlenschutzrechtlichen Genehmigung nach § 9 StrSchV 2001 handele es sich um einen Sonderfall der gewerberechtlichen Erlaubnis. Ein Gewerbetreibender sei dann gewerberechtlich unzuverlässig, wenn er nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür biete, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß ausüben werde. Die Unzuverlässigkeit könne sich auch aus mangelnder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ergeben. Diese fehle, wenn die für die Gewerbeausübung notwendigen finanziellen Mittel nicht vorhanden seien. Der Insolvenzfall stelle bei gefahrgeneigten Gewerben ein abzusicherndes Risiko dar, das auch der Gesetzgeber im Blick gehabt habe. Dies habe der Gesetzgeber nunmehr ausdrücklich in § 13 Abs. 7 StrSchG geregelt. Entsprechende Möglichkeiten für die finanzielle Insolvenzabsicherung seien im Atom- und Strahlenschutzrecht vorgesehen, etwa für kerntechnische Anlagen nach § 7c Abs. 2 Nr. 2 AtG und für radioaktive Stoffe nach § 9h Nr. 2 i.V.m. § 7c Abs. 2 Nr. 2 AtG. Soweit die Klägerin argumentiere, die wirtschaftliche Zuverlässigkeit gehöre nicht zu den Tatbestandsmerkmalen einer Genehmigung nach § 7 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrSchV 2001, sei dem entgegenzuhalten, dass sich dieses Erfordernis aus gewerberechtlichen Grundsätzen und aus den anderen Nummern des § 9 StrSchV 2001 ergeben könnte, insbesondere aus § 9 Abs. 1 Nr. 5 StrSchV 2001. Wenn das Landgericht Braunschweig auf die Zuverlässigkeit des Antragstellers abstelle, der in jedem Fall eine natürliche Person sein müsse, hätte der Antrag auf Erteilung der Genehmigung schon deshalb abgelehnt werden müssen, weil er von der Klägerin als GmbH gestellt worden sei. Auch wenn sich § 9 Abs. 1 StrSchV 2001 auf die Zuverlässigkeit der Geschäftsführung (der GmbH) beziehen möge, ändere dies nichts an der Eigenschaft der GmbH als Antragstellerin und an dem Erfordernis, dass diese über ausreichende Mittel verfügen müsse, um das Unternehmen vorschriftsgemäß zu betreiben. Wenn der Gesetzgeber bestimmte Anforderungen an die natürlichen Personen, etwa an die Geschäftsführer einer GmbH stelle, ergebe sich daraus nicht, dass ansonsten für die gewerbetreibende GmbH als juristische Person keine weitergehenden Anforderungen gelten sollten. Die Klägerin trage vor, vom Anwendungsbereich sollten Zwischenlager für sonstige radioaktive Abfälle ausgenommen werden, deren Genehmigungen nach § 3 Abs. 2 des Entsorgungsübergangsgesetzes auf einen vom Bund mit der Wahrnehmung der Zwischenlagerung beauftragten Dritten übertragen worden seien. Sie behaupte, eine solche Ausnahme bestehe für die von der EZN GmbH in L-Stadt gelagerten Abfälle. Dies werde bestritten. Den Erwägungen des Landgerichts Braunschweig, ein einmaliger Fehlbetrag, der zudem im Folgejahr wieder in ein positives Ergebnis münde, reiche nicht aus, um eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit zu belegen, sei entgegenzuhalten, dass der Jahresüberschuss von 285.234,58 € im Jahr 2016 einem Fehlbetrag in Höhe von 4.265.622,33 € im Jahr 2015 gegenübergestanden habe. Das sich ergebende Saldo von 3.980.387,75 € sei ganz erheblich und sei mit keiner positiven Zukunftsprognose verbunden. Im Prognosebericht des Jahresabschlusses 2016 heiße es, dass der Geschäftsverlauf aufgrund der projektbezogenen angebotenen Dienstleistungen hohen Schwankungen unterliege. Für das Jahr 2017 sei mit einem höheren Umsatz, aber aufgrund der geringeren Gewinnabführung der EZN mit einem Fehlbetrag gerechnet worden. Aufgrund der Jahresabschlüsse und der Bedenken gegen die wirtschaftliche Zuverlässigkeit habe auch das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz einen Antrag der Klägerin abgelehnt. Verfehlt sei der Ansatz des Landgerichts Braunschweig, das Verwaltungsgericht und die Beklagte hätten keine weitergehenden Ermittlungen angestellt, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Klägerin ergeben könnten, etwa, dass die Klägerin Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sei oder keine Steuern abführe. Umgekehrt hätte es der Klägerin oblegen, angesichts der Ergebnisse der Jahresabschlüsse den Anschein der fehlenden wirtschaftlichen Zuverlässigkeit zu entkräften. Dies habe die Klägerin im Grunde selbst erkannt und die Patronatserklärung der EZN vom 11. Juli 2017 vorgelegt, jedoch erst nach dem erledigenden Ereignis. Die weitere Erwägung des Landgerichts Braunschweig, ein mögliches finanzielles Risiko des Landes, auf dessen Boden die Anlage betrieben werden solle, sei vom Schutzzweck der StrSchV nicht erfasst, widerspreche § 13 Abs. 7 StrSchV n.F. Die Notwendigkeit der dort nunmehr ausdrücklich geregelten Risikoabsicherung habe schon vorher bestanden. Das Landgericht verkenne auch, dass es hier nicht allein um die mögliche Insolvenz der Klägerin gehe, sondern auch um das Insolvenzrisiko der EZN als Eigentümerin der nuklearen Reststoffe. Die Behauptung der Klägerin, der Beklagte habe nie ihre wirtschaftliche Zuverlässigkeit bestritten, sei – wie sich aus dem Anhörungsschreiben vom 27. Juni 2017 ergebe – unzutreffend. Die Klägerin habe es nicht für nötig erachtet, aufgrund dieses Anhörungsschreibens nähere Angaben zu ihrer wirtschaftlichen Zuverlässigkeit zu machen. Dieses Schreiben enthalte auch ausdrücklich die Unterscheidung zwischen den von der Klägerin mit Schreiben vom 16. November 2016 angebotenen Transportkosten und den Entsorgungskosten. Die Entsorgung und die damit verbundenen Kosten im Fall einer Insolvenz der Klägerin oder der EZN seien im Sommer 2017 ungeklärt gewesen, so dass die Genehmigung schon aus diesem Grund nicht hätte erteilt werden müssen. Wie sich aus dem Anhörungsschreiben und der internen Stellungnahme des Landesamts für Umweltschutz vom 25. Mai 2016 ergebe, habe das wirtschaftliche Risiko durchaus bestanden. Bis heute habe es die Klägerin nicht für nötig erachtet, sich substantiiert mit den Angaben zu den Entsorgungskosten in diesen Schreiben auseinandersetzen. Soweit die Klägerin meine, die Angaben in diesen Schreiben widersprächen sich, vergleiche sie „Äpfel mit Birnen“. Während die Kostenschätzung aus dem Schreiben vom 27. Juni 2017 aus der Kostenordnung der Landessammelstelle des Freistaats Sachsen abgeleitet sei, habe Prof. Dr. E. vom Landesamt für Umweltschutz die Entsorgungskosten insbesondere im Hinblick auf die Freimessung selbst überschlägig geschätzt. Soweit die Klägerin darauf hinweise, dass sie als Besitzerin der Fässer nicht entsorgungspflichtig gewesen und die EZN als Eigentümerin heranzuziehen sei, hätte die Klägerin gleichwohl Nachweise für die wirtschaftliche Absicherung des Entsorgungsrisikos beibringen müssen. Sie habe entsprechende Nachweise weder für sich noch für die EZN erbracht und in ihrem Schreiben vom 16. November 2016 lediglich Rücktransportkosten in Höhe von 50.000 € und erst im Klageverfahren verspätet die Patronatserklärung angeboten. Allein mit einem Abtransport der Fässer zur EZN nach L-Stadt wäre das Entsorgungsrisiko auch nicht abgesichert worden. Die EZN habe ihre Flächen in L-Stadt durch die Fortschaffung der nuklearen Reststoffe nach B-Stadt freimachen und die Freiflächen sodann für radioaktive Abfälle des Landes Niedersachsen nutzen wollen. Hieraus habe der Gewinn resultieren sollen. Mit einem Rücktransport nach L-Stadt wäre das Entsorgungsproblem nicht gelöst worden, weil keine Flächen für die Aufbewahrung vorgehalten worden wären. Soweit die Klägerin nunmehr unter Vorlage einer Unterlage behaupte, dass ihre freie kurzfristige Liquidität zum 31. Dezember 2016 14,7 Mio. € betragen habe, werde dies bestritten. Es sei nicht zu erklären, weshalb die Klägerin Angaben zu ihrer Liquidität nicht vorher – bis zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses – gemacht habe. Ebenso wenig sei nachvollziehbar, warum die Klägerin nicht erläutert habe, dass zwischen ihr und der EZN als Tochtergesellschaft ein Gewinnabführungsvertrag am 11. November 2014 abgeschlossen worden sein soll. Die Klägerin habe auch nicht nachvollziehbar belegt, dass im Falle einer Insolvenz die EZN Teile der Insolvenzmasse übernehmen würde.
Im Zeitpunkt der Erledigung hätten auch die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrSchV 2001 nicht vorgelegen. Weder aus dem Wortlaut noch aus dem Zweck dieser Vorschrift ergebe sich zwingend, dass der Nachweis der erforderlichen Vorsorge allein über die Bestätigung einer Deckungsvorsorgeversicherung erbracht werden dürfe. Der Verordnungsgeber hätte Entsprechendes ausdrücklich regeln können, was er nicht getan habe. Hierauf komme es aber letztlich nicht an, da die Klägerin bis zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses eine Deckungsvorsorgeversicherung nicht vorgelegt habe. Bei dem Schreiben der A-Versicherungs-AG vom 5. November 2015 handele sich lediglich um die Zusage, zu gegebener Zeit ein Angebot für einen Versicherungsvertrag zu unterbreiten. Nach § 1 der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung sei der Abschluss eines Haftpflichtversicherungsvertrags erforderlich. Vorvertragliche Interessenbekundungen seien nicht ausreichend.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten und die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
A. Die fristgerecht begründete und auch im Übrigen zulässige Berufung der Klägerin ist begründet. Das Verwaltungsgericht hat die Klage zu Unrecht abgewiesen. Die in eine Fortsetzungsfeststellungsklage analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO umgestellte Klage ist zulässig und begründet.
I. Die Zulässigkeit einer Fortsetzungsfeststellungsklage in entsprechender Anwendung des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO setzt voraus, dass – erstens – die ursprüngliche Verpflichtungsklage zulässig war, – zweitens – nach Rechtshängigkeit ein erledigendes Ereignis eingetreten ist, – drittens – ein klärungsfähiges Rechtsverhältnis besteht und – viertens – ein Feststellungsinteresse gegeben ist (BVerwG, Urteil vom 28. April 1999 – 4 C 4.98 – juris Rn. 10). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.
1. Die am 18. September 2017 beim Verwaltungsgericht als Untätigkeitsklage nach§ 75 VwGO erhobene Verpflichtungsklage auf Erteilung einer Umgangsgenehmigung nach den §§ 7, 9 der Strahlenschutzverordnung in der Fassung vom 20. Juli 2001 (StrlSchV 2001) ist zulässig gewesen.
Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 StrlSchV 2001 bedarf der Genehmigung, wer mit sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes (AtG) oder mit Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3 des AtG umgeht. Nach dem Genehmigungsantrag der Klägerin (Abschnitt 4.2) handelt es sich bei den zur Bereitstellung vorgesehenen Stoffen um sonstige radioaktive Stoffe gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 AtG.
Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, ist die Verpflichtungsklage auch in der Form der Untätigkeitsklage gemäß § 75 VwGO zulässig gewesen. Insbesondere kommt es für die Zulässigkeit der Klage nicht darauf an, ob nach dem Ablauf der 3-monatigen Sperrfrist des § 75 Satz 2 VwGO ein zureichender Grund für die Nichtbescheidung des Genehmigungsantrags im Sinne von § 75 Satz 3 VwGO vorgelegen hat. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil (S. 18 f.) nimmt der Senat insoweit Bezug.
2. Das für die Zulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage weiter vorauszusetzende erledigende Ereignis ist darin zu sehen, dass das Grundstück im Chemiepark B., auf dem die Anlage zur Bereitstellung radioaktiver Stoffe u.a. auf der Grundlage der beantragten Umgangsgenehmigung betrieben werden sollte, vom Grundstückseigentümer wegen des sich in die Länge ziehenden Genehmigungsverfahrens nicht länger für die Klägerin vorgehalten wurde. Damit steht fest, dass die ursprünglich beantragte, auf diese Betriebsstätte bezogene Umgangsgenehmigung für die Klägerin nutzlos wäre, ihr sogar das Sachbescheidungsinteresse fehlen würde.
3. Das mit der Fortsetzungsfeststellungsklage zu klärende Rechtsverhältnis besteht in der zwischen den Beteiligten strittigen Frage, ob die Klägerin materiell-rechtlich im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses einen Anspruch auf die beantragte Umgangsgenehmigung gehabt hat.
4. Das weiter erforderliche Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Nichterteilung der Umgangsgenehmigung ist gegeben.
Das Feststellungsinteresse kann sich insbesondere aus der Absicht ergeben, einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen, sofern dieser nicht von vornherein als aussichtslos erscheint (vgl. BVerwG, Beschluss vom 5. Februar 2015 – 1 WB 24.14 – juris Rn. 20). Ein Präjudizinteresse ist auch dann zu bejahen, wenn die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Amtspflichtverletzung in einem bereits anhängig gemachten Zivilprozess nicht offensichtlich aussichtslos ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 20. Juni 2013 – 8 C 17.12 – juris Rn. 26). Anderes gilt nur dann, wenn die Schadensersatzklage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht anhängig gemacht worden ist; denn die Fragen, die mit der Fortsetzungsfeststellungsklage geklärt werden sollen, stellen sich dann gleichermaßen in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in dem der Betroffene seinen Anspruch auf Schadensersatz unmittelbar geltend macht (BVerwG, Urteil vom 17. November 2016 – 2 C 27.15 – juris Rn. 16). Die Klägerin hat bereits in einem Zivilprozess gegen das Land Sachsen-Anhalt einen Schadenersatzanspruch wegen amtspflichtwidrigen Verhaltens von Mitarbeitern des Beklagten geltend gemacht. Das Feststellungsinteresse ist auch nicht dadurch entfallen, dass das Landgericht Braunschweig bereits mit Grundurteil vom 25. Februar 2021 (7 O 7269/19) festgestellt hat, dass der von der Klägerin geltend gemachte Klageanspruch dem Grunde nach besteht. Ein Wegfall des Präjudizinteresses könnte nur dann angenommen werden, wenn das Urteil bereits rechtskräftig geworden wäre; denn nur dann wäre der Zivilprozess nicht mehr „anhängig“ und der Ausgang des Prozesses nicht mehr offen. Das Urteil des Landgerichts Braunschweig ist aber noch nicht rechtskräftig, vielmehr wurde beim Oberlandesgericht Braunschweig Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.
Der Beklagte vermag auch nicht mit dem Einwand durchzudringen, das für einen Schadensersatzanspruch vorausgesetzte Verschulden des handelnden Amtsträgers könne deshalb nicht angenommen werden, weil die erkennende Kammer des Verwaltungsgerichts als Kollegialgericht in einem Hauptsacheverfahren das Verwaltungshandeln für rechtmäßig befunden hat.
Zwar ist anerkannt, dass eine beabsichtigte Schadensersatzklage dann als offensichtlich aussichtslos anzusehen ist, wenn das für einen Amtshaftungsanspruch erforderliche Verschulden offensichtlich fehlt. Das ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Bundesverwaltungsgerichts als auch der für die Durchführung von Amtshaftungsprozessen zuständigen Zivilgerichte in der Regel der Fall, wenn ein mit mehreren Berufsrichtern besetztes Kollegialgericht die Amtstätigkeit als objektiv rechtmäßig angesehen hat (sog. „Kollegialgerichts-Richtlinie“; vgl. BVerwG, Urteil vom 3. Juni 2003 – 5 C 50.02 – juris Rn. 9; Urteil vom 30. Juni 2004 – 4 C 1.03 – juris Rn. 21; Urteil vom 17. August 2005 – 2 C 37.04 – juris Rn. 27; Urteil vom 16. Mai 2013 – 8 C 14.12 – juris Rn. 47; BGH, Urteil vom 21. Januar 2016 – III ZR 160/15 – juris Rn. 36). Ob es sich um ein erstinstanzliches Gericht handelt und dessen Entscheidung im Berufungsverfahren Bestand haben würde, ist für die schuldausschließende Wirkung der Kollegialentscheidung unerheblich (BVerwG, Urteil vom 21. März 2013 – 3 C 6.12 – juris Rn. 12, m.w.N.). Daher ist auch der Umstand unerheblich, dass das Landgericht Braunschweig in seinem – noch nicht rechtskräftigen – Urteil vom 25. Februar 2021 von einer Nichtanwendung der Kollegialgerichtsrichtlinie und daher einem Verschulden der für den Beklagten handelnden Beamten ausgegangen ist, weil der Beklagte zentral für Genehmigungen der in Rede stehenden Art zuständig sei und insoweit die entsprechenden Kenntnisse besitzen und eine ordnungsgemäße Prüfung durchführen müsse.
Der Grundsatz, dass das Verschulden eines Beamten regelmäßig zu verneinen ist, wenn ein Kollegialgericht sein Verhalten als rechtmäßig bestätigt hat, gilt jedoch ausnahmsweise dann nicht, wenn es sich bei dem beanstandeten Verhalten um eine grundsätzliche Maßnahme zentraler Dienststellen bei Anwendung eines ihnen besonders anvertrauten Spezialgesetzes handelt oder wenn das Gericht die Rechtslage trotz eindeutiger und klarer Vorschriften verkannt oder eine eindeutige Bestimmung handgreiflich falsch ausgelegt hat; die Regel ist ferner unanwendbar, wenn besondere Umstände dafür sprechen, dass der verantwortliche Beamte kraft seiner Stellung oder seiner besonderen Einsichten es „besser“ als das Kollegialgericht hätte wissen müssen (BVerwG, Urteil vom 30. Juni 2004, a.a.O.; Urteil vom 21. Dezember 2010 – 7 C 23.09 – juris Rn. 50). So müssen etwa an die Bediensteten einer obersten Landesbehörde, die mit einer atomrechtlichen Anlagegenehmigung befasst sind, insoweit hohe Anforderungen gestellt werden; bei einem Verfahren dieser Art auf höchster Ebene ist – anders als bei „Alltagsgeschäften“ sonstiger staatlicher Genehmigungsbehörden – eine besonders gründliche Prüfung möglich und zu verlangen (BGH, Urteil vom 16. Januar 1997 – III ZR 117/95 – juris Rn. 23). Weitere Ausnahme von der Kollegialgerichtsrichtlinie liegen vor, wenn das Kollegialgericht von einem falschen Sachverhalt ausgegangen ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 9. August 1990 – 1 B 94.90 – juris Rn. 10) oder wenn es bereits in seinem rechtlichen Ausgangspunkt von einer verfehlten Betrachtungsweise ausgegangen ist oder wesentliche rechtliche Gesichtspunkte unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. August 2005, a.a.O., Rn. 30; Urteil vom 16. Mai 2013, a.a.O., jew. m.w.N.).
Gemessen daran lässt sich ein fehlendes Verschulden des handelnden Amtsträgers und damit eine offensichtliche Aussichtslosigkeit des von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzanspruchs nicht mit Blick auf die Kollegialgerichtsrichtlinie feststellen.
Dabei kann dahinstehen ob sich dies – wie das Landgericht Braunschweig in seinem Urteil vom 25. Februar 2021 (S. 24 des Urteilsabdrucks) angenommen hat – bereits daraus ergibt, dass der Beklagte als obere Landesbehörde in Sachsen-Anhalt zentral für Genehmigungen der vorliegenden Art zuständig ist, insoweit über ein Höchstmaß an entsprechender Sachkenntnis verfügen muss und deshalb eine besonders gründliche Prüfung zu verlangen ist. Daran kann man Zweifel haben, weil der Beklagte für eine Vielzahl von Aufgaben zuständig ist und die Erteilung von Genehmigungen nach der StrlSchV offenbar nicht zu seinen Schwerpunktaufgaben zählt(e) (vgl. den Flyer der Behörde: https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/LAV_Verbraucherschutz/service/publikationen/Flyer-LAV-Endf_01.pdf)). Zudem war der Beklagte nach § 6 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung für das Atom- und Strahlenschutzrecht (At-ZustVO) in der damals geltenden Fassung vom 27. August 2002 nicht allein zuständig für Umgangsgenehmigungen nach § 7 StrlSchV 2001. Sofern der Umgang mit radioaktiven Stoffen in Verbindung mit der Landessammelstelle erfolgte oder eine Genehmigung nach §§ 7, 9 AtG oder ein Planfeststellungsbeschluss nach § 9b AtG sich auf den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen erstreckte, war nach § 6 Satz 1 Nr. 1 At-ZustVO das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt zuständige Genehmigungsbehörde. Wenn die Betriebe der Bergaufsicht unterlagen, war nach § 6 Satz 1 Nr. 2 At-ZustVO das Landesamt für Geologie und Bergwesen zuständig. Im Übrigen war der Beklagte zuständig (§ 6 Satz 1 Nr. 3 At-ZustVO). Darüber hinaus erfolgten nach § 6 Satz 2 At-ZustVO die Genehmigungen nach Satz 1 Nrn. 2 und 3 im Benehmen mit dem Landesamt für Umweltschutz. Hinzu kommt schließlich, dass es sich bei der Erteilung der in Rede stehenden Umgangsgenehmigung um keine „grundsätzliche Maßnahme“ handeln dürfte.
Der Beklagte kann sich jedenfalls deshalb nicht auf die Kollegialgerichtsrichtlinie berufen, weil das Verwaltungsgericht bei der Frage, ob die für das Gericht allein maßgeblichen Versagungsgründe des § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 7 StrlSchV 2001 vorgelegen haben, bereits in seinem rechtlichen Ausgangspunkt von einer verfehlten Betrachtungsweise ausgegangen ist.
a) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV 2001 setzt Erteilung einer Genehmigung nach § 7 Abs. 1 StrlSchV voraus, dass keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben, und, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der Antragsteller die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt.
aa) Wie das Landgericht Braunschweig in seinem Urteil vom 25. Februar 2021 (S. 17 ff.) zutreffend dargelegt hat, betrifft die „Zuverlässigkeit des Antragstellers“ im Sinne des§ 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV 2001 nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse einer den Genehmigungsantrag stellenden juristischen Person. In der Begründung zum Entwurf der Verordnung zur Umsetzung von EURATOM-Richtlinien zum Strahlenschutz vom 16. März 2001 (BR-Drs. 207/01, S. 215 f.) heißt es zu § 9 Abs. 1 Nr. 1:
„An die Zuverlässigkeit der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Personen müssen mit Rücksicht auf die Gefahren des Umganges mit radioaktiven Stoffen besondere Anforderungen gestellt werden. Die Sicherheit der Arbeitnehmer, Dritter und der Allgemeinheit hängt in weitgehendem Maße von der Einhaltung der rechtlichen Vorschriften ab, so dass Personen, die nicht die Gewähr für die Einhaltung der Vorschriften bieten, ein Umgang mit diesen Stoffen nicht gestattet werden kann. Gleiches gilt sinngemäß für die Fachkunde der Personen, die mit den radioaktiven Stoffen umgehen oder diesen Umgang überwachen. Zu der in Absatz 1 Nr. 1 geforderten Fachkunde im Strahlenschutz enthält § 30 nähere Bestimmungen.
Aus der Vorschrift ist nicht abzuleiten, dass eine nicht rechtsfähige Personenvereinigung, z.B. eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), als solche Genehmigungsinhaberin und damit Strahlenschutzverantwortliche sein kann. Vielmehr ist in diesen Fällen jedem Mitglied, also z.B. jedem Arzt einer Gemeinschaftspraxis, der eine Tätigkeit im Sinne dieser Verordnung ausübt, eine eigene Genehmigung zu erteilen. Jedes Mitglied einer nicht rechtsfähigen Personenvereinigung ist also grundsätzlich selbst Strahlenschutzverantwortlicher und muss die subjektiven Genehmigungsvoraussetzungen erfüllen. § 31 Abs. 1 Satz 3 sieht vor, dass in diesen Fällen der Behörde mitzuteilen ist, wer von den Mitgliedern der Personenvereinigung die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen als Vertreter für alle übrigen Genehmigungsinhaber wahrnimmt.“
Daraus ergibt sich, dass eine juristische Person nicht zuverlässig oder unzuverlässig im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV 2001 sein kann, sondern entscheidend ist, ob die verantwortliche natürliche Person die Gewähr dafür bietet, dass die Vorschriften zum Umgang mit den im Genehmigungsantrag genannten radioaktiven Stoffen eingehalten werden. Nach der im Gewerberecht, dem das Atom- und Strahlenschutzrecht letztlich entstammt, anerkannten Definition ist zuverlässig, wer die Gewähr dafür bietet, dass er die genehmigte Tätigkeit ordnungsgemäß ausführen wird; dies gilt auch im Atomrecht (VG Bayreuth, Urteil vom 1. Dezember 2017 – B 1 K 15.666 – juris Rn. 68, m.w.N.).
Bereits die Strahlenschutzverordnungen vom 13. Oktober 1976 und 18. Mai 1989 enthielten jeweils in ihrem § 6 Abs. 1 Nr. 1 mit § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV 2001 wortgleiche Regelungen. Insoweit war in der Literatur anerkannt, dass jemand unzuverlässig ist, wenn er nicht die Gewähr dafür bietet, dass er die Strahlenschutzvorschriften einhält. Die Unzuverlässigkeit muss gerade im Hinblick auf die Beachtung der Strahlenschutzvorschriften bestehen, was z.B. der Fall ist, wenn die betreffende (natürliche) Person bereits gegen Strahlenschutzvorschriften verstoßen hat. Dagegen lässt sich die Zuverlässigkeit nicht ohne weiteres verneinen, wenn jemand gegen Vorschriften verstoßen hat, die in keiner Beziehung zum Strahlenschutz stehen, wie z.B. bei einer Vorstrafe wegen Steuerhinterziehung. Allerdings können auch solche Vorstrafen ein Indiz für eine Gesetzen gegenüber negative Einstellung sein, die den Betroffenen auch in Bezug auf die Einhaltung von Strahlenschutzvorschriften als nicht zuverlässig erscheinen lässt (zum Ganzen: Kramer/Zerlett, StrlSchV, 3. Aufl.1989, § 6 Anm. 1, § 4 Anm. 22).
Bestätigt wird dieses Ergebnis bei einem Vergleich mit atomrechtlichen Bestimmungen, mit denen – nicht zuletzt wegen der Ermächtigung in § 54 AtG, auf deren Grundlage die StrlSchV 2001 erging – ein sachlicher Zusammenhang besteht. So darf nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG eine Genehmigung zur Errichtung, zum Betrieb oder zum Innehaben einer ortsfesten Anlage zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe oder zur wesentlichen Veränderung des Betriebes einer solchen Anlage nur erteilt werden, wenn keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers und der für die Errichtung, Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs der Anlage verantwortlichen Personen ergeben, und die für die Errichtung, Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs der Anlage verantwortlichen Personen die hierfür erforderliche Fachkunde besitzen. In Bezug auf diesen Zuverlässigkeitsbegriff gilt im Grundsatz, dass – in Anlehnung an das Gewerberecht – auch im Atomrecht als unzuverlässig gilt, wer keine Gewähr dafür bietet, dass er die genehmigte Tätigkeit in Zukunft ordnungsgemäß ausüben wird (Leidinger, in: Frenz [Hrsg.], Atomrecht, § 7 AtG, Rn. 139). Unzuverlässig ist ein Gewerbetreibender, der nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß betreibt (BVerwG, Urteil vom 2. Februar 1982 – 1 C 146.80 – juris Rn. 13). Vor dem Hintergrund der schutzzweckorientierten Auslegung auch des Zuverlässigkeitserfordernisses ist von einer Unzuverlässigkeit nur dann auszugehen, wenn Tatsachen grundlegende Mängel oder Schwächen bei den verantwortlichen Personen oder in der Organisation des Betriebs oder in der Aus- und Fortbildung des Betriebspersonals erkennen lassen, die ein erhöhtes Risiko bedeuten (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. März 1993 – 7 C 4.92 – juris Rn. 28). Insofern sind insbesondere solche Verstöße maßgeblich, die einen Zusammenhang mit nuklearspezifischen Rechtsnormen aufweisen, die im Hinblick auf die Abwehr und Beherrschung von Gefahren relevant sind (Leidinger, a.a.O., Rn. 141). Zur Versagung einer Genehmigung wegen Bedenken im Hinblick auf die Zuverlässigkeit des Antragstellers und der leitenden Personen sowie im Hinblick auf den erforderlichen Kenntnisstand des Betriebspersonals muss es etwa führen, wenn wegen konkreter, die genannten Personen betreffender Umstände ein – erhöhtes – Risiko von Störfällen aufgrund menschlichen Versagens nicht ausgeschlossen werden kann (BVerwG, Beschluss vom 17. April 1990 – 7 B 111.89 – juris Rn. 7). Vor diesem Hintergrund ist auch in atomrechtlichen Genehmigungsverfahren davon auszugehen, dass eine „finanzielle Zuverlässigkeit“ in Form einer wirtschaftlichen Zuverlässigkeit nicht zu fordern ist (vgl. Posser, in: Hennenhöfer/Mann/Posser/Sellne, AtG/PÜ, § 7 AtG Rn. 42).
bb) Zwar kann im Gewerberecht die Annahme der Unzuverlässigkeit eines Gewerbetreibenden im Sinne von § 35 Abs. 1 GewO (auch) aus einer lang andauernden wirtschaftlichen Leistungsunfähigkeit abzuleiten sein, die infolge des Fehlens von Geldmitteln eine ordnungsgemäße Betriebsführung im Allgemeinen und die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Zahlungspflichten im Besonderen verhindert, ohne dass – insbesondere durch Erarbeitung eines tragfähigen Sanierungskonzeptes – Anzeichen für eine Besserung erkennbar sind. Insoweit ist eine die gesamte Situation des Gewerbetreibenden einschließlich seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bewertende Prognose erforderlich (vgl. BVerwG, Beschluss vom 9. April 1997 – 1 B 81.97 – juris Rn. 5). Hinsichtlich der gewerberechtlichen Untersagungsgründe ist zu unterscheiden zwischen den Gründen, die eine juristische Person selbst verwirklichen kann, und denjenigen, die ein Handeln oder Unterlassen natürlicher Personen voraussetzen, also die Zuverlässigkeit der vertretungsberechtigten Organe betreffen (BayVGH, Beschluss vom 17. Januar 2012 – 22 CS 11.1972 – juris Rn. 10, m.w.N).
Selbst wenn diese im allgemeinen Gewerberecht geltenden Grundsätze auch im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV anzuwenden sein sollten, etwa weil eine solche lang andauernde fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit die Befürchtung zulassen könnte, dass der Antragsteller nicht sachgerecht mit den radioaktiven Stoffen umgehen wird, käme dieser Gesichtspunkt hier nicht zum Tragen. Denn Anhaltspunkte für eine solche lang andauernde wirtschaftliche Leistungsunfähigkeit der Klägerin hatten hier nicht bestanden. Das Verwaltungsgericht hat die von ihm angenommene fehlende „wirtschaftliche Zuverlässigkeit“ allein damit begründet, dass die Klägerin zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses über eine „vergleichsweise schwache Bonität“ verfügt habe. Es hat diese Annahme darauf gestützt, dass die Klägerin ausweislich des Jahresabschlusses 2016 in diesem Jahr erstmals einen Jahresüberschuss in Höhe von 285.234,58 € erwirtschaftet habe, während im Jahr 2015 wegen erforderlicher Rückstellungen insoweit ein Fehlbetrag von 4.265.622,33 € zu verzeichnen gewesen sei. Dies zeige zwar eine positive Tendenz auf. Allerdings unterliege laut Prognosebericht des Jahresabschlussberichts 2016 der Geschäftsverlauf der Klägerin aufgrund der projektbezogen angebotenen Dienstleistungen hohen Schwankungen. Für das Jahr 2017 sei mit einem etwas höheren Umsatz als im Vorjahr gerechnet worden. Gleichwohl sei aufgrund einer deutliche geringeren Gewinnabführung der EZN an die Klägerin am Jahr 2017 damit zu rechnen, dass die Klägerin höchstwahrscheinlich einen Fehlbetrag ausweisen werde. Diese Daten genügen indes nicht, um von einer lang anhaltenden Leistungsunfähigkeit der Klägerin sprechen zu können. Davon ist im Übrigen auch das Landgericht Braunschweig in seinem Urteil vom 25. Februar 2021 zu Recht ausgegangen.
b) Von einem verfehlten Ansatz ausgegangen ist das Verwaltungsgericht auch hinsichtlich der Genehmigungsvoraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV 2001. Danach ist weitere Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung nach § 7 StrlSchV, dass die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist.
Zwar enthält die Begründung zum Entwurf der Verordnung zur Umsetzung von EURATOM-Richtlinien zum Strahlenschutz vom 16. März 2001 (BR-Drs. 207/01, S. 215 f.) zu dieser Bestimmung keine Erwägungen.
Hilfreich ist aber ein Blick auf die nunmehr geltende Regelung des § 13 Abs. 2 StrlSchG und die vom Gesetzgeber dazu angestellten Erwägungen. Nach dieser Vorschrift wird die Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 StrlSchG nur erteilt, wenn die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist. Nach der Begründung zum Gesetzentwurf vom 20. Februar 2017 (BT-Drs.18/11241, S. 251) werde u.a. für den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen eine weitere Voraussetzung aus der Strahlenschutzverordnung übernommen, die für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler nicht erforderlich sei. Mit dieser Genehmigungsvoraussetzung würden § 9 Abs. 1 Nr. 7 und § 14 Abs. 1 Nr. 7 der bisherigen Strahlenschutzverordnung übernommen. Wie auch nach bisheriger Rechtslage richteten sich die Anforderungen an die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nach den §§ 13 bis 15 des Atomgesetzes. Das stelle § 177 des StrlSchG klar. Nach § 177 Satz 1 StrlSchG richtet sich im Anwendungsbereich dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen die Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nach den §§ 13 bis 15 des Atomgesetzes und nach der (seit dem 1. März 1977 geltenden) Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung (AtDeckV).
Nach § 13 Abs. 5 Satz 1 AtG sind gesetzliche Schadensersatzverpflichtungen im Sinne dieses Gesetzes die auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts beruhenden Schadensersatzverpflichtungen. Nach § 13 Abs. 5 Satz 2 AtG gehören zu den gesetzlichen Schadensersatzverpflichtungen im Sinne dieses Gesetzes Verpflichtungen aus den §§ 110, 111 SGB VII nicht, Verpflichtungen zur Schadloshaltung, die sich aus § 7 Abs. 6 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 14 BImSchG ergeben, sowie ähnliche Entschädigungs- oder Ausgleichsverpflichtungen nur insoweit, als der Schaden oder die Beeinträchtigung durch Unfall entstanden ist.
Daraus folgt, dass – anders als das Verwaltungsgericht angenommen hat – die Genehmigungsvoraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV 2001 eine Sicherheit gegen ein Insolvenzrisiko des Antragstellers nicht verlangt. Gefordert ist vielmehr, dass eine den Anforderungen der AtDeckV genügende Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist (vgl. Kramer/Zerlett, a.a.O., § 6 Anm. 16 ff.). Dazu verhält sich das angefochtene Urteil nicht.
2. Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist auch begründet. Die Klägerin hat im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses einen Anspruch auf Erteilung einer Umgangsgenehmigung nach §§ 7, 9 StrlSchV 2001 gehabt.
a) Nach § 9 Abs. 1 StrlSchV 2001 ist die Genehmigung nach § 7 Abs. 1 zu erteilen, wenn
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben, und, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der Antragsteller die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,
2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Strahlenschutzbeauftragten ergeben, und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,
3. die für eine sichere Ausführung des Umgangs notwendige Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten vorhanden ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,
4. gewährleistet ist, dass die bei dem Umgang sonst tätigen Personen die notwendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen,
5. gewährleistet ist, dass bei dem Umgang die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten werden,
6. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, dass das für eine sichere Ausführung des Umgangs notwendige Personal nicht vorhanden ist,
7. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist,
8. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist,
9. überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, dem Umgang nicht entgegenstehen und
10. § 4 Abs. 3 dem beabsichtigten Umgang nicht entgegensteht.
(1) Die Voraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV war aus den oben bereits dargelegten Gründen erfüllt.
(2) Es ist auch nicht ersichtlich, dass Tatsachen vorlagen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des von der Klägerin im Genehmigungsantrag benannten Strahlenschutzbeauftragten und seiner beiden Stellvertreter ergaben, oder dass dieser die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nicht besaß. Dem Genehmigungsantrag lagen entsprechende Fachkundebescheinigungen bei.
(3) Ferner bestanden keine Anhaltspunkte dafür, dass die für eine sichere Ausführung des Umgangs notwendige Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten nicht vorhanden war oder ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse nicht eingeräumt waren.
Nach § 31 Abs. 2 Satz 1 StrlSchV ist schriftlich die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten zu bestellen für die Leitung oder Beaufsichtigung von Tätigkeiten, soweit dies für die Gewährleistung des Strahlenschutzes bei der Tätigkeit notwendig ist. Grundsätzlich müssen so viele Strahlenschutzbeauftragte bestellt sein, dass die in § 33 Abs. 1 und 2 StrlSchV 2001 genannten Schutzvorschriften und Pflichten eingehalten werden können. Wann dies der Fall ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Entscheidende Faktoren können in diesem Zusammenhang z.B. der Umfang des Umgangs mit radioaktiven Stoffen, Größe des Betriebs, Anzahl der strahlenexponierten Personen sein (vgl. Kramer/Zerlett, a.a.O., § 4 Anm. 20). Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass hiernach für den beabsichtigten Betrieb der Klägerin die Bestellung nur eines Strahlenschutzbeauftragten nicht ausreichend gewesen wäre.
Nach § 31 Abs. 2 Satz 2 StrlSchV 2001 sind bei der Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten dessen Aufgaben, dessen innerbetrieblicher Entscheidungsbereich, und die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Befugnisse schriftlich festzulegen. Nach den Genehmigungsunterlagen (Anlage 2) umfasste der sachliche Entscheidungsbereich alle nach § 33 Abs. 2 StrlSchV aufgeführten Pflichten im Rahmen der betrieblichen Anweisungen.
(4) Es lagen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die bei dem Umgang sonst tätigen Personen im Betrieb der Klägerin nicht die notwendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besessen hätten. Insoweit dürfte es genügen, wenn z.B. eine Belehrung nach § 41 StrlSchV stattgefunden hat (vgl. Kramer/Zerlett, a.a.O., § 6 Anm. 10). Den Antragsunterlagen (Beiakte C, Bl. 65 ff.) waren als Anlage 7 eine Strahlenschutzanweisung sowie weitere relevante QM-Anweisungen beigefügt. Dass dies nicht genügt hätte, um den Anforderungen des § 9 Abs. 1 Nr. 4 StrlSchV 2001 gerecht zu werden, macht der Beklagte nicht geltend und ist auch sonst nicht ersichtlich.
(5) Ferner lagen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei dem Umgang die Ausrüstungen nicht vorhanden und die Maßnahmen nicht getroffen waren, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten werden. Auch insoweit hat der Beklagte nichts beanstandet.
(6) Es waren auch keine Tatsachen erkennbar, aus denen sich Bedenken ergaben, dass das für eine sichere Ausführung des Umgangs notwendige Personal nicht vorhanden gewesen wäre. Die Behörde prüft, ebenso wie bei § 9 Abs.1 Nr. 1 und 2 StrlSchV 2001 nur dann tiefergehend, wenn ihr entsprechende Anhaltspunkte bekannt gewesen sind (vgl. BR-Drs. 207/01, S. 216). Auch diesbezüglich hat der Beklagte nichts eingewandt.
(7) Die Voraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV war zwar im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses nicht erfüllt (dazu aa). Diese fehlende Genehmigungsvoraussetzung hätte aber durch eine Nebenbestimmung sichergestellt werden können (dazu bb).
aa) Wie oben bereits dargelegt, richten sich die Anforderungen an die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nach den §§ 13 bis 15 AtG und der AtDeckV. Nach § 13 Abs. 1 AtG hat die Verwaltungsbehörde im Genehmigungsverfahren Art, Umfang und Höhe der Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen (Deckungsvorsorge) festzusetzen, die der Antragsteller zu treffen hat. Die Festsetzung ist im Abstand von jeweils zwei Jahren sowie bei erheblicher Änderung der Verhältnisse erneut vorzunehmen; hierbei hat die Verwaltungsbehörde dem zur Deckungsvorsorge Verpflichteten eine angemessene Frist zu bestimmen, binnen deren die Deckungsvorsorge nachgewiesen sein muss. Der zur Deckungsvorsorge Verpflichtete ist der Antragsteller bzw. Inhaber einer Genehmigung nach dem AtG oder einer aufgrund des AtG erlassenen Rechtsverordnung, wie etwa der StrlSchV (vgl. Raetzke, in Frenz [Hrsg.]), AtG § 13 Rn. 8). Die Festsetzung der Deckungsvorsorge erfolgt durch einen Verwaltungsakt der Genehmigungsbehörde. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers von 1959 ist diese Festsetzung bereits während des Genehmigungsverfahrens, d.h. regelmäßig vor Erteilung der Genehmigung erforderlich, da die Erteilung der Genehmigung selbst davon abhängt, dass diese Vorsorge bereits getroffen und nachgewiesen ist. In der Praxis kommt es aber auch vor, dass die Deckungsvorsorge im Genehmigungsbescheid festgesetzt wird; das ist in der Praxis vor allem dann möglich und unbedenklich, wenn die Deckungssumme aufgrund der Tabellen in der AtDeckV problemlos von allen Beteiligten errechnet werden kann; hier kann der Antragsteller eine entsprechende Vorsorge bereits im Vorfeld der Festsetzung treffen (zum Ganzen: Raetzke, a.a.O., Rn. 10). Nach § 1 Satz 1 AtDeckV kann die Deckungsvorsorge für Anlagen und Tätigkeiten, bei denen eine atomrechtliche Haftung nach internationalen Verträgen oder nach dem Atomgesetz in Betracht kommt, durch (1.) eine Haftpflichtversicherung oder (2.) eine sonstige finanzielle Sicherheit erbracht werden. Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 AtDeckV kann durch eine Haftpflichtversicherung die Deckungsvorsorge nur erbracht werden, wenn sie bei einem im Inland zum Betrieb der Haftpflichtversicherung befugten Versicherungsunternehmen genommen wird. Nach § 5 Abs. 1 AtDeckV ist die Deckungsvorsorge der Verwaltungsbehörde in geeigneter Form nachzuweisen. Dies geschieht in der Regel durch Vorlage eines Versicherungsvertrages (Raetzke, a.a.O., Rn. 19; Posser, a.a.O., § 7 AtG Rn. 55). Dass die Vorlage eines Versicherungsvertrages erforderlich ist und eine Erklärung des Versicherers, eine Deckungsvorsorge bereitstellen zu wollen, nicht genügt, ergibt sich auch aus der Regelung in § 2 Abs. 2 AtDeckV. Danach muss, sofern der Bund und die Länder verpflichtet sind, den zur Deckungsvorsorge Verpflichteten von Schadensersatzansprüchen freizustellen oder die Befriedigung der gegen ihn gerichteten Schadensersatzansprüche sicherzustellen, der Versicherungsvertrag zugunsten der Bundesrepublik Deutschland und des betroffenen Bundeslandes die Verpflichtung des Versicherers enthalten, der Verwaltungsbehörde jede Änderung des Vertrages, jedes Schadensereignis, jede Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und jede Leistung zur Erfüllung von Schadensersatzverpflichtungen unverzüglich anzuzeigen, sobald ihm diese Umstände bekannt werden. Kann der Antragsteller im Genehmigungsverfahren die festgesetzte Deckungsvorsorge nicht nachweisen, so kann die beantragte Genehmigung mangels Vorliegens einer Genehmigungsvoraussetzung nicht oder nur mit einer entsprechenden Auflage erteilt werden (Raetzke, a.a.O., Rn 23).
Hiernach war im Zeitpunkt des Eintritts des erledigenden Ereignisses die Voraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV 2001 nicht erfüllt. Einen Versicherungsvertrag für den Betrieb der geplanten Anlage in B-Stadt, mit dem die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen worden wäre, hatte die Klägerin noch nicht abgeschlossen. Es lag lediglich eine Erklärung der A-Versicherungs-AG vom 5. November 2015 vor, dass sie sich im Anschluss an den bereits bestehenden Versicherungsschutz für den genehmigten Umgang mit radioaktiven Stoffen gemäß § 7 StrlSchV (2001) in den Standorten A-Stadt und L-Stadt bereiterkläre, für den geplanten neuen Standort in B-Stadt ebenfalls die erforderliche Deckungsvorsorgeversicherung bereitzustellen, und die Deckungsvorsorge für den geplanten neuen Standort in B-Stadt im Rahmen einer eigenständigen Strahlenhaftpflichtversicherung bereitgestellt werde, sobald ihr die endgültigen Genehmigungsunterlagen vorlägen und die Klägerin mit ihren dann angebotenen Bedingungen und Konditionen einverstanden sei.
bb) Ein Anspruch auf Erteilung der Umgangsgenehmigung lässt sich aber daraus ableiten, dass die Erfüllung der (noch) fehlenden Genehmigungsvoraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV durch eine Nebenbestimmung, dass von der Genehmigung erst nach Festsetzung der Deckungsvorsorge durch den Beklagten und Vorlage eines entsprechenden Versicherungsvertrages Gebrauch gemacht werden darf, hätte sichergestellt werden können.
Nach § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i.V.m. § 36 Abs. 1 Alt. 2 VwVfG darf ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, mit einer Nebenbestimmung versehen werden, wenn sie der Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes dienen soll, die zum Zeitpunkt seines Erlasses noch nicht vollständig nachgewiesen werden können.
Die Nebenbestimmung ist ein Minus und milderes Mittel gegenüber der sonst im Rahmen der gebundenen Verwaltung möglicherweise notwendigen Ablehnung des Verwaltungsaktes. Deshalb stellt § 36 Abs. 1 Alt. 2 VwVfG eine Generalermächtigung der Behörde dar, einen Verwaltungsakt im Bereich der gebundenen gewährenden Verwaltung bereits „im Vorfeld“ der Entstehung eines Anspruchs zu erlassen, das Fehlen von Voraussetzungen „zu überbrücken“. Die Ausstattung eines begünstigenden Bescheides mit einer entsprechenden Nebenbestimmung erlaubt eine bürgerfreundlichere Verwaltungspraxis und kann das mildere Mittel darstellen, so dass die Nebenbestimmung als das mildere Mittel im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sogar geboten sein kann. Die Frage, ob ein legitimes Regelungsziel überhaupt durch eine Nebenbestimmung erreicht werden soll und, wenn ja, durch welche, steht im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde (vgl. VG Berlin, Beschluss vom 11. August 2020 – 35 L 305/20 – juris 56, m.w.N.).
Grundsätzlich besteht also nur ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung darüber, ob ein Versagungsgrund mit einer Nebenbestimmung ausgeräumt wird, und nicht etwa ein Anspruch auf den Verwaltungsakt mit Nebenbestimmungen. Eine Verpflichtung zum Erlass einer Nebenbestimmung zur Vermeidung einer ablehnenden Entscheidung ergibt sich nur, wenn das Ermessen auf Null reduziert ist. Jenseits denkbarer Fälle einer entsprechenden Selbstbindung der Verwaltung wird eine solche Ermessensreduzierung unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten vor allem diskutiert, wenn es sich bei der (noch) nicht erfüllten gesetzlichen Voraussetzung nur um eine Kleinigkeit handelt. Abgesehen von den Schwierigkeiten bei der Einordnung von gesetzlichen Voraussetzungen als wesentlich oder unwesentlich, gibt es jedenfalls keinen Anspruch auf einen völligen Verzicht auf vermeintlich unwesentliche Anspruchsvoraussetzungen; es kann also auch hier nur um in absehbarer Zeit sicher erfüllbare Anforderungen gehen. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Behörde möglicherweise die Ablehnung des Antrags auch vermeiden kann, indem sie den Antragsteller auf die noch bestehenden Probleme mit seinem Antrag hinweist und die Entscheidung zurückstellt. Schließlich erscheint zweifelhaft, ob sich das (Auswahl-)Ermessen jemals auf den Erlass gerade einer bestimmten Nebenbestimmung hin verdichten kann. In jedem Fall bedarf es keines besonderen Antrags, um allfällige Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt hinzufügen zu lassen; er ist als Minus schon im Antrag auf den Verwaltungsakt enthalten (zum Ganzen: Schröder, in: Schoch/Schneider VwVfG, Stand: Juli 2020, § 36 Rn. 128 m.w.N.).
Gemessen daran hätte die Klägerin einen Anspruch darauf gehabt, dass ihr die Genehmigung mit der Nebenbestimmung erteilt wird, den Betrieb der Anlage erst dann aufzunehmen, wenn die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen und durch die Vorlage eines Versicherungsvertrages nachgewiesen ist. Das mit einer Betriebsaufnahme verbundene Risiko wäre damit im gesetzlich geforderten Umfang abgesichert worden.
Im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses hätte es nicht mehr einer ermessensgerechten Entscheidung entsprochen, wenn der Beklagte vor Erteilung einer Genehmigung die Vorlage eines Versicherungsvertrags – ggf. nach Festsetzung der Deckungssumme – verlangt hätte. Eine solche Verfahrensweise wäre nicht mehr sachgerecht gewesen. Der Beklagte hat, nachdem die Klägerin die Antragsunterlagen vorgelegt hatte, nicht auf die Notwendigkeit der Vorlage eines Versicherungsnachweises hingewiesen. Mit Schreiben vom 1. Juni 2017 hat die Klägerin erklärt, dass sie nach dem wechselseitigen Schriftverkehr davon ausgehe, dass spätestens seit der Vorlage der Unterlagen im Schreiben vom 12. April 2017 ein vollständiger Antrag vorliege. Der Beklagte hat dies nicht zum Anlass genommen, die Klägerin zur Vorlage eines Versicherungsvertrags aufzufordern. Auch in dem Anhörungsschreiben vom 27. Juni 2017 hat der Beklagte nicht erwähnt, dass der Erteilung der beantragten Genehmigung das Fehlen eines Versicherungsvertrags entgegenstehen könnte. Vor diesem Hintergrund konnte die Klägerin davon ausgehen, dass im Hinblick auf den Nachweis eines hinreichenden Versicherungsschutzes die vorgelegte Bescheinigung der A-Versicherungs-AG ausreichen und der Beklagte die Genehmigung nicht wegen des Fehlens eines Versicherungsvertrags ablehnen würde. Der Beklagte ist in seinem Schriftsatz vom 19. Dezember 2017 selbst davon ausgegangen, dass die Antragsunterlagen (nur) bis zum 18. April 2017 noch nicht in prüffähiger Form vorgelegt waren.
Mit der Forderung eines abgeschlossenen Versicherungsvertrags wäre eine weitere Zeitverzögerung verbunden gewesen, insbesondere wenn zuvor noch die Bestimmung einer Deckungssumme erforderlich gewesen wäre. Eine solche Verzögerung wäre der Klägerin, die bereits mit Schreiben vom 1. Juni 2017 und 20. Juli 2017 jeweils unter Fristsetzung auf eine Bescheidung ihres Antrags und auf Beschleunigung des Verfahrens gedrängt hatte, nicht zumutbar gewesen. Bereits im Zeitpunkt der Klageerhebung waren – wie ausgeführt – die Voraussetzungen für die Erhebung einer Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO erfüllt und anschließend bis zum erledigenden Ereignis weitere Wochen vergangen. Auf der anderen Seite hätte die Vorlage eines Versicherungsvertrags vor Erteilung der Genehmigung keinen Sicherheitsgewinn hinsichtlich der Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 StrlSchV bedeutet. Bereits die oben beschriebene Nebenbestimmung hätte dafür gesorgt, dass eine Betriebsaufnahme ohne hinreichenden Versicherungsschutz nicht zulässig gewesen wäre. Eine solche Nebenbestimmung hätte das in Rede stehende Risiko in gleicher Weise abgesichert wie ein bereits abgeschlossenes Versicherungsverhältnis. Aufgrund der Zusage der A-Versicherungs-AG vom 5. November 2015 war auch davon auszugehen, dass der entsprechende Versicherungsvertrag nach Erteilung der Umgangsgenehmigung abgeschlossen werden würde.
(8) Die Umgangsgenehmigung konnte der Beklagte auch nicht mit der Begründung versagen, der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter sei nicht gewährleistet.
Der Begriff der Einwirkungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 8 StrlSchV, der als Oberbegriff auch die Störmaßnahmen erfasst, ist sehr weitgehend; hierunter sind alle Handlungen und Ereignisse zu verstehen, die zu einer Gefährdung durch ionisierende Strahlungen führen können, wie etwa Flugzeugabstürze, Gaswolkenexplosionen, Sabotage und Kriegseinwirkungen (Kramer/Zerlett, a.a.O., § 6 Anm. 21). Als Maßnahmen der erforderlichen Vorsorge oder des erforderlichen Schutzes kommen in erster Linie baulich-technische und ergänzend organisatorisch-administrative Vorkehrungen in Betracht (vgl. zu § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG: BVerwG, Urteil vom 10. April 2008 – 7 C 39.07 – juris Rn. 21). Für die Frage, welcher Schutz im Einzelfall erforderlich ist, ist von dem Grundsatz auszugehen, dass die Sicherheitsanforderungen umso höher sein müssen, je höher das Risiko ist, das wiederum sowohl durch die Wahrscheinlichkeit, mit dem ein Schadensereignis eintreten kann, als auch durch Art und Ausmaß der aufgrund der betreffenden Tätigkeit denkbaren Schadensfolgen gekennzeichnet ist (Kramer/Zerlett, a.a.O., § 6 Anm. 23). Entsprechend der Zunahme des Risikos können die Schutzmaßnahmen von dem einfachen Verschluss der radioaktiven Stoffe über besondere Tresorbehälter mit entsprechenden Alarmsystemen bis hin zu speziellen Schutzzäunen nebst betriebseigenem Werkschutz oder Beauftragung eines privaten Bewachungsunternehmens gehen; insbesondere bei hohen Risiken wird man die erforderliche Vorsorge nicht allein dem Antragsteller in der Weise überlassen dürfen, dass Einwirkungen von ihm auch ohne Hilfe der Polizei abgewehrt werden müssen (Kramer/Zerlett, a.a.O., § 6 Anm. 23).
Aus dem Lageplan (Beiakte C, Bl. 45) ist ersichtlich, dass das Bereitstellungslager durch eine Zaunanlage eingefriedet ist bzw. werden sollte. In Anlage 7 der Genehmigungsunterlagen (Beiakte C, Bl. 90 ff.) hat die Klägerin Sicherungsmaßnahmen für das Bereitstellungslager dargestellt. Dazu zählt u.a. die Beauftragung der S. GmbH mit dem Wachschutz. Sofern die in den Antragsunterlagen dargestellten Maßnahmen nicht ausreichend gewesen sei sollten, hätte der Beklagte dies in weiteren Nebenbestimmungen (Bedingungen) zur Umgangsgenehmigung sicherstellen können. Insoweit ist dem Verwaltungsgericht darin beizupflichten, dass eine Genehmigung auch ohne weiteres mit der Bedingung hätte verbunden werden können, dass die Klägerin sich die rechtliche Verfügungsgewalt über das Grundstück verschafft, um ggf. (weitere) Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor Einwirkungen Dritter vornehmen zu können.
(9) Es ist auch nicht ersichtlich, dass überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, dem Umgang entgegenstanden.
Welche öffentlichen Interessen konkret im Rahmen dieser Genehmigungsvoraussetzung zu berücksichtigen sind, ist nicht ohne weiteres erkennbar. Im Falle des ähnlich lautenden § 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG bestand überwiegend Einigkeit darüber, dass nur solche öffentlichen Interessen gemeint sind, die nicht nuklearspezifisch sind. Begründet wurde dies mit der Überlegung, dass § 7 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 AtG bereits die nuklearspezifischen Belange konkretisiere, so dass Nr. 6 bei restriktiver Interpretation (im Sinne der Berücksichtigung von ausschließlich nuklearspezifischen Belangen) überflüssig wäre. Dieser Gedanke gilt auch für den Bereich der StrlSchV 2001, bei der die spezifisch strahlenschutzrechtlichen Belange bereits in den Tatbeständen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 präzisiert sind. Für den Fall, dass nicht-nuklearspezifische Belange nach § 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG der Wahl des Standorts der Anlage entgegenstehen, wurde in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu § 35 Abs. 3 BBauG/BauGB (vgl. BVerwG, Urteil vom 20. Oktober 1972 – IV C 1.70 – juris) angenommen, dass die atomrechtliche Genehmigungsbehörde aus diesem Grund die Genehmigung versagen kann. Zumindest für den Bereich der StrlSchV kann dem nicht gefolgt werden, da eine Mitwirkung der betroffenen Behörden an der Entscheidung der für die Erteilung der Genehmigung zuständigen Behörde im Gegensatz zu § 7 Abs. 4 AtG nicht vorgesehen ist. Es könnte sonst die Situation eintreten, dass im Gegensatz zur strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde, die die Genehmigung unter Berufung auf wasserrechtliche Gesichtspunkte abgelehnt hat, die zuständige Wasserbehörde die wasserrechtliche Genehmigung erteilt. Die Situation wird für den Bereich des § 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG durch die in § 7 Abs. 4 AtG vorgesehene Beteiligungsregelung gemildert. Dieses Korrektiv entfällt jedoch für den Bereich des Strahlenschutzes. Zu den öffentlichen Interessen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 9 StrlSchV gehören somit weder die spezifisch strahlenschutzrechtlichen noch die nicht atomrechtlichen Belange, so dass als öffentliche Interessen nur solche in Frage kommen, die vom Zweck des Atomgesetzes (vgl. § 1 Nr. 1, 3 und 4) gedeckt sind (so Kramer/Zerlett, a.a.O., § 6 Anm. 25, m.w.N.).
Eine etwas abweichende Position vertritt das VG Greifswald (Urteil vom 8. Juni 2006 – 1 A 1093/05 – juris Rn. 102 ff., m.w.N.). Die in der Genehmigungsvoraussetzung der Nr. 9 genannten öffentlichen Interessen seien nicht solche, die keinen strahlenschutz- bzw. sicherheitsspezifischen Bezug haben. Diese Auslegung von Nr. 9 folge daraus, dass die StrlSchV keine Vorschrift für die Genehmigungsbehörde enthält, andere Behörden und Gebietskörperschaften, deren Zuständigkeitsbereich berührt ist, an dem Verfahren zur Genehmigung des Umgangs zu beteiligen. Zweck einer solchen Beteiligung wäre es aber gerade, dass von den beteiligten Stellen etwaige (andere) überwiegende öffentliche Interessen in das Genehmigungsverfahren eingebracht werden, die nicht strahlenschutz- und sicherheitsspezifischer Natur sind, die aber bei der Entscheidung über die Erteilung der Umgangsgenehmigung gleichfalls berücksichtigt werden müssen. Enthalte die Strahlenschutzverordnung keine solche Vorschrift über die Notwendigkeit der Beteiligung Dritter, könnten demgemäß überwiegende (andere) öffentliche Interessen die Erteilung einer Umgangsgenehmigung dann nicht in Frage stellen, wenn sie keinen Bezug zum Schutz vor den schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlen haben. Diese Handhabung des Begriffs der (überwiegenden) öffentlichen Interessen nach der Nr. 9 entspreche dem in § 1 Nr. 2 bis 4 AtG beschriebenen Zweck des AtG, wo es nämlich in erster Linie gerade darum gehe, Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen und durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen verursachte Schäden auszugleichen (Nr. 2), zu verhindern, dass durch Anwendung oder Freiwerden der Kernenergie die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet wird (Nr. 3) und die Erfüllung internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Kernenergie und des Strahlenschutzes zu gewährleisten (Nr. 4). Mit der Genehmigungsvoraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 9 StrlSchV 2001 solle allein sichergestellt werden, dass die Schutzzwecke des § 1 Nr. 2 bis 4 AtG eingehalten werden, wobei nach dem Wortlaut der Vorschrift die Umweltauswirkungen bestimmend seien. Die Genehmigung sei somit zu erteilen, wenn insbesondere der Schutz der Umwelt gewährleistet ist. Darüber hinaus werde die Genehmigungsbehörde entscheiden, ob weitere öffentliche Interessen, z. B. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen sind.
Beide Auffassungen können in der Weise zur Übereinstimmung erbracht werden, dass öffentliche Interessen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 9 StrlSchV solche sind, die eine strahlenschutzrechtlichen bzw. sicherheitsspezifischen, insbesondere die Umwelt betreffenden Bezug haben, aber nicht bereits in den übrigen Nummern des § 9 Abs. 1 StrlSchV berücksichtigt sind.
Gemessen daran sind keine überwiegenden öffentlichen Interessen erkennbar, die dem Umgang der Klägerin mit radioaktiven Stoffen im dafür vorgesehenen Bereitstellungslager entgegenstanden. Insbesondere liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass durch den Betrieb des Lagers in der von der Klägerin beantragten Form der Schutz der Umwelt vor ionisierender Strahlung an dem gewählten Standort nicht gewährleistet gewesen wäre. Auch ist dem Verwaltungsgericht darin beizupflichten, dass es unerheblich ist, ob sich der Beklagte dazu in der Lage sah, die Aufsicht über die Anlage der Klägerin fachgerecht durchzuführen, und Proteste gegen die Errichtung des Bereitstellungslagers zu befürchten waren.
(10) Schließlich stand auch § 4 Abs. 3 StrlSchV 2001 dem beabsichtigten Umgang nicht entgegen.
Nach dieser Vorschrift sind die in Anlage XVI genannten Tätigkeitsarten nicht gerechtfertigt. Die im Teil A der Anlage XVI zur StrlSchV aufgeführten Formen der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung zur Untersuchung oder Behandlung von Menschen (Medizin) stehen hier offensichtlich nicht in Rede.
Im Teil B sind folgende Formen der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung außerhalb der Medizin aufgeführt:
1. Verwendung von Überspannungsableitern mit radioaktiven Stoffen auf Hochspannungsmasten,
2. Verwendung von offenen radioaktiven Stoffen zur Leckagesuche (Wasser, Heizung, Lüftung) oder Verweilzeitspektroskopie, soweit diese Stoffe anschließend nicht wieder gesammelt werden,
3. Verwendung von uranhaltigen oder thoriumhaltigen Stoffen bei der Herstellung von Farben für Glasuren, soweit ein Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann,
4. Verwendung von Tritium-Gaslichtquellen zur Restlichtverstärkung, soweit nicht unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zur Erledigung hoheitlicher Aufgaben notwendig,
5. Verwendung von Vorrichtungen mit fest haftenden radioaktiven Leuchtfarben, ausgenommen
a) Plaketten mit tritiumhaltigen Leuchtfarben im beruflichen, der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich und
b) Notausganghinweise in Fluggeräten mit einer luftfahrtrechtlichen Baumusterzulassung,
6. Verwendung von hochradioaktiven Strahlenquellen bei der Untersuchung von Containern und Fahrzeugen außerhalb der Materialprüfung,
7. Verwendung von Ionisationsrauchmeldern mit einer Bauartzulassung nach Anlage VI Nummer 1 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 30. Juli 2001 geltenden Fassung,
8. Anwendung von umschlossenen radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung am Menschen zur Zutrittskontrolle oder Suche von Gegenständen, die eine Person an oder in ihrem Körper verbirgt, soweit die Anwendung nicht
a) auf Grund eines Gesetzes erfolgt und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zur Erledigung hoheitlicher Aufgaben notwendig ist oder
b) im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zum Zweck der Verteidigung oder der Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen zwingend erforderlich ist.
Auch solche Tätigkeiten stehen hier nicht in Rede.
b) Der Beklagte kann sich schließlich nicht darauf berufen, dass er das Verwaltungsverfahren gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i.V.m. § 10 VwVfG mit Rücksicht darauf ausgesetzt hat, dass bei dem Verwaltungsgericht Braunschweig ein Verfahren anhängig war, bei dem es ebenfalls um die „wirtschaftliche Zuverlässigkeit“ der Klägerin im Zusammenhang mit der Übertragung einer Umgangsgenehmigung von der EZN auf die Klägerin ging.
Nach § 10 Satz 1 VwVfG 1 ist das Verwaltungsverfahren an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen, und nach § 10 Satz 2 VwVfG ist es einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen. Auf der Grundlage des Verfahrensermessens nach § 10 VwVfG kann ein Verwaltungsverfahren ausgesetzt werden (Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl., § 9 Rn. 203; § 10 Rn. 16; Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 24. Aufl., § 75 Rn. 13; a.A.: Porsch, in: Schoch/Schneider, VwGO, 41. EL Juli 2021, § 75 Rn. 8, m.w.N.).
Mit dem Begriff des Verfahrensermessens wird das Recht der Behörde umschrieben, das Verwaltungsverfahren nach ihrem Ermessen zu gestalten und durchzuführen, soweit nicht besondere Rechtsvorschriften bestehen und der Zweck des Verwaltungsverfahrens entgegensteht. Der Grundsatz der Formfreiheit ermächtigt allerdings nicht zu einer beliebigen Verfahrensgestaltung. Vielmehr hat sich die Ausübung des Verfahrensermessens an den Umständen und Besonderheiten des Einzelfalles auszurichten. Zum Inhalt der Verfahrensgestaltung nach § 10 Satz 2 VwVfG gehören auch die Grund-sätze der Praktikabilität und Situationsgerechtigkeit des Verfahrens. Sie können in Konkurrenz zu anderen Zwecken, wie dem Zügigkeitsgebot und dem Grundsatz der Effektivität, treten. Die unterschiedlichen Zwecke sind dann von der Behörde zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen (zum Ganzen: NdsOVG, Beschluss vom 29. Januar 2016 – 11 OB 272/15 – juris Rn. 7, m.w.N.).
Die Anhängigkeit der Klage beim Verwaltungsgericht Braunschweig rechtfertigte nicht die Aussetzung des Verwaltungsverfahrens. Insbesondere konnte sich der Beklagte nicht auf die Vorgreiflichkeit dieses Verfahrens für die Entscheidung über den Genehmigungsantrag der Klägerin berufen. Zwar ist der Rechtsgedanke der Vorgreiflichkeit, auch wenn die die Voraussetzungen einer Aussetzung des gerichtlichen Verfahrens bei Vorgreiflichkeit regelnde Vorschrift des § 94 VwGO im Verwaltungsverfahren nicht anwendbar ist, auf das Verwaltungsverfahren übertragbar. Eine Aussetzung des Verwaltungsverfahrens kann daher vom Verfahrensermessen gedeckt sein, wenn die beabsichtigte Sachentscheidung ganz oder teilweise von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das Gegenstand eines anderen Verwaltungsverfahrens oder Rechtsstreits ist (vgl. NdsOVG, Beschluss vom 29. Januar 2016, a.a.O., Rn. 10, m.w.N.). Diese sog. Vorgreiflichkeit ist jedenfalls dann gegeben, wenn in dem anderen Verfahren eine Entscheidung über einen Teil der Tatbestandsmerkmale zu treffen ist, die im vorliegenden Rechtsstreit zur Entscheidung stehen. Erforderlich ist eine Art der rechtlichen Verbindung beider Entscheidungsgegenstände, nicht aber, dass die Entscheidung im anderen Verfahren eine Bindungswirkung für den auszusetzenden Rechtsstreit entfaltet. Eine rechtliche Verbindung ist zu bejahen bei einem gesetzlich angeordneten oder rechtslogischen Einfluss mit unmittelbaren Auswirkungen auf das zu entscheidende Verfahren. Nicht ausreichend ist, dass sich lediglich die Rechtsschutzziele in beiden Verfahren gleichen und die andere Entscheidung als „Musterprozess“ abgewartet werden soll (Peters/Schwarzburg, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018, § 94 Rn. 9, m.w.N.). Die Behörde ist zur „Aussetzung“ eines Verwaltungsverfahrens ohne die Zustimmung des Antragstellers mit Blick auf eine ausstehende Entscheidung in einem anderen Verfahren jedenfalls dann nicht befugt, wenn diese Entscheidung nicht alsbald zu erwarten steht (vgl. zum Widerspruchsverfahren: VGH BW, Beschluss vom 26. November 2010 – 4 S 2071/10 – juris Rn. 4, m.w.N.). Es ist nicht ersichtlich, dass im Zeitpunkt der Aussetzung des Verwaltungsverfahrens eine Klärung der vom Beklagten für entscheidungserheblich gehaltenen Frage der „wirtschaftlichen Zuverlässigkeit“ durch eine (rechtskräftige) verwaltungsgerichtliche Entscheidung alsbald zu erwarten war.
B. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.
C. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 709 Satz 1 und 2 ZPO.
D. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keiner der in § 132 Abs. 2 VwGO genannten Zulassungsgründe vorliegt.